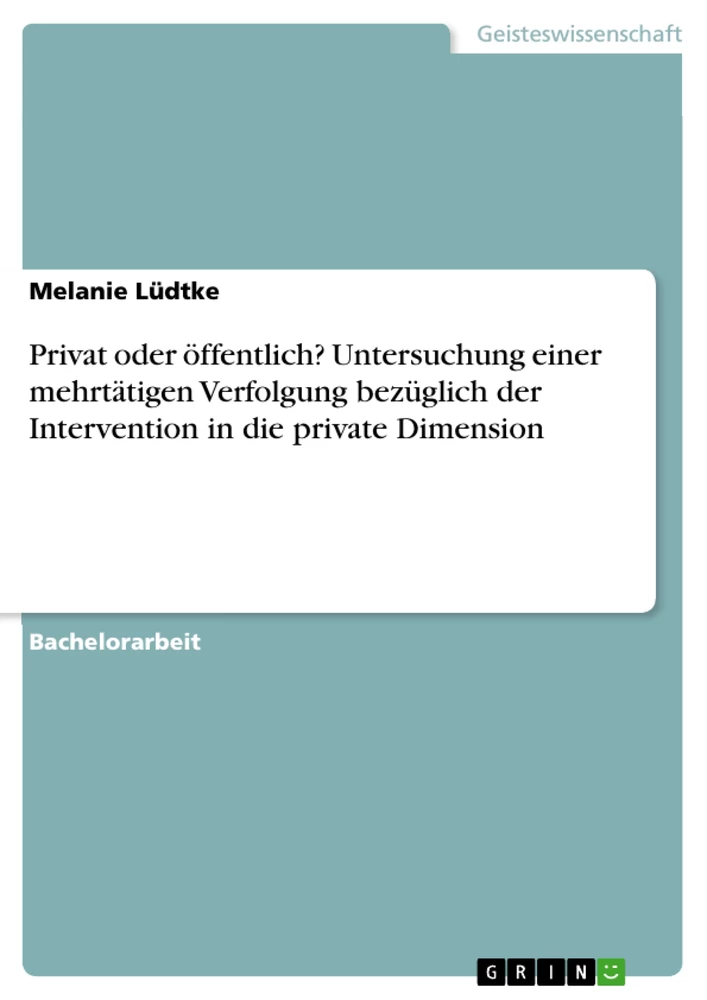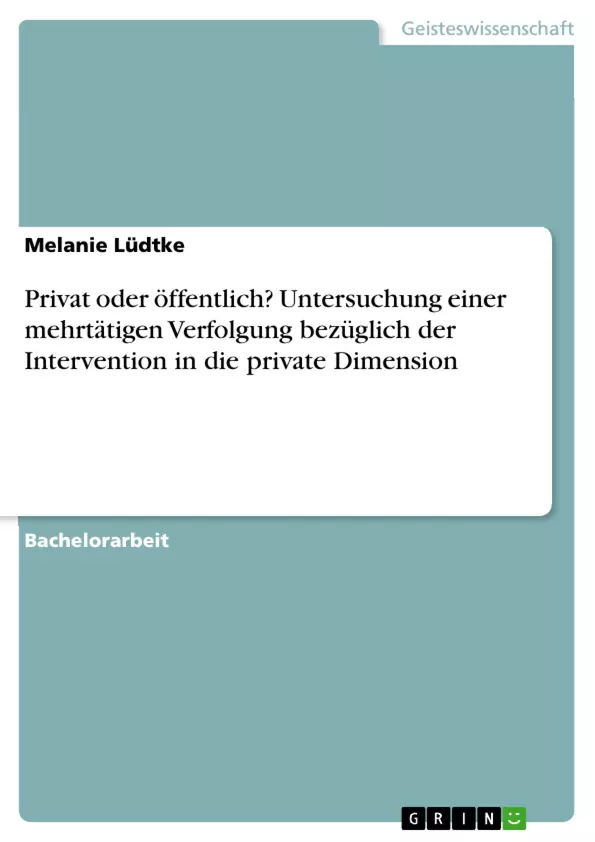Abstract
Die wissenschaftliche Arbeit geht der Frage nach inwiefern im öffentlichen Raum eine Extension des Privaten möglich ist. Hierbei werden am Beispiel des Kunstwerkes "Suite Venitienne", der zeitgenössischen Künstlerin Sophie Calle, philosophische, soziologische und juristische Theorien bezüglich der Intervention in die zum Teil privat zum Teil öffentlich verstandene Sphäre diskutiert.
Sophie Calle zählt in ihrem Herkunftsland bereits seit den 80er Jahren zu den bekanntesten Vertretern zeitgenössischer Kunst. Was sie auszeichnet und gleichwohl von anderen Künstlern unterscheidet, ist ihre Vielfältigkeit und Vorliebe für kontroverse Themen. Calles besonderes Interesse gilt der Entdeckung verborgener Informationen ihr zumeist unbekannter Personen. Dieses Leitmotiv kommt in ihren ersten Werken deutlich zum Ausdruck. Und dennoch beschränken sich diese nicht ausschließlich darauf, Informationen über andere Personen preis zu geben. In unvergleichlicher Form bringt sie ihre eigene Person in eine Vielzahl ihrer Arbeiten mit ein. So sind einige ihrer Werke aus ihrer Sichtweise erzählt, andere vergegenwärtigen eigene Erfahrungen und Geschichten aus ihrem Leben.
In dieser Arbeit soll auf das 1980 entstandene Werk „Suite Vénitienne“ eingegangen werden, welches die Verfolgung eines Mannes in Venedig thematisiert. Dabei gilt es anhand aktueller theoretischer Diskurse zur Privatsphäre zu hinterfragen, inwiefern die mehrtägige Verfolgung des Henri B. und seiner Frau deren Anspruch auf Privatheit beschneidet. Die Ambivalenz des Themas ergibt sich daraus, dass die Verfolgung, die in vieler Hinsicht einer detektivisch anmutenden Observation gleicht, fast ausnahmslos an öffentlichen Plätzen erfolgt. An dieser Stelle gilt es zu hinterfragen, inwieweit die Privatsphäre als Teil der Öffentlichkeit zu begreifen ist bzw. das Öffentliche Privates zulässt oder ob sich innerhalb des öffentlichen Raumes die private Dimension auflöst und zwingend Teil des Öffentlichen wird.
Der Umgang mit dem Werk ist sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch in der öffentlichen Meinung gezeichnet durch einen kontroversen Umgang, wie besonders nach der Veröffentlichung des Werkes deutlich wurde.
Zwar erfolgt in der wissenschaftlichen Theorie vielerorts eine Auseinandersetzung, welche die Durchdringung des öffentlichen Raumes durch das Private thematisiert, jedoch beschreibt eine derartige Anwendung theoretischer Ansätze auf ein Projekt der zeitgenössischen Kunst Neuland.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Exkurs zum Dualismus von Privatheit und Öffentlichkeit
- Liberale Theorie
- Feministische Kritik
- 3. Die private und öffentliche Dimension – aktuelle Diskurse
- Versuch der begrifflichen Abgrenzung von Privatheit und Öffentlichkeit
- Definierung des Öffentlichen
- Definition und Kategorisierung des Privaten
- Das Private in der Öffentlichkeit
- Das Recht der Privatperson am eigenen Bildnis
- 4. ,,Suite Vénitienne“
- 4.1 Die Künstlerin Sophie Calle
- 4.1.1 Einblicke in ihre Werke
- 4.1.2 Sophie Calle und ihre künstlerischen Beweggründe
- 4.2 Das Werk - ,,Suite Vénitienne“
- 4.2.1 Darstellung der Arbeit
- 4.2.2 Arbeitsutensilien und Methoden
- 4.2.3 Die Betrachtung des Werkes aus unterschiedlichen Blickwinkeln
- 4.2.4 Das Erfolgsgeheimnis der „Venezianischen Suite“
- 5. Das Werk - ein Eingriff in das Privatleben?
- Die Betrachtung im historischen Kontext
- Untersuchung in Bezug auf aktuelle Diskurse der privaten und öffentlichen Sphäre
- Das persönliche Bild im theoretischen und rechtlichen Diskurs
- 6. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Werk „Suite Vénitienne“ der französischen Künstlerin Sophie Calle, welches die mehrtägige Verfolgung eines Mannes in Venedig thematisiert. Sie untersucht die Frage, inwiefern diese Verfolgung in das Recht auf Privatsphäre des Mannes und seiner Frau eingreift und die Grenzen zwischen öffentlicher und privater Sphäre verschwimmen.
- Die historische Entwicklung des Begriffspaares Privatheit und Öffentlichkeit
- Aktuelle Diskurse und Debatten zur Abgrenzung von Privatheit und Öffentlichkeit
- Die Darstellung der Künstlerin Sophie Calle und ihrer künstlerischen Praxis
- Die Analyse des Werkes „Suite Vénitienne“ und seine Rezeption in der Öffentlichkeit
- Die Frage nach der Legitimität künstlerischer Interventionen in die Privatsphäre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Künstlerin Sophie Calle sowie ihr Werk „Suite Vénitienne“ vor. Sie erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit, nämlich die Auswirkungen der Verfolgung eines Mannes auf dessen Recht auf Privatsphäre. Im zweiten Kapitel werden die historischen Wurzeln des Begriffspaares Privatheit und Öffentlichkeit beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der liberalen Theorie und ihrer Kritik durch den Feminismus. Kapitel 3 beschäftigt sich mit aktuellen Debatten zur Definition und Abgrenzung von Privatheit und Öffentlichkeit. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Beziehung zwischen öffentlicher und privater Sphäre vorgestellt und die Problematik der Grenzüberschreitungen diskutiert. Kapitel 4 präsentiert das künstlerische Werk „Suite Vénitienne“ und stellt die Künstlerin Sophie Calle und ihre künstlerischen Beweggründe vor. Kapitel 5 untersucht die Frage, ob das Werk als Eingriff in das Privatleben zu betrachten ist. Es analysiert das Werk im Kontext der historischen Entwicklung des Privatheit-Begriffs und aktueller Diskurse zur privaten und öffentlichen Sphäre.
Schlüsselwörter
Privatheit, Öffentlichkeit, Sophie Calle, „Suite Vénitienne“, Kunst, Verfolgung, Künstlerische Freiheit, Grenzen, Recht auf Privatsphäre, Historischer Kontext, Aktuelle Diskurse, Feministische Kritik, Öffentlicher Raum.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Sophie Calles Werk „Suite Vénitienne“?
In diesem Kunstwerk dokumentiert die Künstlerin Sophie Calle die mehrtägige Verfolgung eines ihr fast unbekannten Mannes durch Venedig mittels Fotos und Notizen.
Ist die Verfolgung in „Suite Vénitienne“ ein Eingriff in die Privatsphäre?
Diese Frage ist zentraler Bestandteil der Arbeit. Sie untersucht, ob die Observation im öffentlichen Raum das Recht auf Privatheit des Verfolgten beschneidet.
Wie wird das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit definiert?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit die Privatsphäre Teil der Öffentlichkeit ist oder ob sich die private Dimension im öffentlichen Raum zwangsläufig auflöst.
Welche Rolle spielt die feministische Kritik im Diskurs über Privatheit?
Die feministische Kritik hinterfragt den klassischen Dualismus von Privatheit und Öffentlichkeit, der historisch oft zur Ausgrenzung oder Benachteiligung von Frauen genutzt wurde.
Welches Recht hat eine Privatperson am eigenen Bildnis?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Aspekte der Fotografie von Personen ohne deren Einwilligung, insbesondere im Kontext künstlerischer Projekte.
Warum gilt Sophie Calle als kontrovers?
Calle ist bekannt für ihre Vorliebe für Grenzüberschreitungen und die Entdeckung verborgener Informationen über Fremde, was oft ethische und moralische Debatten auslöst.
- Citation du texte
- Melanie Lüdtke (Auteur), 2005, Privat oder öffentlich? Untersuchung einer mehrtätigen Verfolgung bezüglich der Intervention in die private Dimension, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64911