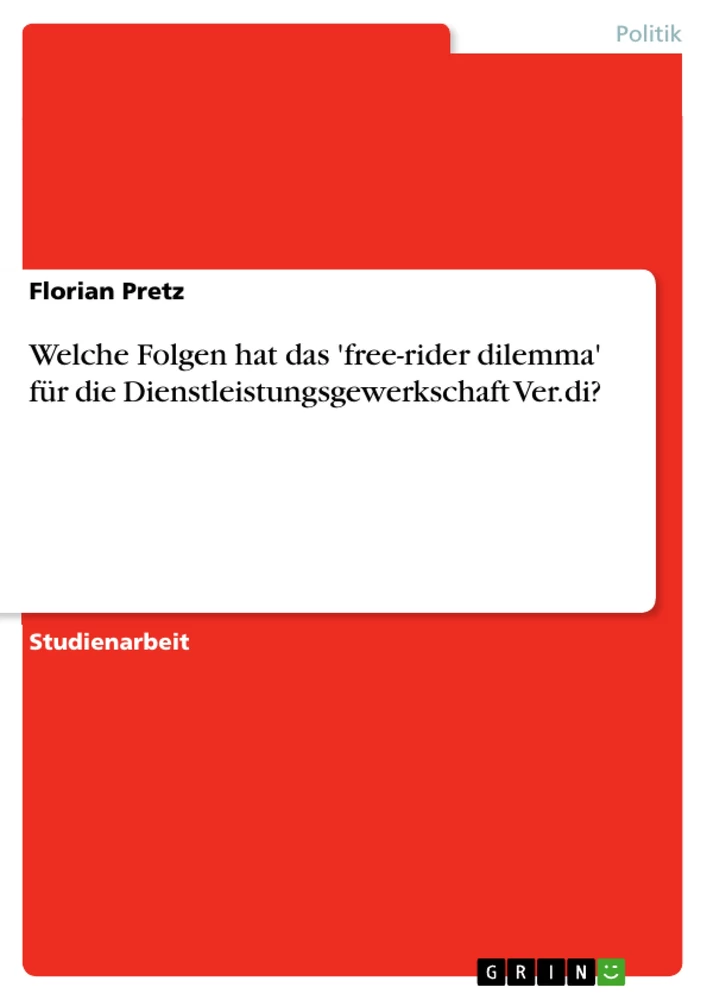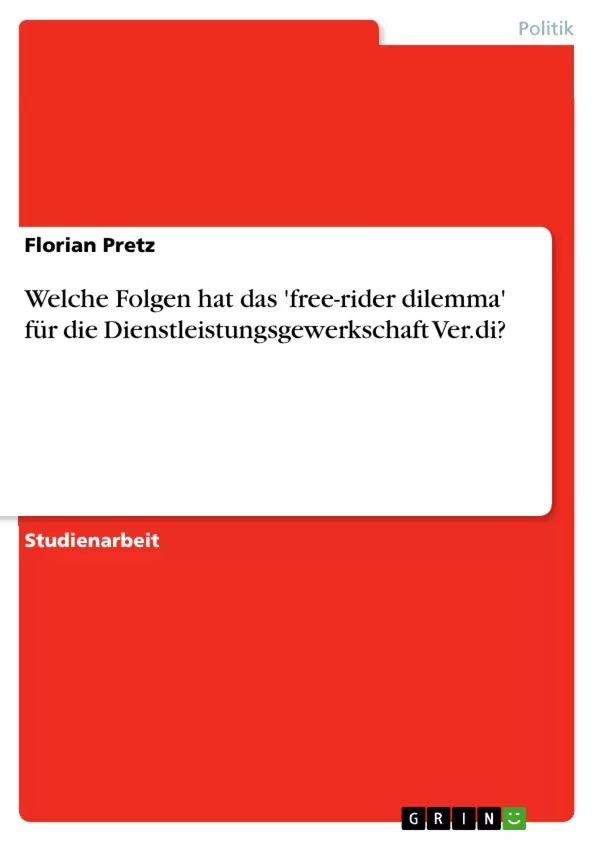Die aktuell andauernden Streiks im Öffentlichen Dienst sind die längsten und teuersten aller Zeiten (Balzli/Tietz/Ulrich 2006: 102). Sie werden organisiert von der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di), die ihre Mitglieder gegen die Implementierung längere Arbeitszeiten im Tarifvertrag protestieren lässt. Doch wer wird am Ende von den Streiks profitieren, wenn der Arbeitskampf der Ver.di erfolgreich ist? Es werden alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sein, deren Arbeitgeber den Tarifvertrag anerkennen. Hierbei ist es nicht von Bedeutung, ob die Beschäftigten Mitglied in der Ver.di sind oder nicht und ob sie mit ihrem Mitgliedsbeitrag die Streiks unterstützen. Diese Divergenz zwischen Mitgliedern einerseits und Nichtmitgliedern andererseits ist ein klassisches Fallbeispiel für Olsons ‚free-rider dilemma’ (Trittbrettfahrer-Dilemma). Welche Konsequenzen diese Situation für die Ver.di hat, soll in der folgenden Arbeit unter der Leitfrage: ‚Welche Folgen hat das ‚free-rider dilemma’ für die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di?’ untersucht werden.
Zu Beginn der Arbeit wird die theoretische Basis der Untersuchung beschrieben. Sie wird von Mancur Olsons ‚The logic of collective action’ gebildet. Es geht speziell um die Problematik großer Gruppen bei der Bereitstellung von Kollektivgütern sowie um die Gewerkschaften als einen Sonderfall großer Gruppen. Außerdem wird der Begriff ‚free-rider’ definiert und ein Ausweg aus der Dilemmasituation aufgezeigt. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Praxis anhand der Theorie erklärt. Zuerst wird die Anfälligkeit der bei ihrer Gründung größten deutschen Gewerkschaft (vgl. Müller/Niedenhoff/Wilke 2002: 160) für free-rider analysiert. Anschließend werden die Folgen für die Ver.di dargestellt und empirisches Material eingeführt. Der an dieser Stelle in der Gliederung erfolgte Bruch mit der wissenschaftlichen Praxis dient der Anschaulichkeit. Ausgehend vom Phänomen des free-ridings gliedern sich die Folgen in drei Ordnungen. Die wichtigste Folge ist die Divergenz zwischen beitragszahlenden Mitliedern auf der einen und kollektivgutkonsumierenden Akteuren auf der anderen Seite. Im Folgenden soll diese Gegebenheit als Mitgliederdivergenz bezeichnet werden. Als erste Folge zweiter Ordnung kommt es zu Finanzproblemen innerhalb der Ver.di, die sich besonders im Streik bemerkbar machen, wenn das Streikpersonal eine finanzielle Entschädigung bekommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mancur Olsons free-rider dilemma in großen Gruppen
- Warum gibt es free-rider bei der Ver.di?
- Die free-rider und ihre Folgen für die Ver.di
- Folge erster Ordnung: Mitgliederdivergenz
- Folge zweiter Ordnung: Finanzprobleme
- Folge dritter Ordnung: Streikprobleme
- Folge zweiter Ordnung: Geschwächte Verhandlungsposition
- Folge dritter Ordnung: Bedeutungsverlust
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Folgen des „free-rider dilemmas“ für die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di. Sie basiert auf der theoretischen Grundlage von Mancur Olsons „The logic of collective action“ und analysiert die Problematik großer Gruppen bei der Bereitstellung von Kollektivgütern, insbesondere im Kontext von Gewerkschaften. Die Arbeit beleuchtet die Anfälligkeit der Ver.di für das „free-rider dilemma“ und zeigt die daraus resultierenden Folgen auf.
- Das „free-rider dilemma“ als ein zentrales Problem für große Gruppen
- Die Auswirkungen des „free-rider dilemmas“ auf die Ver.di
- Die Folgen für die Verhandlungsposition und die Bedeutung der Gewerkschaft
- Mögliche Auswege aus dem „free-rider dilemma“
- Die Bedeutung von Mitgliederengagement und Solidarität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die aktuelle Streiklage im öffentlichen Dienst sowie die Rolle der Ver.di in diesem Zusammenhang dar. Das „free-rider dilemma“ wird als zentrales Problem für die Ver.di eingeführt.
Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen der Untersuchung. Es wird auf Mancur Olsons Theorie des kollektiven Handelns und das „free-rider dilemma“ eingegangen. Die Besonderheiten von Gewerkschaften als große Gruppen werden diskutiert.
Kapitel 3 analysiert die Anfälligkeit der Ver.di für das „free-rider dilemma“. Es werden die Gründe für das Auftreten von Trittbrettfahrern innerhalb der Gewerkschaft untersucht.
Kapitel 4 beleuchtet die Folgen des „free-rider dilemmas“ für die Ver.di. Die Folgen werden in drei Ordnungen gegliedert: Mitgliederdivergenz, Finanzprobleme und eine geschwächte Verhandlungsposition.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen „free-rider dilemma“, „Kollektivgut“, „Gewerkschaften“, „Ver.di“, „Mitgliederdivergenz“, „Finanzprobleme“, „Verhandlungsposition“ und „Bedeutungsverlust“. Sie untersucht die Auswirkungen des „free-rider dilemmas“ auf die Ver.di und analysiert die Herausforderungen, die sich daraus für die Gewerkschaft ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 'free-rider dilemma' (Trittbrettfahrer-Problem)?
Es beschreibt die Situation, dass Personen von Kollektivgütern (z. B. Tariferhöhungen) profitieren, ohne selbst Kosten (z. B. Gewerkschaftsbeiträge) beizutragen.
Warum ist die Gewerkschaft Ver.di besonders anfällig dafür?
Da Tarifergebnisse oft für alle Beschäftigten eines Arbeitgebers gelten, haben Nicht-Mitglieder keinen direkten finanziellen Anreiz, der Gewerkschaft beizutreten.
Welche Folgen hat das Dilemma für die Verhandlungsposition?
Eine geringe Mitgliederquote schwächt die Legitimität und Streikmacht der Gewerkschaft gegenüber den Arbeitgebern.
Welche finanziellen Probleme entstehen durch Trittbrettfahrer?
Der Gewerkschaft fehlen Beiträge zur Finanzierung von Streikgeldern und Organisationskosten, was langfristig zu einem Bedeutungsverlust führen kann.
Was sagt Mancur Olson dazu?
In „The logic of collective action“ argumentiert Olson, dass große Gruppen ohne selektive Anreize Schwierigkeiten haben, ihre Mitglieder zur Kooperation zu bewegen.
- Quote paper
- Florian Pretz (Author), 2006, Welche Folgen hat das 'free-rider dilemma' für die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65023