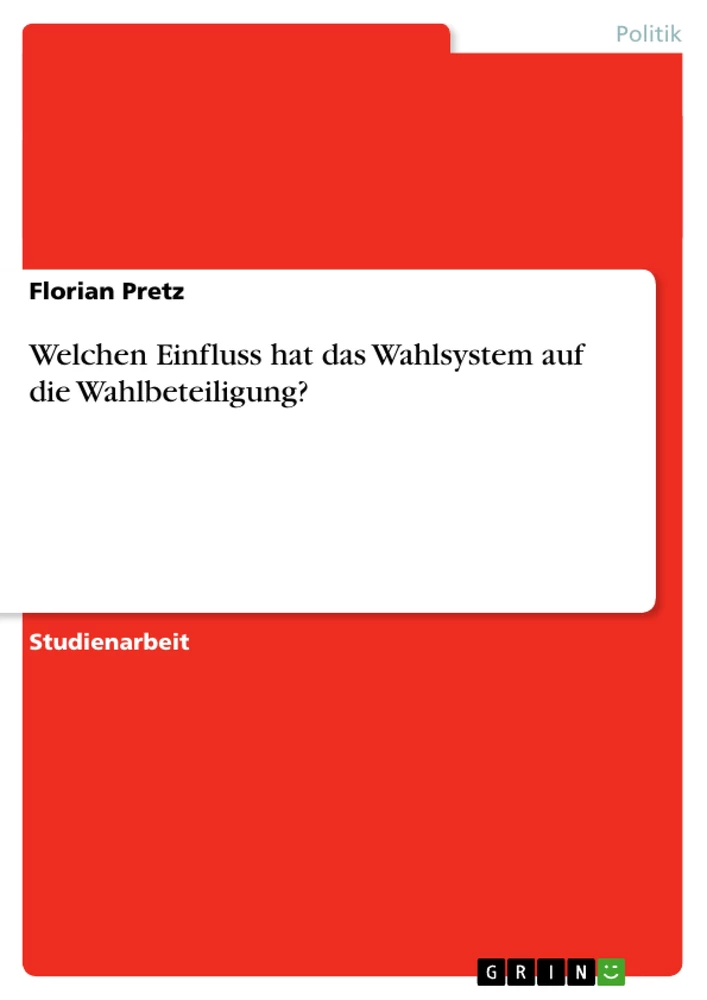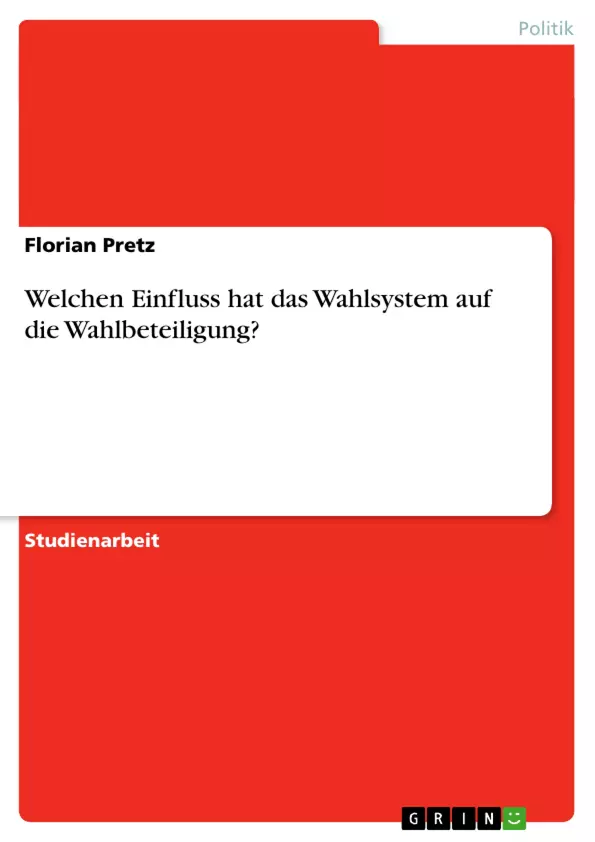Die Untersuchung des vorliegenden Sachverhalts geht auf eine lange Tradition zurück. Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Schriften von Tingsten (1937) und Hermens (1951) veröffentlicht, die sich mit dem Zusammenhang von Wahlsystem und Wahlbeteiligung befassten. Die vergleichende Studie von Douglas W. Rae (1967) gab dem wissenschaftlichen Diskurs eine neue Richtung. Neue und weit reichende Bestimmungsfaktoren des Phänomens Wahlbeteiligung wurden diskutiert. Die Bedeutung, die dem Wahlsystem zugeschrieben wird, ist dabei konstant hoch. Arend Lijphart etwa schrieb 1994: „The electoral system is the most fundamental element of representative democracy“ (Nohlen 2000: 57). Die Variablen ‚Wahlsystem’ und ‚Wahlbeteiligung’ sollen in der vorliegenden Hausarbeit zusammengeführt werden. Untersucht wird der Einfluss der unabhängigen Variablen Wahlsystem auf die abhängige Variable Wahlbeteiligung.
Zu Beginn der Arbeit werden die Begriffe Wahlsystem und Wahlbeteiligung definiert und der Wirkungszusammenhang erläutert. Um möglichst inklusive Vorraussetzungen zur Analyse zu schaffen, wird der Begriff Wahlsystem im weiten Sinne behandelt. Danach wird untersucht, welche institutionellen Einflussfaktoren des Wahlsystems die Wahlbeteiligung beeinflussen. Diese Fragestellung soll betonen, dass die zentrale Untersuchungsebene die des Neo-Institutionalismus ist und Erklärungsansätze der politischen Kulturforschung oder Wertorientierungen hier nicht betrachtet werden. In diesem dritten Abschnitt werden die einzelnen Variablen benannt und ihre theoretische Begründung geliefert. Der vierte Teil der Arbeit überprüft empirisch die Stärke des Zusammenhangs zwischen den unter Punkt drei aufgestellten Dimensionen und der Wahlbeteiligung anhand statistischer Methoden und unter Zuhilfenahme von mehreren zentralen Studien des Forschungsbereichs (Franklin 1996, Lijphart 1997 und Norris 2004). Im abschließenden Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und auf in dieser Arbeit nicht behandelte Untersuchungsebenen des Themas hingewiesen. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es in der vorliegenden empirisch-statistischen Arbeit, bei der Masse an Untersuchungsansätzen, nur um Fragen der konkreten Wirkungsbeziehung hinsichtlich „first-order elections“ (Norris 2004: 163) geht. Darunter versteht man die regierungsbildenden Wahlen eines Staates, also Parlaments-und Präsidentschaftswahlen (vgl. Norris 2004: 163).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Wahlsystem, Wahlbeteiligung
- Welche institutionellen Faktoren des Wahlsystems beeinflussen die Wahlbeteiligung?
- Wahlpflicht
- Umrechnungsmodus der Stimmen in Mandate
- Registrierungsmechanismen zur Wahl
- Zeitpunkt und Länge der Wahl
- Häufigkeit der Wahl, 'electoral salience'
- Andere Einflussfaktoren (Briefwahl und Wahlkreiszuschnitt)
- Empirische Überprüfung der Einflussfaktoren
- Wahlpflicht als ein bewährtes Instrument
- Mehrheits- oder Verhältniswahlrecht
- Automatische- oder freiwillige Registrierung
- Wochenendwahlen, mehrtägige Wahlen
- Seltene oder häufige Wahlen
- Auswirkungen der anderen Einflussfaktoren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Wahlsystems auf die Wahlbeteiligung. Es wird analysiert, inwieweit institutionelle Faktoren des Wahlsystems die Wahlbeteiligung beeinflussen. Der Fokus liegt auf dem Neo-Institutionalismus; Einflüsse politischer Kultur oder Wertorientierungen werden nicht betrachtet. Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten und zentrale Studien des Forschungsbereichs.
- Definition und Konzeptualisierung von Wahlsystem und Wahlbeteiligung
- Analyse institutioneller Einflussfaktoren des Wahlsystems auf die Wahlbeteiligung
- Empirische Überprüfung der Zusammenhänge mittels statistischer Methoden
- Bewertung der Ergebnisse und Ausblick auf weitere Forschungsfragen
- Fokus auf "first-order elections" (Parlaments- und Präsidentschaftswahlen)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die lange Tradition der Forschung zum Zusammenhang von Wahlsystem und Wahlbeteiligung, beginnend mit Arbeiten von Tingsten und Hermens. Sie hebt die konstante Bedeutung des Wahlsystems für die repräsentative Demokratie hervor und benennt die Forschungsfrage: den Einfluss des Wahlsystems (unabhängige Variable) auf die Wahlbeteiligung (abhängige Variable). Die Arbeit definiert den Begriff "Wahlsystem" im weitesten Sinne, inkludiert also nicht nur den Umrechnungsprozess von Stimmen in Mandate, sondern auch Aspekte des Wahlrechts und der Wahlorganisation. Es wird der methodische Ansatz erläutert: Die Arbeit fokussiert sich auf institutionelle Faktoren und lässt kulturelle oder wertorientierte Aspekte außer Acht. Die empirische Überprüfung erfolgt anhand statistischer Methoden und wichtiger Studien des Forschungsfelds. Die Arbeit beschränkt sich auf "first-order elections".
2. Definition Wahlsystem, Wahlbeteiligung: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der zentralen Variablen. "Wahlsystem" wird als ein Satz unveränderter Wahlregeln definiert, unter denen eine oder mehrere aufeinanderfolgende Wahlen in einer bestimmten Demokratie durchgeführt werden. Der weite Ansatz umfasst den Translationsprozess von Stimmen in Sitze, aber auch Teile des Wahlrechts und der Wahlorganisation. "Wahlbeteiligung" wird als der Anteil abgegebener Stimmen an der wahlberechtigten Bevölkerung gemessen. Die Annahme, dass Wahlbeteiligung von historischen Zusammenhängen und dem Alter der Demokratie abhängt, wird als empirisch überprüfbar bezeichnet.
3. Welche institutionellen Faktoren des Wahlsystems beeinflussen die Wahlbeteiligung?: Dieses Kapitel entwickelt die theoretischen Hypothesen, die im weiteren Verlauf empirisch überprüft werden. Der Fokus liegt auf Makro-Ebenen-Faktoren, nicht auf individuellen Einflussgrößen. Das Kapitel gliedert sich in Unterpunkte, die jeweils einen institutionellen Faktor behandeln.
3.1 Wahlpflicht: Die Debatte um den Einfluss von Wahlpflicht auf die Wahlbeteiligung wird dargestellt. Die Arbeit argumentiert, dass die Wahlbeteiligung nicht durch Zwang, sondern durch die Pflicht der Bürger zur Partizipation an der Auswahl der Regierung erhöht werden kann. Die Wahlpflicht wird als eine logische Konsequenz des Trittbrettfahrer-Problems interpretiert.
3.2 Umrechnungsmodus der Stimmen in Mandate: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Arten der Allokation von Sitzen (majoritarian systems, plurality systems, proportional representation, semi-proportional representation), wobei die ersten beiden als Mehrheitswahl und die letzten beiden als Verhältniswahl bezeichnet werden. Die Arbeit kündigt an, sich auf die vierstufige Unterscheidung zu beziehen.
Schlüsselwörter
Wahlsystem, Wahlbeteiligung, Neo-Institutionalismus, Wahlpflicht, Mehrheitswahlrecht, Verhältniswahlrecht, Registrierung, "first-order elections", empirische Forschung, statistische Methoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss des Wahlsystems auf die Wahlbeteiligung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Wahlsystems auf die Wahlbeteiligung. Der Fokus liegt dabei auf institutionellen Faktoren des Wahlsystems und verwendet einen neo-institutionalistischen Ansatz. Kulturelle oder wertorientierte Einflüsse werden nicht berücksichtigt.
Welche Aspekte des Wahlsystems werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene institutionelle Faktoren, darunter Wahlpflicht, den Umrechnungsmodus von Stimmen in Mandate (Mehrheits- vs. Verhältniswahl), Registrierungsmechanismen, den Zeitpunkt und die Länge der Wahl, sowie die Häufigkeit von Wahlen (Electoral Salience) und weitere Einflussfaktoren wie Briefwahl und Wahlkreiszuschnitt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Wahlsystem und Wahlbeteiligung, ein Kapitel zur Analyse institutioneller Einflussfaktoren, ein Kapitel zur empirischen Überprüfung dieser Faktoren und ein Fazit. Sie beinhaltet auch ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen empirischen Ansatz, der auf statistischer Methoden und zentralen Studien des Forschungsbereichs basiert. Der Fokus liegt auf "first-order elections" (Parlaments- und Präsidentschaftswahlen).
Wie wird Wahlbeteiligung definiert?
Wahlbeteiligung wird als der Anteil abgegebener Stimmen an der wahlberechtigten Bevölkerung gemessen. Die Arbeit geht von der Annahme aus, dass Wahlbeteiligung von historischen Zusammenhängen und dem Alter der Demokratie abhängt.
Wie wird das Wahlsystem definiert?
Das Wahlsystem wird als ein Satz unveränderter Wahlregeln definiert, unter denen eine oder mehrere aufeinanderfolgende Wahlen in einer bestimmten Demokratie durchgeführt werden. Diese Definition umfasst den Translationsprozess von Stimmen in Sitze, aber auch Teile des Wahlrechts und der Wahlorganisation.
Welche Hypothesen werden aufgestellt und überprüft?
Die Arbeit entwickelt theoretische Hypothesen über den Einfluss verschiedener institutioneller Faktoren auf die Wahlbeteiligung, die im weiteren Verlauf empirisch überprüft werden. Der Fokus liegt auf Makro-Ebenen-Faktoren.
Welche Rolle spielt die Wahlpflicht?
Die Arbeit argumentiert, dass die Wahlbeteiligung durch die Pflicht der Bürger zur Partizipation an der Auswahl der Regierung erhöht werden kann, nicht durch Zwang. Die Wahlpflicht wird als eine logische Konsequenz des Trittbrettfahrer-Problems interpretiert.
Welche Wahlsysteme werden verglichen?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Mehrheitswahlsystemen (majoritarian systems, plurality systems) und Verhältniswahlsystemen (proportional representation, semi-proportional representation) und kündigt an, sich auf diese vierstufige Unterscheidung zu beziehen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wahlsystem, Wahlbeteiligung, Neo-Institutionalismus, Wahlpflicht, Mehrheitswahlrecht, Verhältniswahlrecht, Registrierung, "first-order elections", empirische Forschung, statistische Methoden.
- Quote paper
- Florian Pretz (Author), 2006, Welchen Einfluss hat das Wahlsystem auf die Wahlbeteiligung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65024