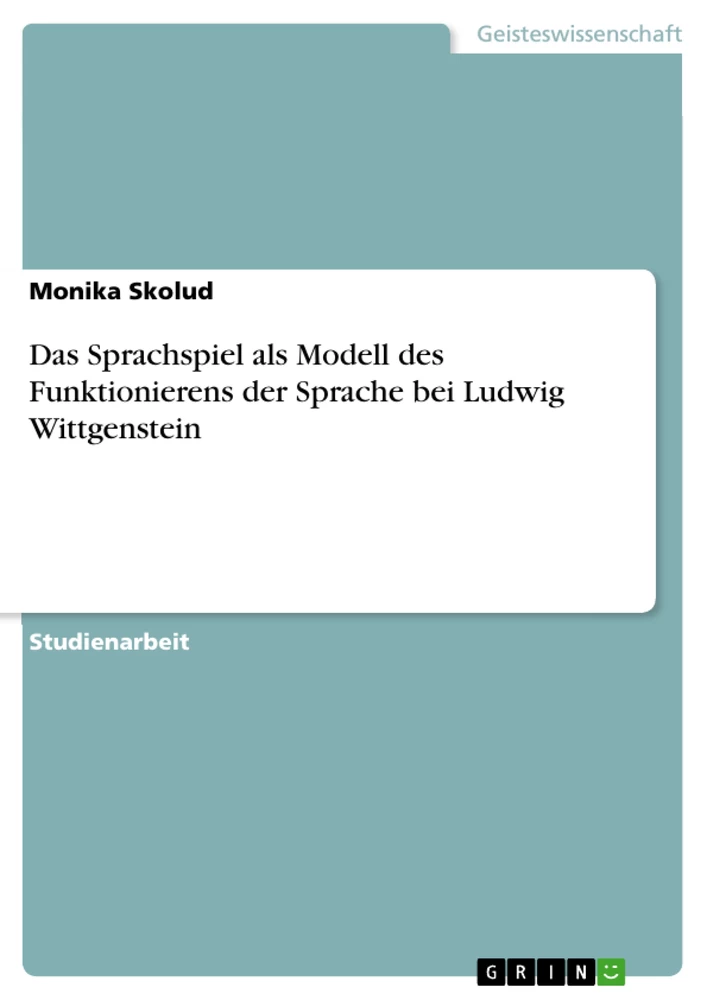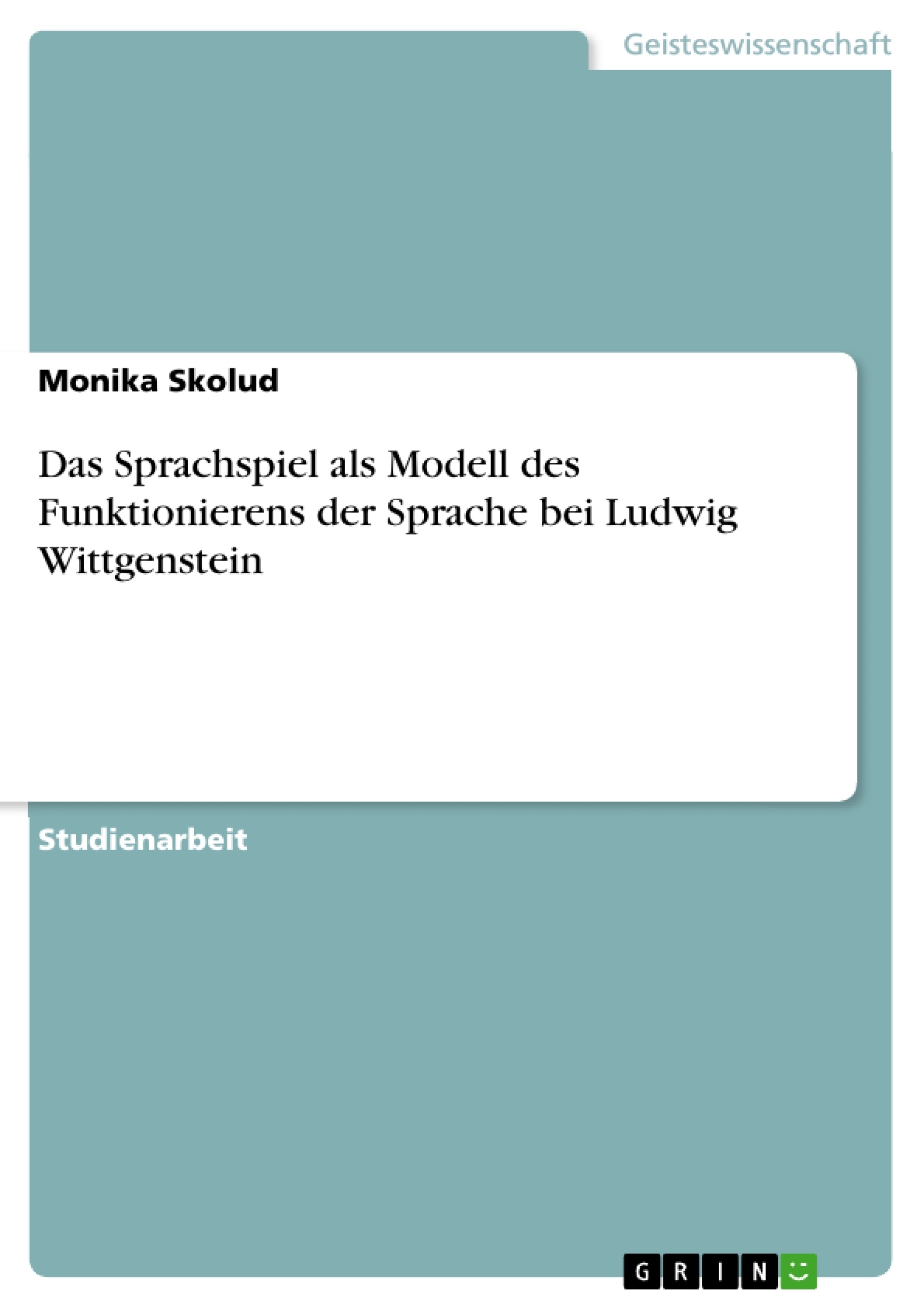In den Philosophischen Untersuchungen betrachtet Ludwig Wittgenstein die Sprache in ihrem Gebrauch in der menschlichen Praxis. Die Wörter und Sätze der Alltagssprache sind gewöhnlich mehrdeutig und vage. Sie stellt jedoch die Wirklichkeit der Sprachgemeinschaft dar. Mit der Alltagssprache ist es möglich„...die Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück [führen].“
Die Philosophischen Untersuchungen bestehen aus lose miteinander verknüpften Bemerkungen, unbeantworteten Fragen, Dialogen, Analogien und sind in aphoristischem Stil verfasst. Einer der zentralen Begriffe ist der des Sprachspiels. In einer ersten Näherung liegt diesem Begriff die Vorstellung zugrunde, das der Sprechende mit Wörtern und Sätzen operiert wie der Schachspieler mit Figuren.„Die Frage >Was ist eigentlich ein Wort?< ist analog der >Was ist eine Schachfigur?<“
Dies geschieht nach bestimmten, im vorhinein feststehenden Regeln. Diese Regeln müssen Beiden am Spiel beteiligten vertraut, wenn auch nicht explizit bewusst sein.„...Würde, was Regel ist, Ausnahme und was Ausnahme, zur Regel; oder würden beide zu Erscheinungen von ungefähr gleicher Häufigkeit - so verlören unsere normalen Sprachspiele damit ihren Witz.“ Aus den umfangreichen Philosophischen Untersuchungen wird in dieser Arbeit der Aspekt des Sprachspiels betrachtet. Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf die dem Sprachspiel nahe stehenden Begriffe der Familienähnlichkeit, der Lebensform und der Handlung bzw. des Gebrauchs. Konstitutiv für die Sprachspiele ist der Regelbegriff, der im Hinblick auf die Anwendung und die Notwendigkeit der Öffentlichkeit betrachtet wird. Ziel dieser Arbeit ist es zu prüfen, in wie weit und ob das Sprachspiel als Modell des Funktionierens der Sprache bei Ludwig Wittgenstein dienen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Das Sprachspiel
- 1.1 Der Begriff des Sprachspiels
- 1.2 Die Verwandtschaft der Sprachspiele durch Familienähnlichkeit
- 1.3 Die Sprachspiele als Lebensform
- 1.4 Der Handlungscharakter der Sprachspiele durch den Gebrauch
- 2. Regeln
- 2.1 Der Begriff der Regel in den Sprachspielen
- 2.2 Die Anwendung der Regeln in den Sprachspielen
- 2.3 Die Notwendigkeit der Öffentlichkeit der Regeln
- 3. Schluss
- 3.1 Zusammenfassung
- 3.2 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ludwig Wittgensteins Konzept des Sprachspiels als Modell für das Funktionieren der Sprache. Sie analysiert die Rolle von Regeln, Familienähnlichkeit, Lebensformen und Handlungscharakter im Kontext von Sprachspielen und befasst sich mit der Frage, ob das Sprachspiel als ein umfassendes Modell für die Sprache dienen kann.
- Der Begriff des Sprachspiels und seine vielfältigen Bedeutungen
- Die Bedeutung von Regeln und ihrer Anwendung in Sprachspielen
- Die Rolle von Familienähnlichkeit und Lebensformen für die Verständigung
- Die Verbindung von Sprache, Handlung und Äußerungsumständen im Sprachspiel
- Das Verhältnis von Sprachspiel und Alltagssprache
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem Begriff des Sprachspiels bei Wittgenstein. Es analysiert verschiedene Definitionen des Sprachspiels und untersucht dessen Bedeutung als primitives Modell für das Lernen und Verstehen von Sprache. Das Kapitel betrachtet auch die Bedeutung von Familienähnlichkeit, Lebensformen und Handlungscharakter für die Funktionsweise von Sprachspielen.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf den Regelbegriff im Kontext von Sprachspielen. Es untersucht die Rolle von Regeln für die Anwendung und den Gebrauch von Sprache und analysiert die Notwendigkeit von Öffentlichkeit für die Geltung von Regeln.
Das dritte Kapitel fasst die zentralen Punkte der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit über die Rolle des Sprachspiels als Modell für das Funktionieren der Sprache bei Ludwig Wittgenstein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Sprachspiel, Wittgenstein, Regeln, Familienähnlichkeit, Lebensformen, Handlung, Sprache, Alltagssprache, Verwendung, Funktionieren, Modell, Anwendung, Öffentlichkeit.
- Quote paper
- Monika Skolud (Author), 2006, Das Sprachspiel als Modell des Funktionierens der Sprache bei Ludwig Wittgenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65038