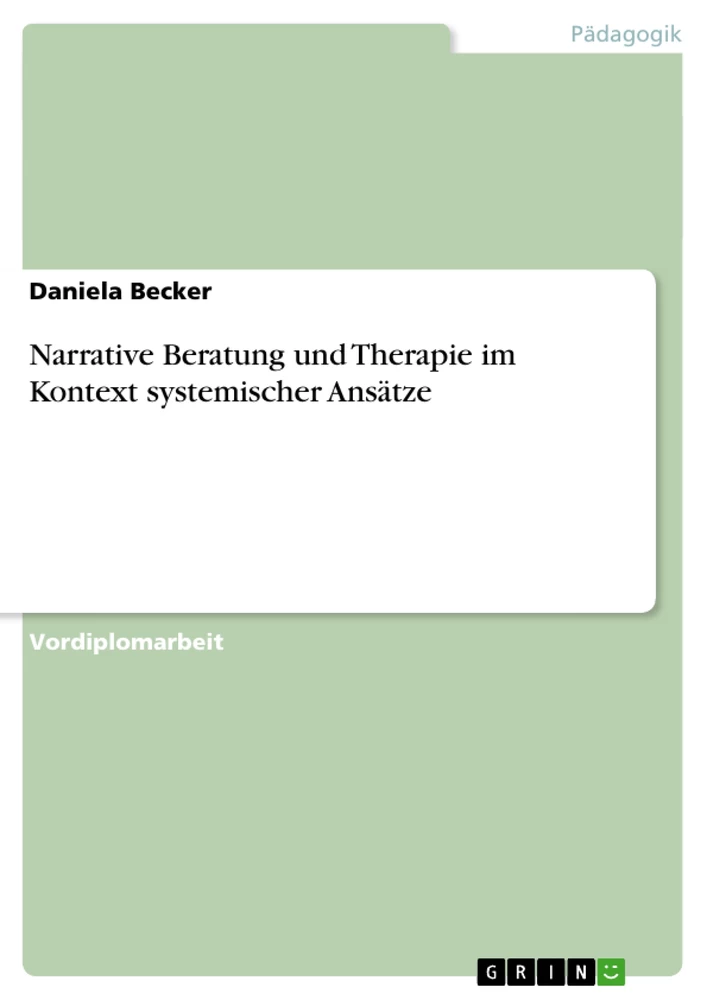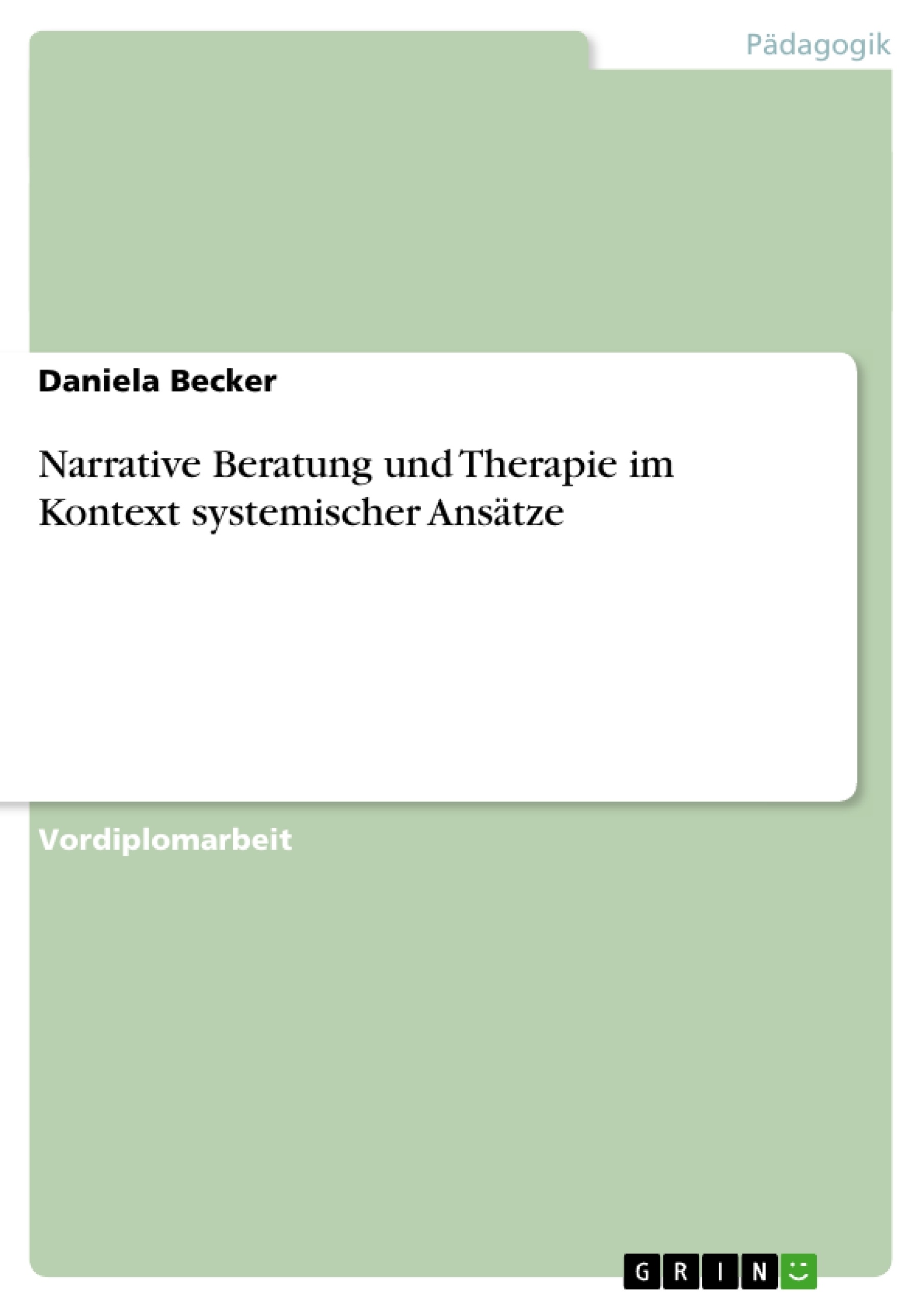Zu Beginn der Arbeit wird ein kurzer Überblick über die Entwicklung der systemischen Therapieform gegeben und es finden sich einige Definitionen und Erklärungen, die für das Verständnis der Arbeit und die Heranführung an das Thema wichtig sind. Anschließend folgt eine Einführung in den sozialen Konstruktionismus nach KENNETH J. GERGEN, der sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen im Austausch miteinander „Wirklichkeit“ erzeugen, die dann im Rahmen therapeutischer Prozesse im Sinne einer geringeren Belastung oder eines größeren Entwicklungsrahmens für den Klienten auch umgestaltet werden kann.
Für die narrative Therapie ist dieser Gedanke unverzichtbar, denn wenn Realität durch Sprache konstruierbar ist, lassen sich Probleme aus einem anderen als dem gewohnten Blickwinkel betrachten und können dadurch an negativer Bedeutung verlieren. DAVID EPSTON und MICHAEL WHITE, die beiden Hauptvertreter der narrativen Therapie, greifen diese Idee auf. In ihrer Therapieform lassen sich Ängste, die sie metaphorisch als „Monster“ bezeichnen, mit Sprache „bändigen“. In der Ausführung dieses Ansatzes, finden sich einige Beispiele aus der Praxis – auch bezogen auf die Arbeit mit Kindern, die der Verdeutlichung und Anschauung dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systemische Beratung
- Definition: Beratung
- Definition: Systemische Beratung
- Historischer Hintergrund: Systemische Beratung - Narrative Therapie
- Systemisches Verständnis von Problemen
- Die Bedeutung der Sprache in der Therapie und die Rolle des Therapeuten
- Sozialer Konstruktionismus – KENNETH J. GERGEN
- Konstruktionismus und Konstruktivismus
- Einführung in die Gedanken KENNETH J. GERGENS
- Objektivität und Wahrheit im Verständnis des sozialen Konstruktionismus
- Narratives Paradigma
- EPSTON/WHITE: Der narrative Ansatz in der Familientherapie
- Einführung
- Externalisierung
- Einmalige Ereignisfolgen
- Transformation von Erzählungen
- Das geschriebene Wort in der Therapie
- ,,Monster zähmen“ - Narrativer Ansatz zum Umgang mit Kinderängsten
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die narrative Beratung und Therapie im Kontext systemischer Ansätze. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen des sozialen Konstruktionismus und zeigt die Anwendung narrativer Methoden in der Praxis auf, insbesondere im Umgang mit Ängsten. Die Arbeit strebt ein tieferes Verständnis der Rolle von Sprache und Erzählungen in therapeutischen Prozessen an.
- Definition und Abgrenzung systemischer und narrativer Beratungsansätze
- Der soziale Konstruktionismus als theoretische Grundlage
- Die Bedeutung von Sprache und Erzählungen in der Therapie
- Anwendungsbeispiele narrativer Methoden, insbesondere die Externalisierungstechnik
- Der narrative Umgang mit Ängsten (am Beispiel von Kindern)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit entstand aus dem Interesse der Autorin an der Macht von Sprache und Erzählungen, geweckt durch frühe Erfahrungen und literarische Einflüsse sowie durch ein Seminar über systemische Konzepte. Sie gibt einen Überblick über die narrative Therapie und den sozialen Konstruktionismus als Grundlage, bevor sie die Ansätze von Epston und White detailliert beschreibt und anhand von Beispielen illustriert.
Systemische Beratung: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Beratung" anhand verschiedener Autoren und erweitert die Definition auf "systemische Beratung". Es betont die ganzheitliche Sichtweise, die Einbeziehung des Umfelds und die Aktivierung der Ressourcen des Klienten. Der öffnende Dialog und die Wahrung der Autonomie des Klienten stehen im Mittelpunkt. Die Vielfältigkeit systemischer Methoden wird erwähnt, wobei der Fokus auf narrative Ansätze gelegt wird.
Sozialer Konstruktionismus – KENNETH J. GERGEN: Dieser Abschnitt führt in den sozialen Konstruktionismus nach Kenneth Gergen ein. Er beleuchtet die konstruierte Natur der Realität und die Rolle des sozialen Austauschs bei der Schaffung von „Wirklichkeit“. Es wird diskutiert, wie diese Perspektive therapeutische Prozesse unterstützt, indem sie alternative Blickwinkel auf Probleme ermöglicht und deren negative Bedeutung reduzieren kann.
EPSTON/WHITE: Der narrative Ansatz in der Familientherapie: Dieses Kapitel präsentiert den narrativen Ansatz von Epston und White in der Familientherapie. Es beschreibt die Externalisierungstechnik, die Einmaligkeit von Ereignissen und die Transformation von Erzählungen. Die Bedeutung des geschriebenen Wortes in der Therapie wird hervorgehoben und der narrative Ansatz im Umgang mit Kinderängsten ("Monster zähmen") wird mit praktischen Beispielen illustriert.
Schlüsselwörter
Narrative Therapie, Systemische Beratung, Sozialer Konstruktionismus, Kenneth Gergen, David Epston, Michael White, Sprache, Erzählungen, Externalisierung, Realitätskonstruktion, Problembewältigung, Kinderängste.
Häufig gestellte Fragen zu: Narrative Beratung und Therapie im Kontext systemischer Ansätze
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die narrative Beratung und Therapie im Kontext systemischer Ansätze. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen des sozialen Konstruktionismus und zeigt die Anwendung narrativer Methoden in der Praxis, insbesondere im Umgang mit Ängsten, auf. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Rolle von Sprache und Erzählungen in therapeutischen Prozessen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung systemischer und narrativer Beratungsansätze; den sozialen Konstruktionismus als theoretische Grundlage; die Bedeutung von Sprache und Erzählungen in der Therapie; Anwendungsbeispiele narrativer Methoden, insbesondere die Externalisierungstechnik; und den narrativen Umgang mit Ängsten (am Beispiel von Kindern).
Welche Autoren und Konzepte werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Ansätze von Kenneth Gergen (Sozialer Konstruktionismus), David Epston und Michael White (narrativer Ansatz in der Familientherapie). Es werden verschiedene Definitionen von Beratung und systemischer Beratung vorgestellt und die Bedeutung des systemischen Verständnisses von Problemen erläutert.
Was sind die zentralen Konzepte des narrativen Ansatzes?
Zentrale Konzepte des narrativen Ansatzes sind die Externalisierungstechnik (Probleme werden als von der Person getrennt betrachtet), die Einmaligkeit von Ereignissen (Fokus auf positive Ausnahmen), die Transformation von Erzählungen (Umdeutung negativer Geschichten) und die Bedeutung des geschriebenen Wortes in der Therapie.
Wie wird der narrative Ansatz bei Kinderängsten angewendet?
Die Arbeit illustriert den narrativen Ansatz am Beispiel des Umgangs mit Kinderängsten (,,Monster zähmen“). Hier wird gezeigt, wie narrative Methoden helfen können, Ängste zu verarbeiten und zu überwinden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Einleitung, Systemische Beratung (inkl. Definitionen, historischem Hintergrund und dem systemischen Verständnis von Problemen), Sozialer Konstruktionismus nach Kenneth Gergen (inkl. Konstruktivismus, Objektivität und dem narrativen Paradigma), Epston/White: Der narrative Ansatz in der Familientherapie (inkl. Externalisierung, einmaligen Ereignisfolgen, Transformation von Erzählungen und dem Umgang mit Kinderängsten) und Schluss.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Narrative Therapie, Systemische Beratung, Sozialer Konstruktionismus, Kenneth Gergen, David Epston, Michael White, Sprache, Erzählungen, Externalisierung, Realitätskonstruktion, Problembewältigung, Kinderängste.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit strebt ein tieferes Verständnis der Rolle von Sprache und Erzählungen in therapeutischen Prozessen an und zeigt die Anwendung narrativer Methoden in der Praxis auf.
- Quote paper
- Daniela Becker (Author), 2006, Narrative Beratung und Therapie im Kontext systemischer Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65058