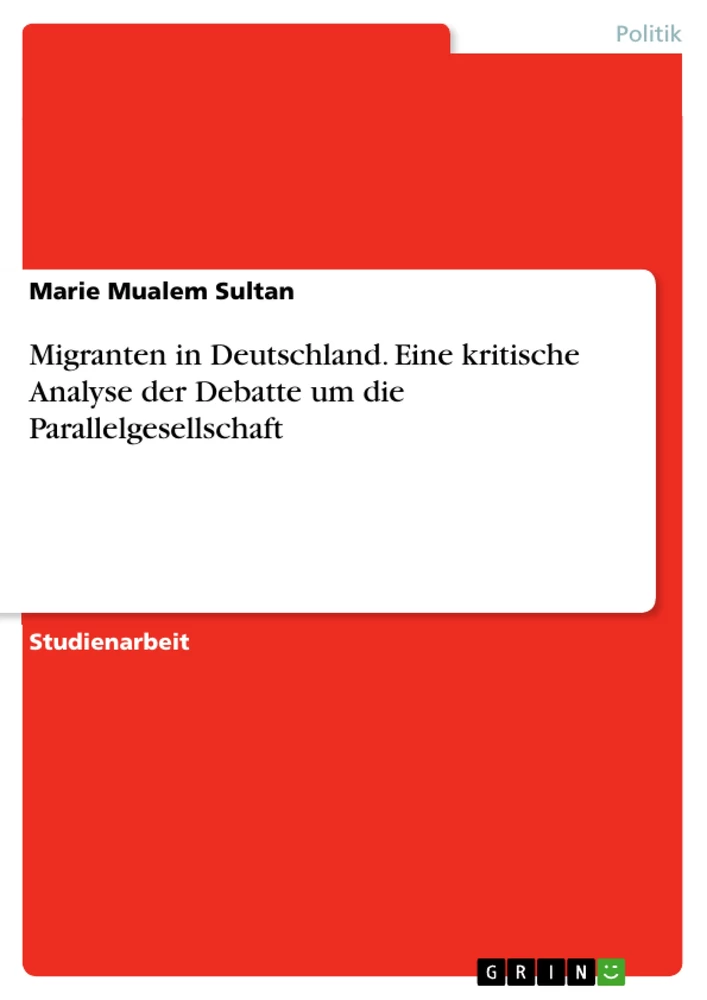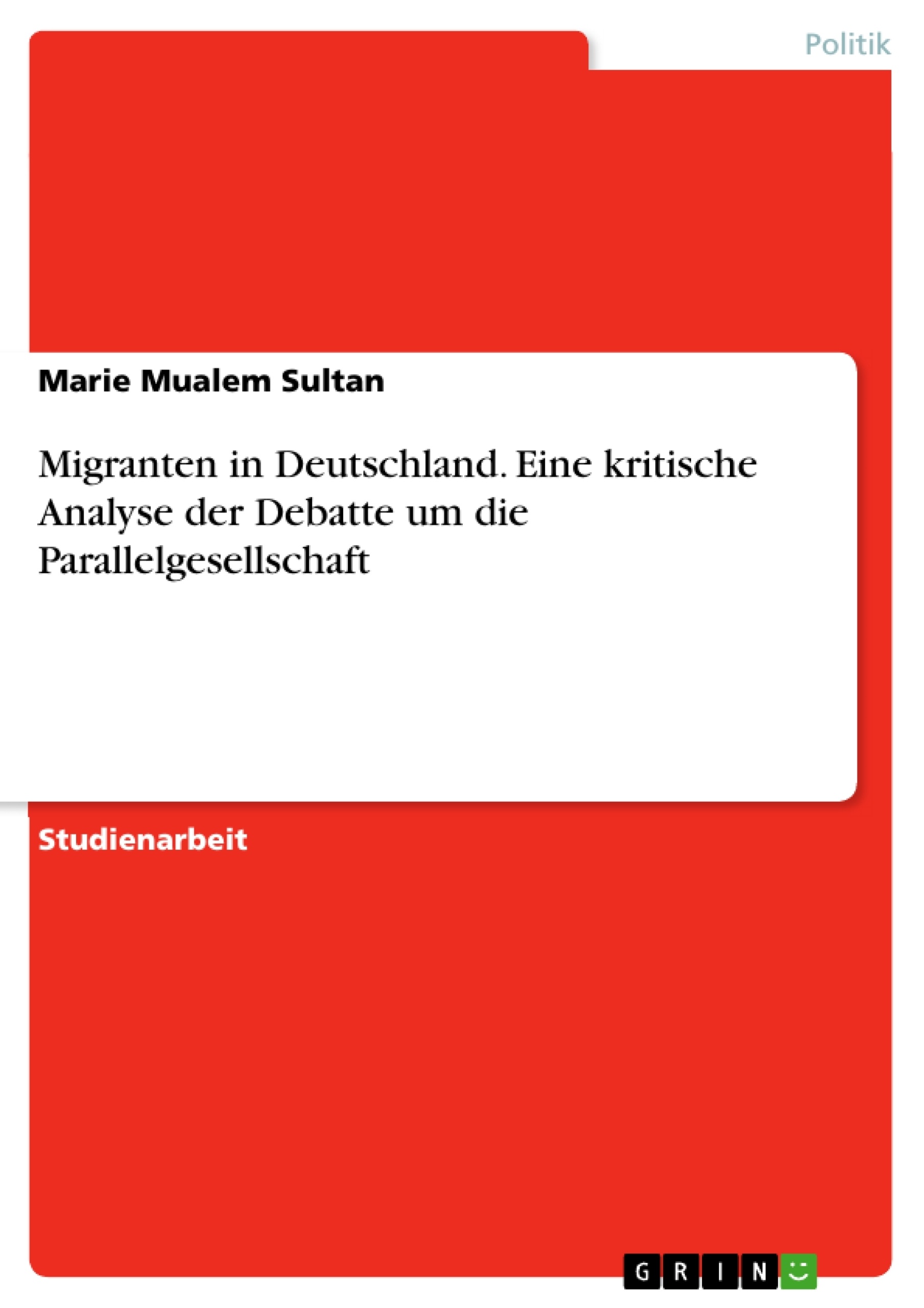Der nebulöse Begriff der Parallelgesellschaft geistert seit einigen Jahren wie ein Schreckgespenst durch die hiesigen Massenmedien und den politischen Diskurs. Er löst bei den Rezipienten zumeist Unbehagen und seit den Anschlägen vom 11. September vermehrt auch die Assoziation direkter Bedrohung - vornehmlich durch islamistisch motivierten Terrorismus - aus. Die dringend notwendige spezifischere Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen Bedeutungsinhalt sowie den Problematiken, die mit dem Begriff verbunden sind, erfolgt hingegen bislang kaum. Die Parallelgesellschaftsdebatte ist ideologisch stark aufgeladen und emotionalisiert. Diesem Missstand soll in der vorliegenden Publikation Abhilfe geschaffen werden.
Anspruch dieser Arbeit ist es, die medial und politisch instrumentalisierte Debatte über Chancen und Hürden der Integration, vor allem der (türkisch-) muslimischen Minderheit in Deutschland, zu versachlichen. In Anerkennung der Tatsache, dass Integration keine Einbahnstraße ist, rückt hierbei auch der geschichtliche Aspekt der deutschen Ausländerpolitik in den Blickpunkt sowie die Realität integrationshemmender Einstellungen der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Die zentrale Fragestellung lautet: Welche Inhalte und Problemlagen werden mit dem Begriff der Parallelgesellschaft tatsächlich umrissen und wie und mit welchen Folgen werden bzw. wurden diese bislang von Wissenschaft und Politik aufgegriffen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was wird mit dem Begriff der Parallelgesellschaft diskutiert?
- 3. Parallelgesellschaft - Der wissenschaftliche Definitionsansatz von Thomas Meyer
- 4. Islamophobie in Deutschland
- 5. Geschichtliche Wirkungskreise im Umgang mit der Einwandererfrage
- 5.1. Die Anwerbephase (1955-1973)
- 5.2. Die Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung (1973-1979)
- 5.3. Die Phase der Integrationskonzepte (1979/80)
- 5.4. Die Wende in der Ausländerpolitik (1981 bis heute)
- 6. Parallelgesellschaft und Demokratie
- 7. Kultureller Pluralismus und die Vorstellung von einer deutschen Leitkultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Debatte um Parallelgesellschaften in Deutschland. Sie untersucht die verschiedenen Definitionen des Begriffs, die Rolle der Islamophobie, und die geschichtlichen Entwicklungen der deutschen Ausländerpolitik. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Integration und den Einfluss von Medienberichterstattung auf das öffentliche Verständnis des Themas.
- Definition und Verwendung des Begriffs „Parallelgesellschaft“
- Der Einfluss von Islamophobie auf die Integrationsdebatte
- Historische Entwicklungen der deutschen Ausländerpolitik
- Integration von (türkisch-)muslimischen Migranten
- Zusammenhang zwischen Parallelgesellschaften und Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Parallelgesellschaften ein und beschreibt den aktuellen öffentlichen Diskurs, der oft mit negativen Ereignissen in Verbindung gebracht wird. Sie betont die Bedeutung der Frage nach der Funktionsfähigkeit multikultureller Gesellschaften und die Notwendigkeit einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema in der deutschen Gesellschaft. Die Arbeit zielt darauf ab, die Debatte zu versachlichen und verschiedene Aspekte des komplexen Diskurses zu beleuchten, wobei der Fokus auf dem Verhältnis zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der (türkisch-)muslimischen Minderheit liegt.
2. Was wird mit dem Begriff der Parallelgesellschaft diskutiert?: Dieses Kapitel analysiert die Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs „Parallelgesellschaft“. Es zeigt auf, dass es keine einheitliche Definition gibt und dass die Verwendung des Begriffs in der Vergangenheit unterschiedlich war, was zu Missverständnissen in aktuellen Diskussionen führt. Kritiker bemängeln die implizite Wertung des Begriffs und die pauschalisierende Kritik an der Lebensweise von Migranten, ohne die möglichen Ursachen für Abgrenzung zu berücksichtigen. Das Kapitel betont die unterschiedliche Verwendung des Begriffs und die daraus resultierende Undurchsichtigkeit der Debatte für die Öffentlichkeit.
3. Parallelgesellschaft - Der wissenschaftliche Definitionsansatz von Thomas Meyer: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text hier unvollständig ist.)
4. Islamophobie in Deutschland: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text hier unvollständig ist.)
5. Geschichtliche Wirkungskreise im Umgang mit der Einwandererfrage: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung der deutschen Ausländerpolitik, unterteilt in verschiedene Phasen: die Anwerbephase (1955-1973), die Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung (1973-1979), die Phase der Integrationskonzepte (1979/80) und die Wende in der Ausländerpolitik (1981 bis heute). Es analysiert, wie der Umgang mit Einwanderung sich im Laufe der Zeit verändert hat und welche historischen Faktoren das heutige Verhältnis zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und immigrierten Minderheiten beeinflussen. Der Fokus liegt auf den westdeutschen Entwicklungen und die Aussiedler werden nicht gesondert betrachtet. Das Kapitel betont die Wichtigkeit des Verständnisses der historischen Entwicklungen, um die aktuelle Debatte um mangelnde Integration richtig einzuordnen.
6. Parallelgesellschaft und Demokratie: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text hier unvollständig ist.)
7. Kultureller Pluralismus und die Vorstellung von einer deutschen Leitkultur: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text hier unvollständig ist.)
Schlüsselwörter
Parallelgesellschaft, Integration, Migranten, Islamophobie, Ausländerpolitik, Deutschland, multikulturelle Gesellschaft, Integrationshemmnisse, Leitkultur, (türkisch-)muslimische Migranten, Mehrheitsgesellschaft, Minderheitsgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Debatte um Parallelgesellschaften in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Debatte um Parallelgesellschaften in Deutschland. Sie untersucht verschiedene Definitionen des Begriffs "Parallelgesellschaft", die Rolle der Islamophobie, die geschichtlichen Entwicklungen der deutschen Ausländerpolitik und die Herausforderungen der Integration. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der (türkisch-)muslimischen Minderheit.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Verwendung des Begriffs „Parallelgesellschaft“, Einfluss von Islamophobie auf die Integrationsdebatte, historische Entwicklungen der deutschen Ausländerpolitik, Integration von (türkisch-)muslimischen Migranten und den Zusammenhang zwischen Parallelgesellschaften und Demokratie. Sie beleuchtet auch den kulturellen Pluralismus und die Vorstellung einer deutschen Leitkultur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Analyse des Begriffs "Parallelgesellschaft", wissenschaftlicher Definitionsansatz von Thomas Meyer, Islamophobie in Deutschland, geschichtliche Entwicklungen der deutschen Ausländerpolitik (unterteilt in verschiedene Phasen), Parallelgesellschaft und Demokratie, sowie kultureller Pluralismus und die Vorstellung einer deutschen Leitkultur. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung.
Welche historischen Phasen der deutschen Ausländerpolitik werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Anwerbephase (1955-1973), die Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung (1973-1979), die Phase der Integrationskonzepte (1979/80) und die Wende in der Ausländerpolitik (1981 bis heute). Der Fokus liegt auf den westdeutschen Entwicklungen.
Welche Kritikpunkte werden an dem Begriff "Parallelgesellschaft" geäußert?
Kritiker bemängeln die implizite Wertung des Begriffs und die pauschalisierende Kritik an der Lebensweise von Migranten, ohne die möglichen Ursachen für Abgrenzung zu berücksichtigen. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs führt zu Undurchsichtigkeit in der öffentlichen Debatte.
Welche Rolle spielt die Islamophobie in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Islamophobie auf die Integrationsdebatte. (Detaillierte Informationen fehlen aufgrund unvollständiger Textvorlage in Kapitel 4).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Debatte um Parallelgesellschaften zu versachlichen und verschiedene Aspekte des komplexen Diskurses zu beleuchten. Sie betont die Bedeutung der Frage nach der Funktionsfähigkeit multikultureller Gesellschaften und die Notwendigkeit einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema in der deutschen Gesellschaft.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Parallelgesellschaft, Integration, Migranten, Islamophobie, Ausländerpolitik, Deutschland, multikulturelle Gesellschaft, Integrationshemmnisse, Leitkultur, (türkisch-)muslimische Migranten, Mehrheitsgesellschaft, Minderheitsgesellschaft.
- Citation du texte
- Marie Mualem Sultan (Auteur), 2006, Migranten in Deutschland. Eine kritische Analyse der Debatte um die Parallelgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65063