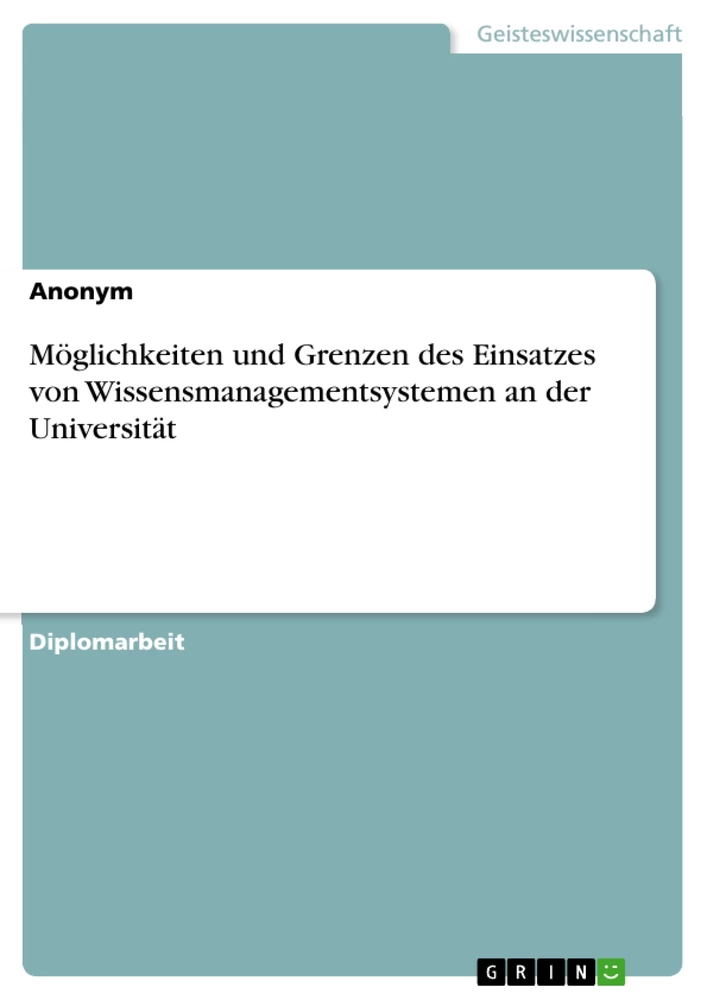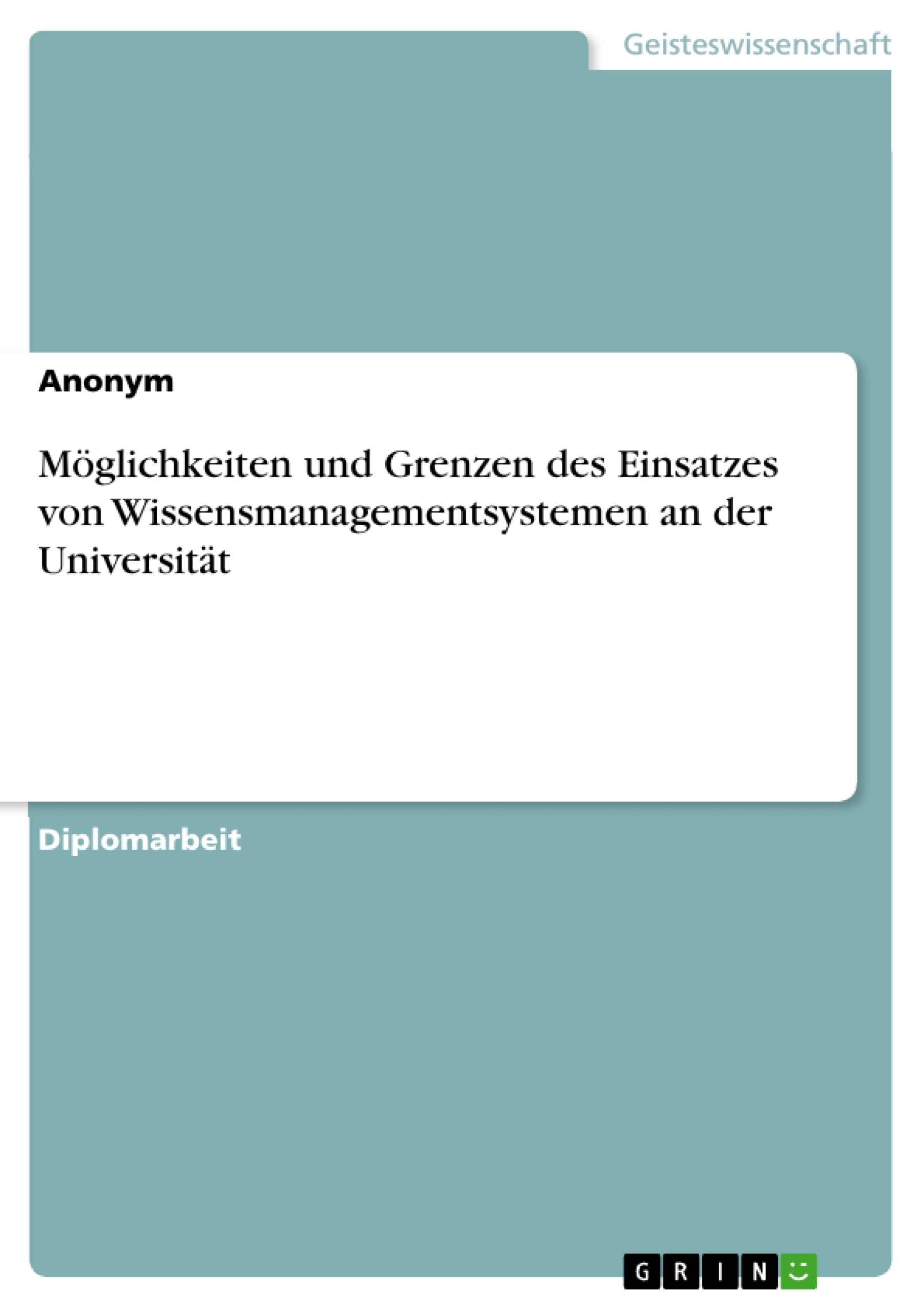Das Thema Wissensmanagement ist in den letzten Jahren auch im sozialwissenschaftlichen Diskurs zu einem wichtigen Thema geworden. Der strukturelle Wandel der Gesellschaft von der „Informationsgesellschaft“ zur sogenannten „Wissensgesellschaft“ (vgl. Stehr 2000, Willke 1998) und die Zunahme der Relevanz von Wissen im gesellschaftlichen Kontext machen eine Auseinandersetzung mit diesem Thema unumgänglich. Die Diskussion um die Bedeutung und den Umgang mit der strategischen Ressource Wissen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und findet sich auch in vielen Fachpublikationen wieder. Wissensmanagement kann dazu auch als Weiterentwicklung im Zusammenhang mit der Diskussion zum organisationalen Lernen gesehen werden.
Obwohl die Beschäftigung mit Wissensmanagement z.T. inflationär als „Modethema“ bezeichnet wird, sollte die Relevanz des Themas nicht unterschätzt werden. Wissen gilt heute als ein, wenn nicht der bedeutendste Produktionsfaktor neben den traditionellen Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Grundbesitz und wird so zu einer relevanten Größe im Wettbewerb. In der Literatur wird Wissen zudem häufig als der vierte Produktionsfaktor angesehen (vgl. Stewart 1998). Besonders das Wissen der Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Organisation rückt in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion, da der individuelle Wissensanteil z.B. bei der Produktion komplexer Dienstleistungen immer größer wird. Die Produktivität von Wissen bzw. von geistig arbeitenden Menschen ist zu einer der zentralen Herausforderung für das Management von Unternehmen und Organisationen geworden. Damit wird eine optimale Nutzung individueller und kollektiver Wissensbestände zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor. Um aber Produktivität, Innovation und Effizienz in Unternehmen und Organisationen zu gewährleisten, muss Wissen gemanagt werden. Die Fähigkeit, Wissen zu identifizieren, zu erwerben und umzusetzen, ist damit eine der Kernkompetenzen der Zukunft. Auch die Bedeutung von Wissen als entscheidender ökonomischer Faktor ist erkannt worden. In Zeiten fortschreitender Globalisierung und mit immer neuen Informations- und Kommunikationstechnologien muss Wissen professionell gemanagt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas - Warum Wissensmanagement?
- 1.2 Forschungsfrage
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4 Begründung der Vorgehensweise
- 2. Wissen und Wissensmanagement
- 2.1 Definition des Wissensbegriffs
- 2.1.1 Daten - Informationen - Wissen
- 2.1.2 Individuelles - organisationales Wissen
- 2.1.3 Explizites - implizites Wissen
- 2.1.4 Wissen speichern und verteilen
- 2.1.5 Wissen generieren - Wissensgenerierung durch organisationales Lernen
- 2.2 Konzepte des Wissensmanagements
- 2.2.1 Die Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi
- 2.2.1.1 Die vier Formen der Wissensumwandlung
- 2.2.1.2 Voraussetzungen für die Wissensschaffung
- 2.2.1.3 Das Fünf-Phasen-Modell der Wissensschaffung
- 2.2.2 Die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al.
- 2.2.2.1 Wissensziele
- 2.2.2.2 Wissensidentifikation
- 2.2.2.3 Wissenserwerb
- 2.2.2.4 Wissensentwicklung
- 2.2.2.5 Wissens(ver)teilung
- 2.2.2.6 Wissensnutzung
- 2.2.2.7 Wissensbewahrung
- 2.2.2.8 Wissensbewertung
- 2.2.2.9 Probleme der Wissensbewertung
- 2.3 Vor- und Nachteile der theoretischen Konzepte und ihrer Anwendbarkeit
- 2.4 Instrumente und Methoden für den Einsatz von Wissensmanagement-Systemen
- 2.4.1 Kommunikation als Grundvoraussetzung
- 2.4.2 Wissenslandkarten/Yellow Pages
- 2.4.3 Communities of Practice
- 2.4.4 Lessons learned
- 2.4.5 Datenbanken und Intranet
- 2.5 Motivationale Voraussetzungen
- 2.6 Wissensbarrieren
- 2.7 Zusammenfassung
- 3. Die Universität
- 3.1 Organisationsstruktur der Universität
- 3.2 Positionspapier des Deutschen Hochschulverbandes zur Organisationsstruktur von Universitäten
- 3.3 Reformprozesse an der Universität Hamburg
- 4. Wissensmanagement an der Universität
- 4.1 Vorüberlegungen zum Einsatz von Instrumenten und Methoden zum Wissensmanagement an der Universität
- 5. Zur Methodik der Experteninterviews
- 6. Möglichkeiten und Grenzen von Wissensmanagement-Systemen an der Universität: Analyse der Experteninterviews anhand der Bausteine nach Probst et al.
- 6.1 Stellenwert der Ressource Wissen
- 6.2 Wissensziele definieren
- 6.3 Wissen identifizieren
- 6.4 Wissen erwerben
- 6.5 Wissen entwickeln
- 6.6 Wissen (ver)teilen
- 6.7 Wissen nutzen
- 6.8 Wissen bewahren
- 6.9 Wissen bewerten
- 6.10 Defizite im Umgang mit Wissen an der Universität
- 6.11 Einstellungen zum Wissensmanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Relevanz des Wissensmanagements im Kontext der Universität und untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Wissensmanagement-Systemen in dieser Organisation. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen des Wissensmanagements an der Universität zu beleuchten und konkrete Handlungsempfehlungen für die Gestaltung eines erfolgreichen Wissensmanagementsystems zu geben.
- Stellenwert von Wissen als strategische Ressource in der Universität
- Analyse der bestehenden Wissensmanagement-Systeme und ihrer Effektivität
- Identifizierung von Barrieren und Chancen im Kontext der universitären Organisationstruktur
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Optimierung des Wissensmanagements an der Universität
- Bewertung der Relevanz von Wissensmanagement in Bezug auf die aktuellen Reformprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Wissensmanagement, beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext des strukturellen Wandels von der "Informationsgesellschaft" zur "Wissensgesellschaft" und die zunehmende Bedeutung von Wissen als Wettbewerbsfaktor. Anschließend werden verschiedene theoretische Konzepte des Wissensmanagements vorgestellt, darunter die Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi und die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al.
Im Anschluss wird die Organisationsstruktur der Universität und die Reformprozesse an der Universität Hamburg im Kontext des Wissensmanagements diskutiert. Die Arbeit analysiert dann die Möglichkeiten und Grenzen von Wissensmanagement-Systemen an der Universität anhand von Experteninterviews, wobei die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al. als analytischer Rahmen dienen.
Die Kapitel 6.1 bis 6.11 beleuchten die einzelnen Bausteine des Wissensmanagements, die sich im Kontext der Universität erweisen, z. B. die Definition von Wissenszielen, die Identifikation und der Erwerb von Wissen, die Entwicklung, Verteilung, Nutzung und Bewahrung von Wissen sowie die Bewertung des Wissensmanagements. Darüber hinaus werden Defizite im Umgang mit Wissen an der Universität und die Einstellungen zum Wissensmanagement von den Experten dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Wissensmanagement, Universität, Wissensgesellschaft, Experteninterviews, Organisationstruktur, Wissensziele, Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung, Wissensbewertung, Handlungsempfehlungen, Reformprozesse, Bachelor- und Masterstudiengänge.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensmanagement für Universitäten heute unumgänglich?
In der modernen Wissensgesellschaft ist Wissen der wichtigste Produktionsfaktor. Universitäten müssen dieses Wissen professionell managen, um im globalen Wettbewerb effizient zu bleiben.
Was ist der Unterschied zwischen explizitem und implizitem Wissen?
Explizites Wissen ist dokumentiert und leicht teilbar (z.B. Handbücher), während implizites Wissen an Personen gebunden ist (Erfahrungen, Know-how) und schwerer übertragen werden kann.
Was besagt die Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi?
Sie beschreibt den Prozess der Wissensumwandlung durch Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung (SECI-Modell).
Welche Barrieren gibt es für Wissensmanagement an Hochschulen?
Strukturelle Hürden, mangelnde Motivation zum Wissensaustausch und die oft dezentrale, autonome Organisation der Institute erschweren ein einheitliches System.
Was sind „Yellow Pages“ im Wissensmanagement?
Es handelt sich um Wissenslandkarten oder Expertenverzeichnisse, die aufzeigen, wer in einer Organisation über welche spezifischen Kompetenzen verfügt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2006, Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Wissensmanagementsystemen an der Universität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65088