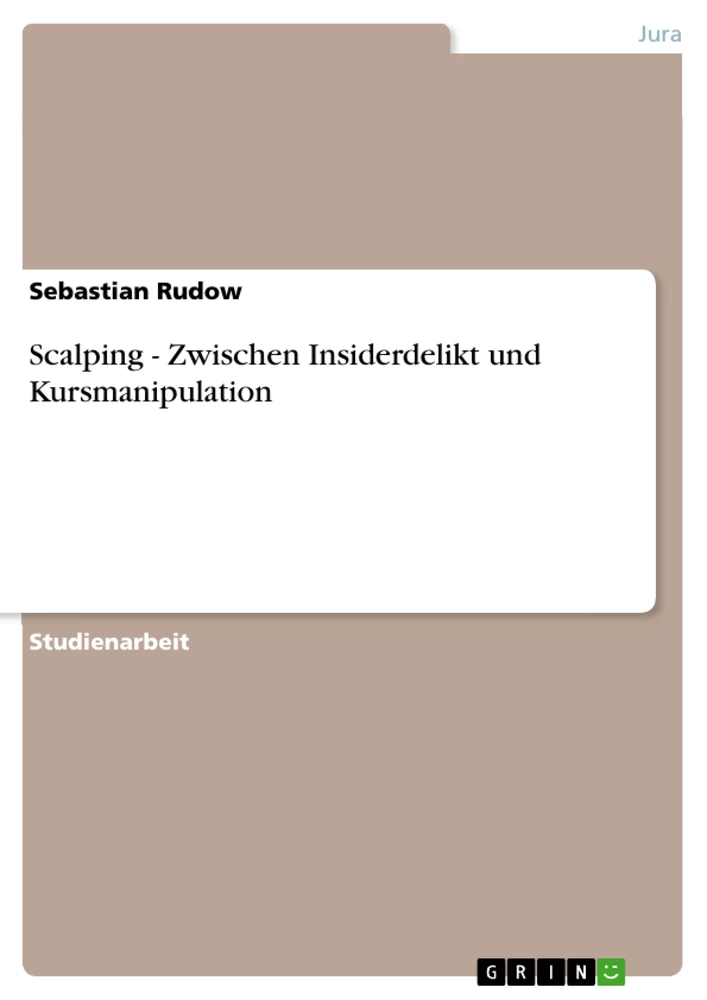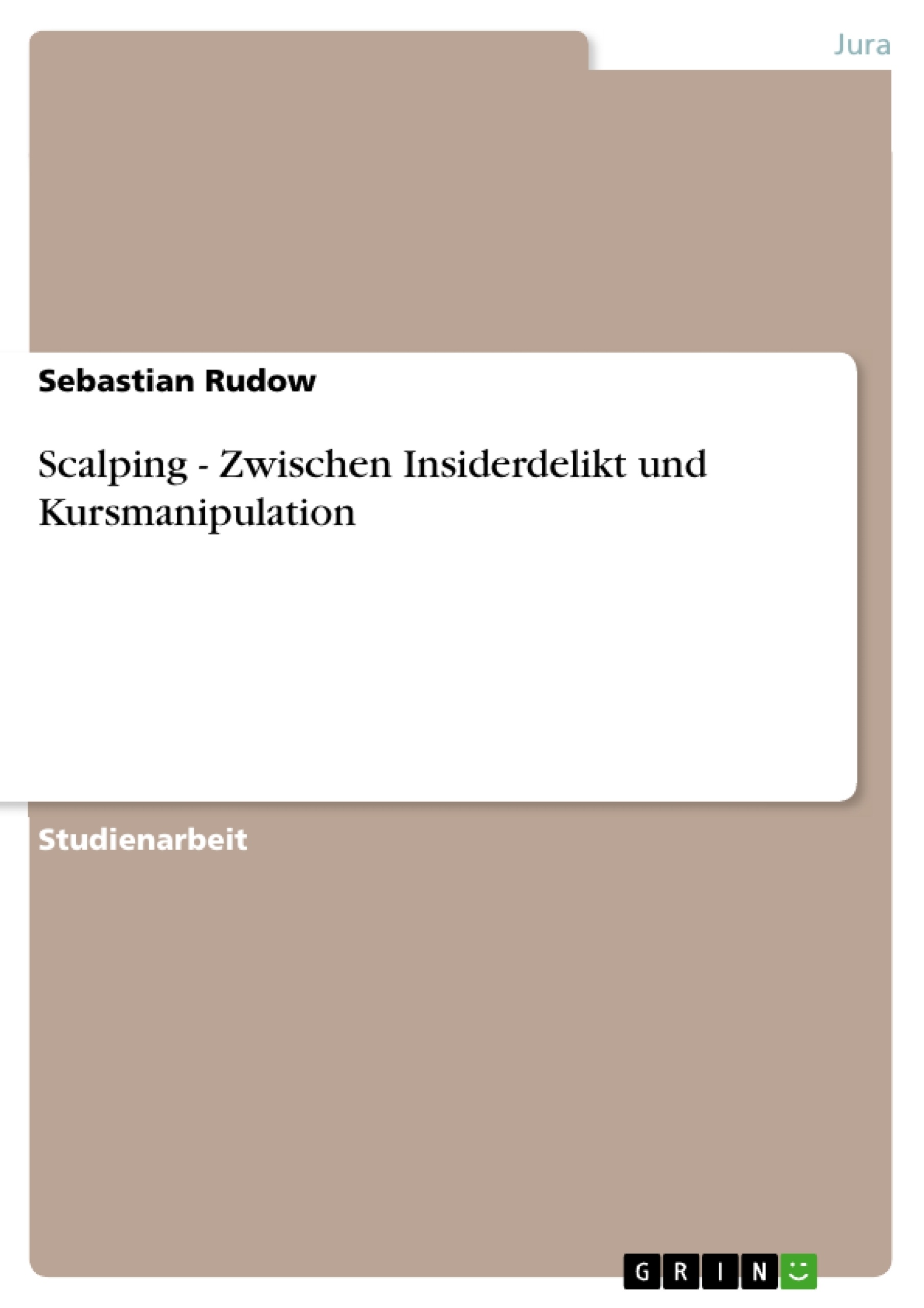Die Frage wie „Scalping“ zu bestrafen sei trat in Deutschland erstmals Ende 1998 bei ins Zwielicht geratenen, regelmäßig im Fernsehen auftretenden Börsenjournalisten auf und war lange umstritten. Wurde anfangs darüber diskutiert, ob „Scalping“ überhaupt strafbar ist, weitete sich die Diskussion dahingehend aus, wie das „Scalping“ dogmatisch richtig in den Sanktionskanon des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) einzuordnen ist. Die Ergebnisse deckten die gesamte mögliche Breite ab: So hat das Ober-landesgericht Frankfurt am Main die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen einen Börsenanalysten nach Beschwerde der Staatsanwaltschaft durch Beschluss vom 14.03.2000 abgelehnt. Die Richter waren der Ansicht, dass aus dem festgestellten Verhalten des Börsenanalysten nicht geschlossen werden konnte, dass dieser Aktien zum Zwecke des „Scalpings“ erworben habe. Die bis dahin von der Rechtssprechung nicht entschiedene Frage, wann das als „Scalping“ bezeichnete Verhalten strafbar ist, wurde von den Richtern allerdings offen gelassen. Das Landgericht Stuttgart urteilte hingegen im Jahr 2002, dass im „Scalping“ ein nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG strafbarer Verstoß gegen das Insiderhandelsverbot des § 14 Abs. 1 Nr. 1 WpHG zu sehen ist. Jedoch hielt dieses nicht rechtskräftige Urteil des Landgerichts Stuttgart den anschließenden rechtlichen Nachprüfungen des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht stand. Dieser entschied in seinem Grundsatzurteil vom 06.11.2003, dass im „Scalping“ ein nach § 20a WpHG strafbarer Verstoß gegen das Verbot der Kurs- und Marktpreismanipulation zu sehen ist.
Aufgrund der verschiedenen Ergebnisse und den offensichtlich unterschiedlichen Anknüpfungspunkte für die rechtsdogmatische Einordnung des „Scalpings“ sowie zwischenzeitlich erfolgter Gesetzesänderung, setzt sich der nachfolgende Beitrag systematisch mit der rechtlichen Behandlung des „Scalpings“ auseinander. Zunächst wird der Vorgang des „Scalpings“ in seinen einzelnen Schritten verdeutlicht und hieran anschließend die Entwicklung der rechtlichen Behandlung des „Scalpings“ beginnend mit dem Tatbestand des Insiderhandelsverbots, gefolgt vom Tatbestand der Kurs- und Marktpreismanipulation dargelegt. Diese Darstellungen sind in die Entwicklungen vor, mit und nach dem Urteil des BGH vom 06.11.2003 chronologisch gegliedert.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung.
- B. „Scalping\" – Verkaufskurs „selbstgemacht“.
- I. Erster Akt: Eingehen eigener Positionen.
- II. Zweiter Akt: Abgabe der Empfehlung.
- III. Dritter Akt: Einbringen des Gewinns.
- C. Sonderwissen oder Täuschungshandlung?.
- I. Das Insiderhandelsverbot.
- 1. Das Insiderhandelsverbot unter alter Gesetzeslage: Tatsache oder Werturteil?.
- 2. Das Urteil des BGH – Die Verwerfung des Insiderhandels.
- 3. Das Insiderhandelsverbot heute: Scalping-Absicht als „präzise Information“?.
- II. Scalping als Kursmanipulation – Die Meinung des BGH.
- 1. Das Urteil des BGH.
- 2. Das Verbot der Kurs- und Marktpreismanipulation heute
- a) § 20a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG.
- b) § 20a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 WpHG.
- III. Stellungnahme.
- 1. Konflikt mit Art. 103 Abs. 2 GG?.
- 2. Die Reichweite des Urteils.
- 3. Praxis,,versus“ BGH – Probleme in der Rechtsrealität.
- D. Zusammenfassung und Fazit.
- Rechtliche Einordnung von Scalping im Kontext des Insiderhandelsverbots
- Untersuchung der Kursmanipulation im Zusammenhang mit Scalping
- Analyse des Urteils des Bundesgerichtshofs zur Strafbarkeit von Scalping
- Diskussion der Auswirkungen des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes auf Scalping
- Abgrenzung von Scalping im Kontext des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des „Scalping“ im Kontext des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts. Das Ziel ist es, die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte dieser Praxis zu untersuchen und die Frage zu klären, ob Scalping als Insiderdelikt oder Kursmanipulation einzustufen ist.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Scalping und beschreibt die einzelnen Akte dieser Praxis: Das Eingehen eigener Positionen, die Abgabe von Empfehlungen und das Einbringen des Gewinns. Anschließend wird das Insiderhandelsverbot unter verschiedenen rechtlichen Aspekten analysiert, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob Scalping als Insiderdelikt einzustufen ist. Die Arbeit beleuchtet das Urteil des Bundesgerichtshofs in diesem Kontext und die Auswirkungen des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes. Es folgt eine Untersuchung der Kursmanipulation im Zusammenhang mit Scalping und eine Diskussion der rechtlichen Einordnung dieser Praxis nach dem WpHG. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Scalping, Insiderhandel, Kursmanipulation, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Anlegerschutzverbesserungsgesetz, Bundesgerichtshof, Rechtsrealität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Scalping“?
Scalping bezeichnet das Vorgehen, eigene Aktienpositionen einzugehen, anschließend eine Kaufempfehlung abzugeben und durch den resultierenden Kursanstieg Gewinne zu realisieren.
Ist Scalping in Deutschland strafbar?
Ja, laut dem Grundsatzurteil des BGH von 2003 gilt Scalping als strafbare Kurs- und Marktpreismanipulation nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).
Gilt Scalping als Insiderhandel?
Der BGH verwarf die Einordnung als Insiderhandel, da die Scalping-Absicht keine „Insiderinformation“ im klassischen Sinne über das Unternehmen selbst darstellt.
Was sind die drei „Akte“ des Scalpings?
1. Eingehen eigener Positionen, 2. Abgabe der Empfehlung, 3. Einbringen des Gewinns durch Verkauf.
Welche Rolle spielt das Anlegerschutzverbesserungsgesetz?
Es hat die rechtlichen Rahmenbedingungen verschärft, um Scalping und andere Formen der Marktmanipulation effektiver sanktionieren zu können.
- Arbeit zitieren
- Diplomjurist Sebastian Rudow (Autor:in), 2006, Scalping - Zwischen Insiderdelikt und Kursmanipulation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65092