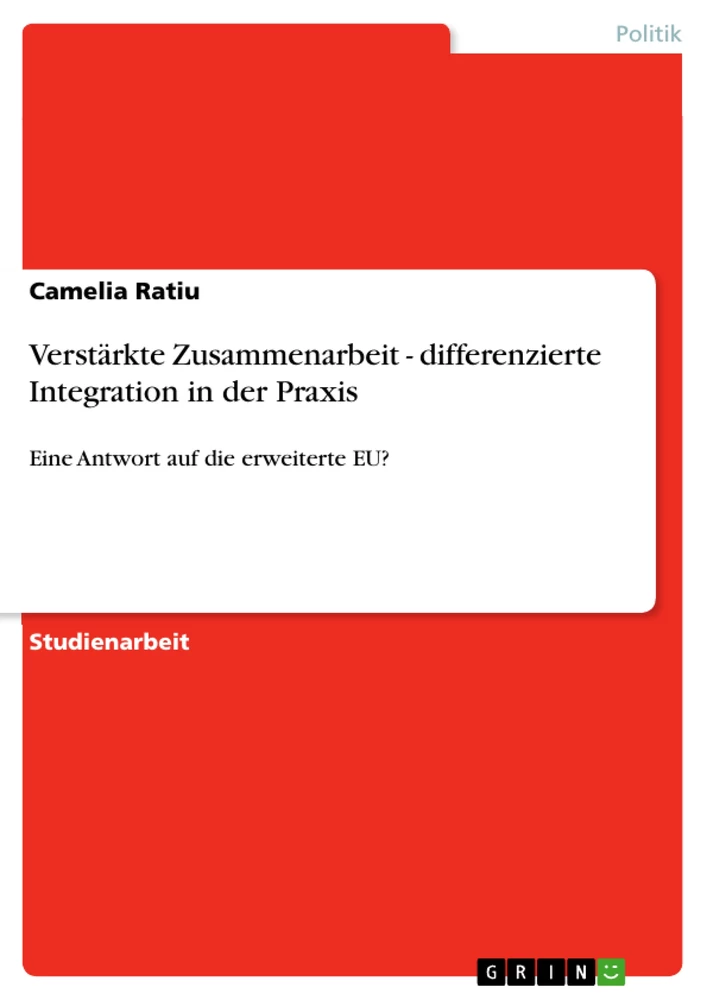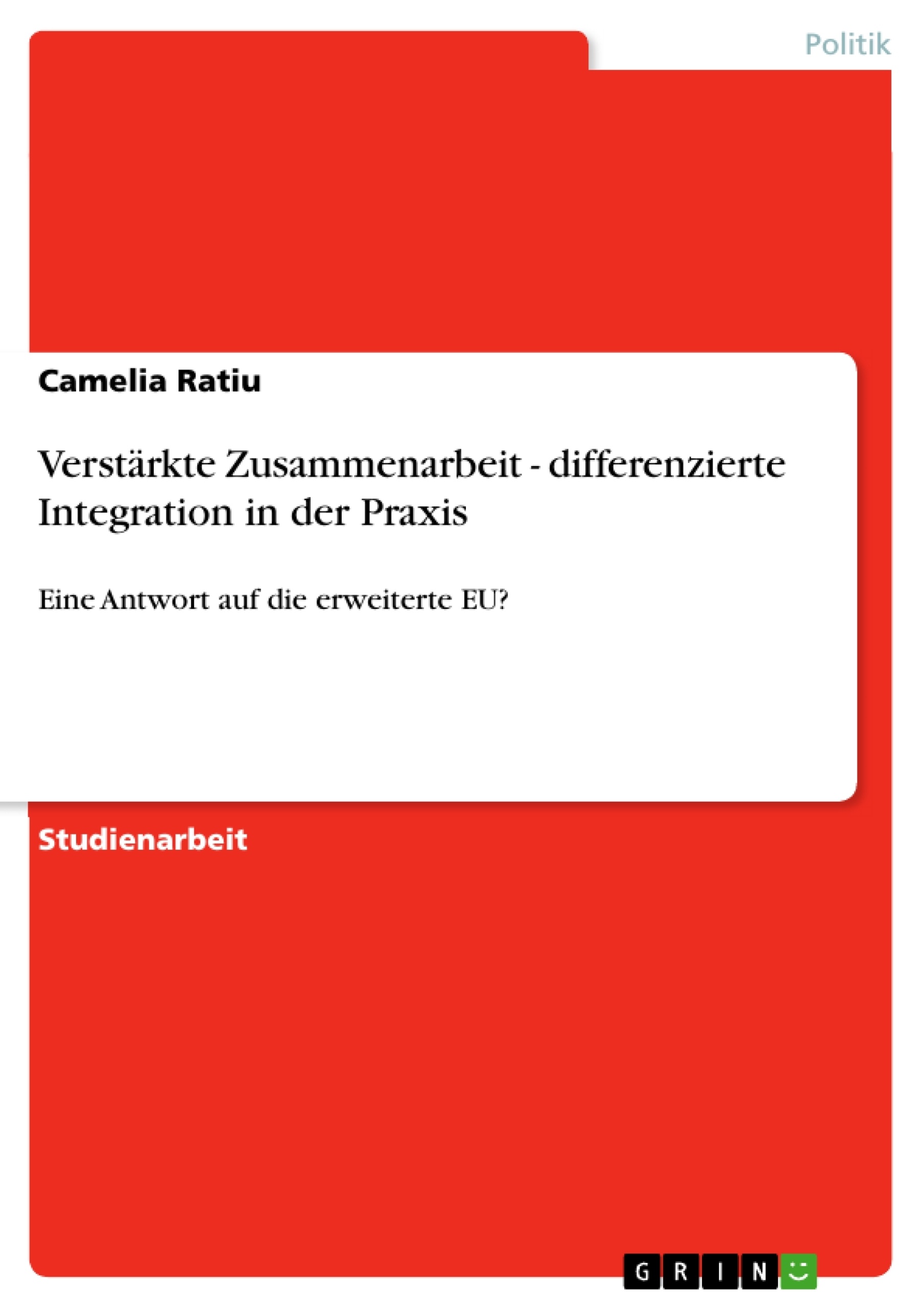Die politischen Entwicklungen der neunziger Jahre und die damit verbundene Perspektive der Osterweiterung haben die Europäische Union vor das Dilemma Vertiefung versus Erweiterung gestellt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Heterogenität innerhalb der Gemeinschaft und der voraussichtlichen Entscheidungsblockaden stellt sich die Frage, wie eine EU mit mehr als 25 Mitgliedern funktionieren soll. Die Befürchtung, die bevorstehenden Erweiterungsrunden könnten den Ausbau der europäischen Integration gefährden oder gar zu einem Rückschritt in Bezug auf den erreichten Integrationsstand führen, entfachten in den letzten Jahren eine komplexe Debatte um die Finalität des Integrationsprozesses. Im Mittelpunkt dieser Debatte steht das Konzept differenzierter Integration, das einem kleinen Kreis von fähigen und willigen Mitgliedstaaten ermöglichen soll, durch engere Kooperation den europäischen Integrationsprozess - auch unter Zurücklassen anderer Mitgliedstaaten - voranzutreiben Dadurch soll der Gefahr vorgebeugt werden, dass der Prozess der europäischen Integration durch die Sonderinteressen einzelner Mitgliedstaaten blockiert wird und stagniert. Rechtlich verankert wurde dieses Konzept als das Instrument der sogenannten „verstärkten Zusammenarbeit“ durch den Vertrag von Amsterdam und wurde durch den Nizza-Vertrag und den Verfassungsentwurf des Konvents reformiert und weiterentwickelt. Diese Arbeit geht der Frage nach, ob und inwieweit die verstärkte Zusammenarbeit eine Antwort auf die erweiterte Europäische Union sein könnte. Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Debatte um das sogenannte „Kerneuropa“ bzw um das Konzept der differenzierten Integration, wobei auf die wichtigsten Differenzierungsvorschläge eingegangen wird, welche im Laufe des letzten Jahrzehnts von Politikern wie Joschka Fischer, Jacques Delors, Jacques Chirac oder Wolfgang Schäuble formuliert wurden. Das zweite Kapitel zeigt anhand von Beispielen wie das Schengener Abkommen und die WWU, dass sich Formen differenzierter Integration schon seit Beginn des europäischen Integrationsprozesses herausgebildet und sich als erfolgreich erwiesen haben. Im dritten Kapitel gehe ich auf die konkrete vertragliche Verankerung des Konzeptes der verstärkten Zusammenarbeit ein, auf die Umstände seiner Einbeziehung in den Vertrag von Amsterdam sowie auf die Gründe, die zu seiner starken Einschränkung führten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Debatte um „Kerneuropa“
- III. Differenzierte Integration – oder „Im Westen nichts neues“
- IV. Die verstärkte Zusammenarbeit im Vertrag von Amsterdam
- 4.1. Die Ausgangslage
- 4.2. Vertragliche Bestimmungen zur verstärkten Zusammenarbeit
- 4.3. Bilanz nach Amsterdam: „inflexible Flexibilität“
- V. Die verstärkte Zusammenarbeit im Vertrag von Nizza
- 5.1. Das vierte „left-over“ von Amsterdam
- 5.2. Vertragliche Bestimmungen zur verstärkten Zusammenarbeit
- 5.3. Bilanz nach Nizza: begrenzte Reform
- VI. Die verstärkte Zusammenarbeit im Verfassungsentwurf
- 6.1. Bestimmungen zur verstärkten Zusammenarbeit
- 6.2. Bilanz: differenzierte Integration in der zukünftigen EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verstärkte Zusammenarbeit als mögliches Antwortmodell auf die Herausforderungen der erweiterten Europäischen Union. Sie analysiert die Entwicklung dieses Konzepts, seine rechtliche Verankerung und seine praktische Anwendbarkeit im Kontext der Debatte um „Kerneuropa“ und differenzierte Integration.
- Die Debatte um „Kerneuropa“ und differenzierte Integration
- Die rechtliche Verankerung der verstärkten Zusammenarbeit in den Verträgen von Amsterdam und Nizza
- Die Reform der verstärkten Zusammenarbeit im Verfassungsentwurf
- Die praktische Anwendbarkeit und die Grenzen der verstärkten Zusammenarbeit
- Die Perspektiven differenzierter Integration in der erweiterten EU
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt das zentrale Problem der Arbeit vor: die Spannung zwischen Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union. Sie beschreibt die Debatte um differenzierte Integration als Antwort auf die zunehmende Heterogenität innerhalb der EU und die Gefahr von Entscheidungsblockaden in einer erweiterten Union. Das Konzept der „verstärkten Zusammenarbeit“ wird als rechtliche Grundlage für differenzierte Integration eingeführt und die Forschungsfrage nach der Eignung dieses Instruments für die erweiterte EU formuliert. Die Struktur der Arbeit wird kurz umrissen.
II. Die Debatte um „Kerneuropa“: Dieses Kapitel beleuchtet die politische Debatte um „Kerneuropa“ und differenzierte Integration in den 1990er Jahren. Es analysiert verschiedene Vorschläge von Politikern wie Schäuble, Lamers, Delors, Fischer und Chirac, die sich mit der Frage auseinandersetzten, wie man angesichts der Erweiterung die Integration dynamisch gestalten kann. Die unterschiedlichen Konzepte einer „Avantgarde“ oder eines „Gravitationszentrums“ werden verglichen und in den Kontext der zunehmenden Heterogenität und des damit verbundenen Problems der Kohäsion innerhalb der EU gestellt.
III. Differenzierte Integration – oder „Im Westen nichts neues“: Dieses Kapitel untersucht, ob differenzierte Integration ein neues Phänomen ist oder ob es bereits in der Vergangenheit Beispiele für unterschiedliche Integrationsgeschwindigkeiten gab. Es werden verschiedene Beispiele wie das Schengener Abkommen, die Westeuropäische Union (WEU) und die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) analysiert. Es wird argumentiert, dass differenzierte Integration immer schon Teil des europäischen Integrationsprozesses war, jedoch durch den Vertrag von Amsterdam erstmal rechtlich verankert wurde.
IV. Die verstärkte Zusammenarbeit im Vertrag von Amsterdam: Das Kapitel analysiert die vertraglichen Bestimmungen zur verstärkten Zusammenarbeit im Vertrag von Amsterdam. Es beschreibt die politischen Hintergründe für die Aufnahme dieses Themas in die Verhandlungen und die vier zentralen Gründe (wachsende Heterogenität, Sorge vor Verlangsamung der Integration, Erwartung der Stärkung der EU durch Flexibilisierung, deutsch-französische Initiative) für die vertragliche Verankerung. Die konkreten vertraglichen Bestimmungen, ihre Bedingungen und Einschränkungen werden detailliert erläutert. Schließlich wird die Bilanz des Vertrags von Amsterdam gezogen und seine „inflexible Flexibilität“ kritisch diskutiert. Die starken normativen Schranken und prozeduralen Fesseln werden herausgearbeitet.
V. Die verstärkte Zusammenarbeit im Vertrag von Nizza: Das Kapitel befasst sich mit der Reform der verstärkten Zusammenarbeit im Vertrag von Nizza. Es beschreibt die politischen Hintergründe der Reform, die als „vierter Rest“ von Amsterdam betrachtet werden kann. Die drei Hauptpositionen der Mitgliedsstaaten (Reformförderer, Integrationsverteidiger, Status-quo-Befürworter) während der Verhandlungen werden dargelegt. Die konkreten Änderungen der vertraglichen Bestimmungen und ihre Auswirkungen werden diskutiert, insbesondere die Abschaffung des Vetorechts und die Ausweitung der verstärkten Zusammenarbeit auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Die Bilanz von Nizza wird gezogen und es wird festgestellt, dass die Reform zwar Verbesserungen brachte, aber die Anwendbarkeit des Instruments der verstärkten Zusammenarbeit immer noch begrenzt blieb.
VI. Die verstärkte Zusammenarbeit im Verfassungsentwurf: Der Abschnitt befasst sich mit der Weiterentwicklung der verstärkten Zusammenarbeit im Verfassungsentwurf. Es beschreibt den Kontext der Debatte (u.a. Irak-Krise, Vierer-Gipfel), die Struktur der neuen Bestimmungen und die vorgenommenen Änderungen im Vergleich zu den Verträgen von Amsterdam und Nizza. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Vereinfachung des Verfahrens, der Aufhebung von Restriktionen, der Erweiterung des Anwendungsbereichs und der Einführung gesonderter Formen der flexiblen Zusammenarbeit in der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Die positive Bilanz des Verfassungsentwurfs wird gezogen, wobei die verbleibenden Einschränkungen diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Verstärkte Zusammenarbeit, differenzierte Integration, Kerneuropa, Europäische Union, Erweiterung, Vertiefung, Amsterdam-Vertrag, Nizza-Vertrag, Verfassungsentwurf, Entscheidungsfindung, Flexibilisierung, Integrationsprozess, Gemeinschaftspolitik, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP).
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Verstärkte Zusammenarbeit in der Europäischen Union
Was ist das zentrale Thema des Dokuments?
Das Dokument untersucht die „verstärkte Zusammenarbeit“ als mögliches Lösungsmodell für die Herausforderungen der erweiterten Europäischen Union. Es analysiert die Entwicklung dieses Konzepts, seine rechtliche Verankerung und seine praktische Anwendbarkeit im Kontext der Debatte um „Kerneuropa“ und differenzierte Integration.
Welche Aspekte der verstärkten Zusammenarbeit werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Debatte um „Kerneuropa“ und differenzierte Integration, die rechtliche Verankerung der verstärkten Zusammenarbeit in den Verträgen von Amsterdam und Nizza, die Reform im Verfassungsentwurf, die praktische Anwendbarkeit und Grenzen des Konzepts sowie die Zukunftsperspektiven differenzierter Integration in der erweiterten EU.
Welche Verträge werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert ausführlich die Verträge von Amsterdam und Nizza, sowie den Verfassungsentwurf, jeweils im Hinblick auf die Bestimmungen zur verstärkten Zusammenarbeit. Es werden die politischen Hintergründe, die vertraglichen Regelungen und die jeweilige Bilanz dieser Entwicklungsschritte untersucht.
Welche historischen Debatten werden beleuchtet?
Das Dokument beleuchtet die politische Debatte um „Kerneuropa“ in den 1990er Jahren und analysiert verschiedene Vorschläge von Politikern wie Schäuble, Lamers, Delors, Fischer und Chirac zur Gestaltung der Integration angesichts der Erweiterung. Es wird auch untersucht, ob differenzierte Integration ein neues Phänomen ist oder bereits in der Vergangenheit vorkam (z.B. Schengen-Abkommen, WEU, WWU).
Welche Kritikpunkte werden an der verstärkten Zusammenarbeit geübt?
Die Arbeit kritisiert die anfängliche „inflexible Flexibilität“ des Instruments der verstärkten Zusammenarbeit, die starken normativen Schranken und prozeduralen Fesseln. Obwohl der Vertrag von Nizza Verbesserungen brachte, blieb die Anwendbarkeit des Instruments begrenzt. Die verbleibenden Einschränkungen werden auch im Kontext des Verfassungsentwurfs diskutiert.
Was ist die Schlussfolgerung des Dokuments?
Der Verfassungsentwurf wird positiv bewertet, da er Vereinfachungen des Verfahrens, die Aufhebung von Restriktionen, die Erweiterung des Anwendungsbereichs und die Einführung gesonderter Formen der flexiblen Zusammenarbeit vorsieht. Dennoch werden auch im Verfassungsentwurf verbleibende Einschränkungen diskutiert. Die Arbeit liefert somit eine umfassende Analyse der verstärkten Zusammenarbeit, ihrer Entwicklung und ihrer Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Verstärkte Zusammenarbeit, differenzierte Integration, Kerneuropa, Europäische Union, Erweiterung, Vertiefung, Amsterdam-Vertrag, Nizza-Vertrag, Verfassungsentwurf, Entscheidungsfindung, Flexibilisierung, Integrationsprozess, Gemeinschaftspolitik, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP).
- Citar trabajo
- Camelia Ratiu (Autor), 2004, Verstärkte Zusammenarbeit - differenzierte Integration in der Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65177