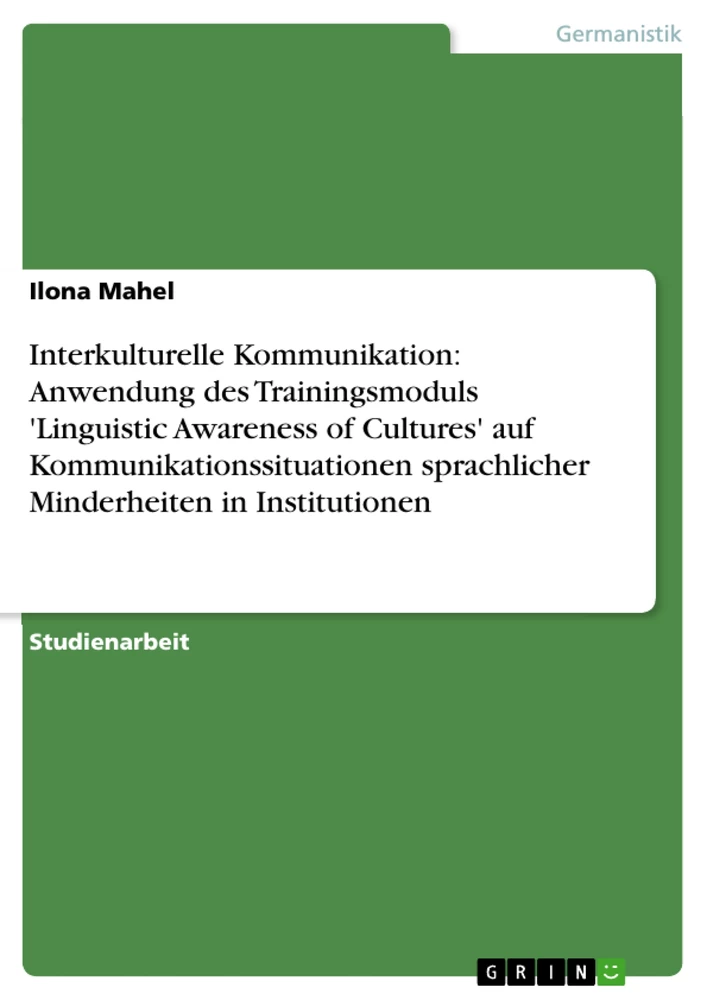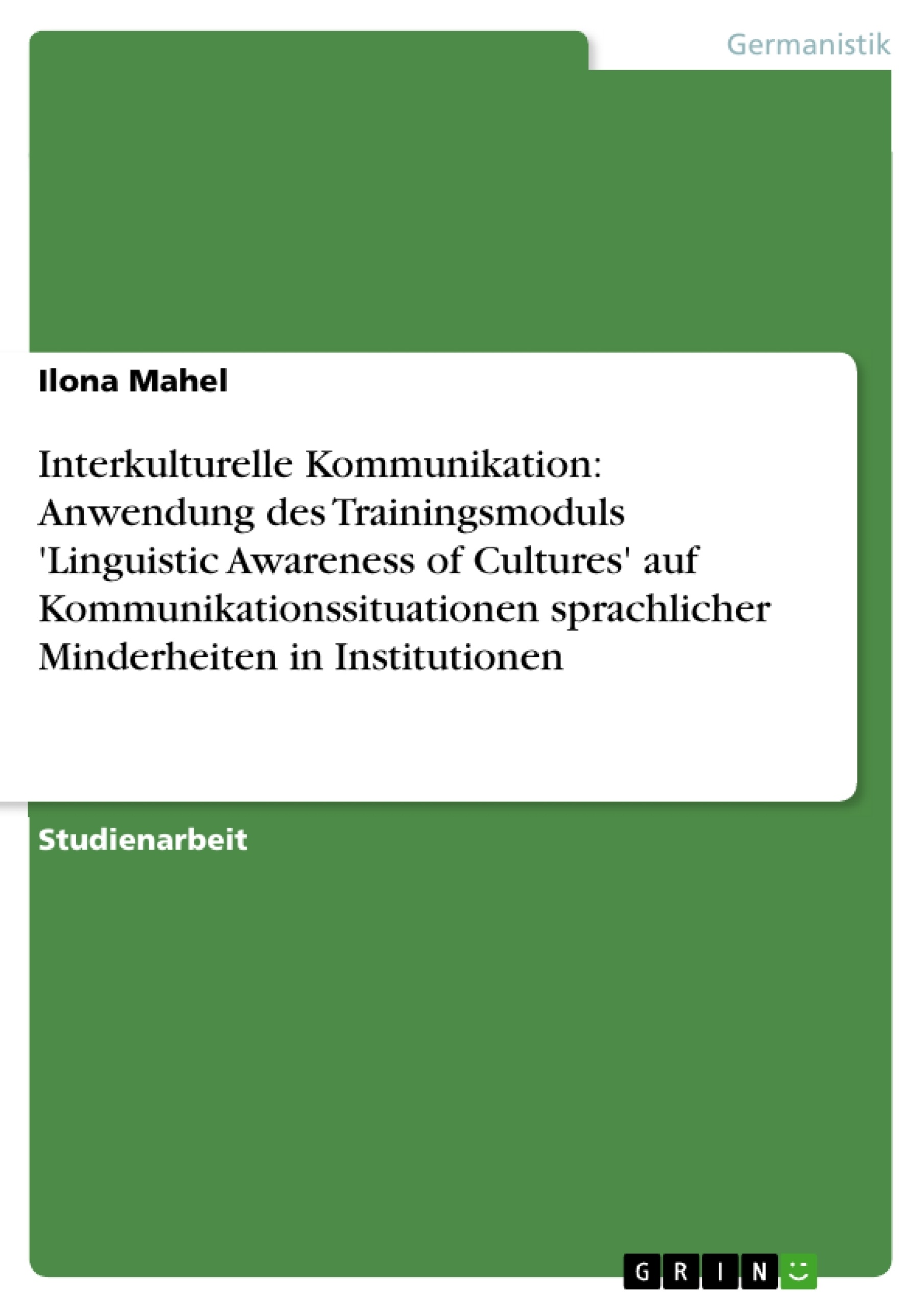Interkulturelle Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil unserer Welt geworden. Es ist schon lange nicht mehr nur die Tourismusbranche, die Einwohner verschiedener Länder miteinander in Kontakt bringt. Vielmehr spielt auch die zunehmende Globalisierung und die damit einhergehenden Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen verschiedener Länder eine Rolle. Und nicht zuletzt sorgt die Zahl der Migranten dafür, dass es im Alltag immer wieder zu interkulturellen Kommunikationssituationen kommt.
Aus diesem Grund ist es wichtig, interkulturelle Kompetenz zu entwickeln, d.h. zu lernen, welche Besonderheiten sich für die interkulturelle Kommunikation ergeben, welche Schwierigkeiten auftreten können und wie man mit diesen umgehen kann.
Einen Ansatz, diese Kompetenz zu entwickeln, bildet das Trainingsmodul „Linguistic Awareness of Cultures“ (LAC) von Bernd Müller-Jacquier, das im folgenden ersten Teil dieser Arbeit vorgestellt und mit anderen Trainingsansätzen verglichen werden soll. Den zweiten Teil bildet die Anwendung des LAC-Modells auf konkrete Kommunikationssituationen sprachlicher Minderheiten in deutschen Behörden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Interkulturelle Kommunikation
- Das Trainingsmodul „Linguistic Awareness of Cultures“ (LAC)
- Kriterienraster zur Analyse von Kommunikationsabläufen
- Das LAC-Trainingsmodul in der Praxis
- Das LAC-Modul und andere Ansätze
- Critical Incidents
- Culture Assimilator
- Das LAC-Modul im Vergleich mit der Critical Incident Technique und dem Culture Assimilator
- Das LAC-Modell in der Anwendung: Behördenkommunikationen
- Hinnenkamp (1985): Interaktion in Behörden
- Rost-Roth (1994): Interkulturelle Kommunikation in Beratungen
- Rehbein (1994): Interkulturelle Arzt-Patient-Kommunikation
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von interkultureller Kommunikation und der Anwendung des Trainingsmoduls „Linguistic Awareness of Cultures“ (LAC). Der Schwerpunkt liegt auf der Erforschung von Kommunikationsabläufen sprachlicher Minderheiten in deutschen Behörden.
- Die Bedeutung interkultureller Kompetenz in verschiedenen Kommunikationssituationen
- Die Besonderheiten des LAC-Modells und seine Anwendung in der Praxis
- Der Vergleich des LAC-Modells mit anderen Ansätzen zur Interkulturellen Kompetenzvermittlung
- Die Analyse von Kommunikationssituationen in Behörden unter Berücksichtigung des LAC-Modells
- Die Herausforderungen und Chancen interkultureller Kommunikation in Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung interkultureller Kommunikation in einer globalisierten Welt und stellt das Trainingsmodul „Linguistic Awareness of Cultures“ (LAC) von Bernd Müller-Jacquier vor. Kapitel 2 vertieft das LAC-Modell und seine Besonderheiten. Es werden zehn Vergleichskriterien zur Analyse von Kommunikationsabläufen vorgestellt, die dazu dienen, interkulturelle Kompetenz zu erwerben. Kapitel 3 befasst sich mit der Anwendung des LAC-Modells auf konkrete Kommunikationssituationen in Behörden. Es werden verschiedene Fallbeispiele aus unterschiedlichen Kontexten wie Arzt-Patient-Kommunikation oder Interaktion in Behörden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Linguistic Awareness of Cultures (LAC), Trainingsmodul, Kommunikationsanalyse, Behördenkommunikation, sprachliche Minderheiten, Kulturvergleich, Critical Incidents, Culture Assimilator, Interkulturelle Kompetenz, Kontextzeichen, Sprachhandlung, Sprechhandlungssequenzen, Gesprächsorganisation, Diskursablauf, Themenwahl, Direktheit, Indirektheit.
- Citar trabajo
- Ilona Mahel (Autor), 2005, Interkulturelle Kommunikation: Anwendung des Trainingsmoduls 'Linguistic Awareness of Cultures' auf Kommunikationssituationen sprachlicher Minderheiten in Institutionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65192