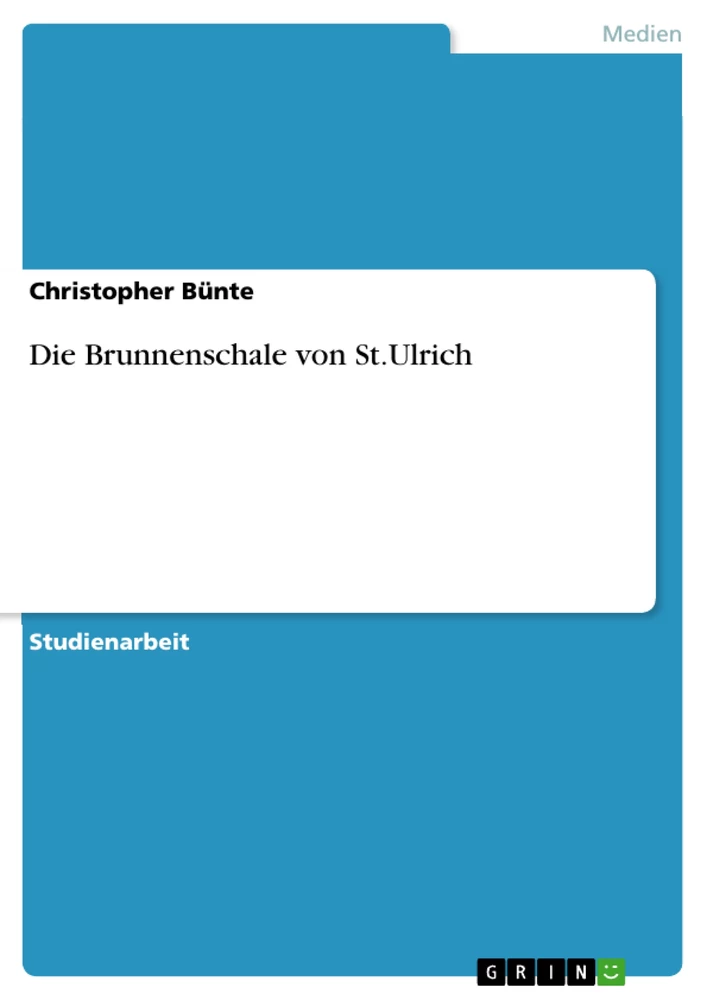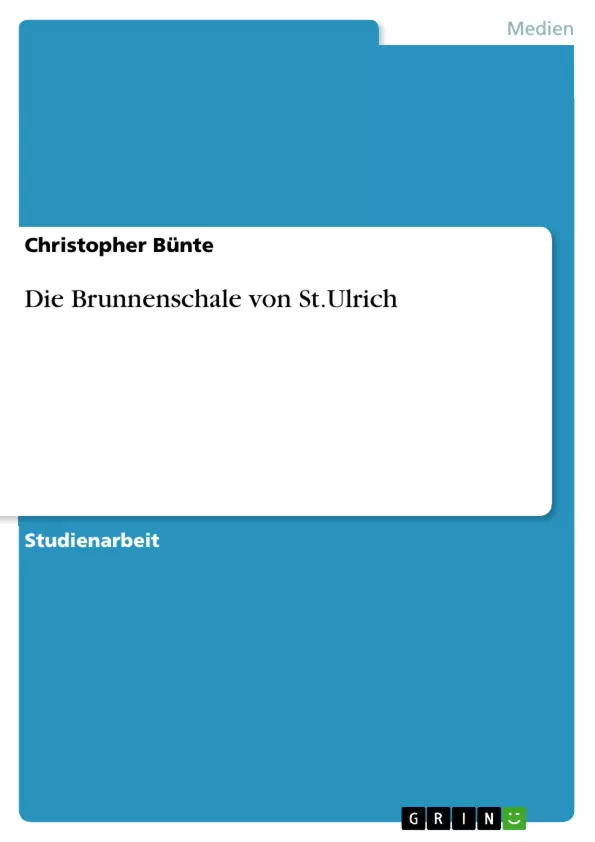Die Bearbeitung des Beckens von St. Ulrich beginnt 1873 mit dem ersten Jahrgang der heimatgeschichtlichen ReiheSchau-ins-Land.Darin veröffentlicht ein nicht näher genannter Autor („H. H.“) einen dreiseitigen Text über den „Springbrunnen zu St. Ulrich“. Obwohl sich der Text an ein interessiertes Laienpublikum wendet, beschäftigen den Autoren bereits spannende Fragen hinsichtlich Funktion, Herkunft und Aufstellungsort des Beckens. Die Antworten auf diese Fragen lässt der Autor offen.
Fast ein Vierteljahrhundert später führt Franz Xaver Kraus das Becken von St. Ulrich im zweiten Band seiner Geschichte der christlichen Kunst an. Das Werk erscheint 1897 und enthält einen Abschnitt über Taufsteine. Kraus versucht dort, eine Entwicklungslinie dieser sakralen Ausstattungsstücke zu entwickeln. Dabei unterstellt er (ohne seine Behauptung näher zu begründen), dass es sich bei dem Becken um einen Taufstein handele und das es eine „grosse Verwandtschaft mit demjenigen von Chiavenna“ habe.
Wenige Jahre später (1904) erscheint von Franz Xaver Kraus eine ausführliche Bearbeitung des Beckens in Die Kunstdenkmäler des Grossherzugtums Baden.Nach einer eingehenden Beschreibung deutet der Autor die Komposition der Figuren- und Tierfriese als Darstellung des Weltgerichts. Er hält das Becken anscheinend für kein sonderlich ungewöhnliches Kunstwerk, denn er verweist auf zahlreiche ähnliche Objekte in Italien, Frankreich und England. Zeitlich ordnet er das Becken dem 11. Jahrhundert zu. Kraus nimmt weiter an, dass das Becken nicht aus der Region stammt, sondern von anderswo in den Breisgau transportiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- A. Dokumentation
- I. Literaturbericht
- II. Beschreibung
- III. Text- und Bildquellen
- IV. Aufstellungsort
- V. Datierung
- VI. Funktion
- B. Typen-, Motiv-, Funktions- und Stilgeschichte sowie ikonographische Fragen
- I. Typen- und Motivgeschichte
- II. Funktionsgeschichte
- III. Stilgeschichte
- IV. Ikonographie
- C. Ideengeschichte
- I. Auftraggeber
- II. Landschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Becken von St. Ulrich im Schwarzwald, seine Geschichte, Funktion und künstlerische Bedeutung. Sie analysiert die bisherige Forschung und bewertet die unterschiedlichen Interpretationen des Objekts. Die Arbeit strebt danach, ein umfassenderes Verständnis des Beckens zu schaffen und offene Fragen zu klären.
- Die Entwicklung der Forschung zum Becken von St. Ulrich
- Die verschiedenen Theorien über die Funktion des Beckens (Taufbecken, Brunnen)
- Die stilistische Einordnung und Datierung des Beckens
- Die ikonographische Interpretation der Reliefs
- Der regionale Kontext und die Herkunft des Beckens
Zusammenfassung der Kapitel
A. Dokumentation: Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Übersicht der bisherigen Forschung zum Becken von St. Ulrich, beginnend mit dem ersten Eintrag im "Schau-ins-Land" von 1873 bis hin zu Marie-Therese Hurnis Lizentiatsarbeit von 1981. Die verschiedenen Autoren und ihre Interpretationen bezüglich Funktion (Taufstein vs. Brunnen), Datierung und Herkunft des Beckens werden detailliert dargestellt, wobei ihre jeweiligen Methoden und Schlussfolgerungen kritisch beleuchtet werden. Der Abschnitt verdeutlicht die Entwicklung der Forschung und die unterschiedlichen Perspektiven auf das Objekt. Die Widersprüche und Unsicherheiten in der Forschung werden deutlich herausgestellt und bilden die Grundlage für weitere Analysen.
B. Typen-, Motiv-, Funktions- und Stilgeschichte sowie ikonographische Fragen: Dieser Teil der Arbeit wird sich eingehend mit der Typologie des Beckens auseinandersetzen, indem er es mit vergleichbaren Objekten in Bezug auf Form, Motive und Stil vergleicht. Die ikonographische Analyse der Reliefs soll Aufschluss über ihre Bedeutung und Symbolik geben. Die Funktionsgeschichte wird die unterschiedlichen Thesen über die Verwendung des Beckens als Taufstein oder Brunnen untersuchen. Die Stilgeschichte wird das Becken in den Kontext der romanischen Skulptur einordnen und seine Datierung präzisieren.
C. Ideengeschichte: Dieser Kapitelteil untersucht den Kontext der Entstehung und Verwendung des Beckens. Die Analyse des Auftraggebers und des regionalen Kontextes soll Aufschluss über die Bedeutung des Beckens im religiösen und gesellschaftlichen Leben der damaligen Zeit geben. Die landschaftlichen Aspekte und ihre Beziehung zum Becken werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Becken von St. Ulrich, Mittelalterliche Bauskulptur, Schwarzwald, Romanische Skulptur, Taufbecken, Brunnen, Ikonographie, Stilgeschichte, Funktionsgeschichte, Forschungsgeschichte, Oberrhein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Das Becken von St. Ulrich im Schwarzwald"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Becken von St. Ulrich im Schwarzwald, seine Geschichte, Funktion und künstlerische Bedeutung. Sie analysiert die bisherige Forschung und bewertet unterschiedliche Interpretationen des Objekts, um ein umfassenderes Verständnis zu schaffen und offene Fragen zu klären.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Dokumentation des Beckens (Literaturbericht, Beschreibung, Quellen, Aufstellungsort, Datierung, Funktion), die Typen-, Motiv-, Funktions- und Stilgeschichte sowie ikonographische Fragen, und die Ideengeschichte (Auftraggeber, Landschaft). Sie analysiert die Entwicklung der Forschung, verschiedene Theorien zur Funktion (Taufbecken oder Brunnen), die stilistische Einordnung und Datierung, die ikonographische Interpretation der Reliefs und den regionalen Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: A. Dokumentation, B. Typen-, Motiv-, Funktions- und Stilgeschichte sowie ikonographische Fragen, und C. Ideengeschichte. Jeder Teil beinhaltet mehrere Unterkapitel, die die verschiedenen Aspekte des Beckens detailliert untersuchen.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Fragen zur Entwicklung der Forschung zum Becken, zu verschiedenen Theorien über seine Funktion, zur stilistischen Einordnung und Datierung, zur ikonographischen Interpretation der Reliefs und zum regionalen Kontext und zur Herkunft des Beckens.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Quellen, beginnend mit dem ersten Eintrag im "Schau-ins-Land" von 1873 bis hin zu Marie-Therese Hurnis Lizentiatsarbeit von 1981. Die Arbeit analysiert und bewertet die unterschiedlichen Interpretationen und Methoden der verschiedenen Autoren kritisch.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis des Beckens von St. Ulrich zu schaffen, indem sie die bisherigen Forschungsansätze kritisch beleuchtet und offene Fragen diskutiert. Die genauen Schlussfolgerungen werden im Detail in den einzelnen Kapiteln der Arbeit präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Becken von St. Ulrich, Mittelalterliche Bauskulptur, Schwarzwald, Romanische Skulptur, Taufbecken, Brunnen, Ikonographie, Stilgeschichte, Funktionsgeschichte, Forschungsgeschichte, Oberrhein.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für mittelalterliche Bauskulptur, die Geschichte des Schwarzwalds und die Kunstgeschichte des Oberrheins interessieren.
Wo kann ich die vollständige Arbeit finden?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Zugriffspunkt einfügen, z.B. "bei der Universität X einsehbar" oder "in der Bibliothek Y verfügbar"].
- Quote paper
- Christopher Bünte (Author), 2006, Die Brunnenschale von St.Ulrich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65299