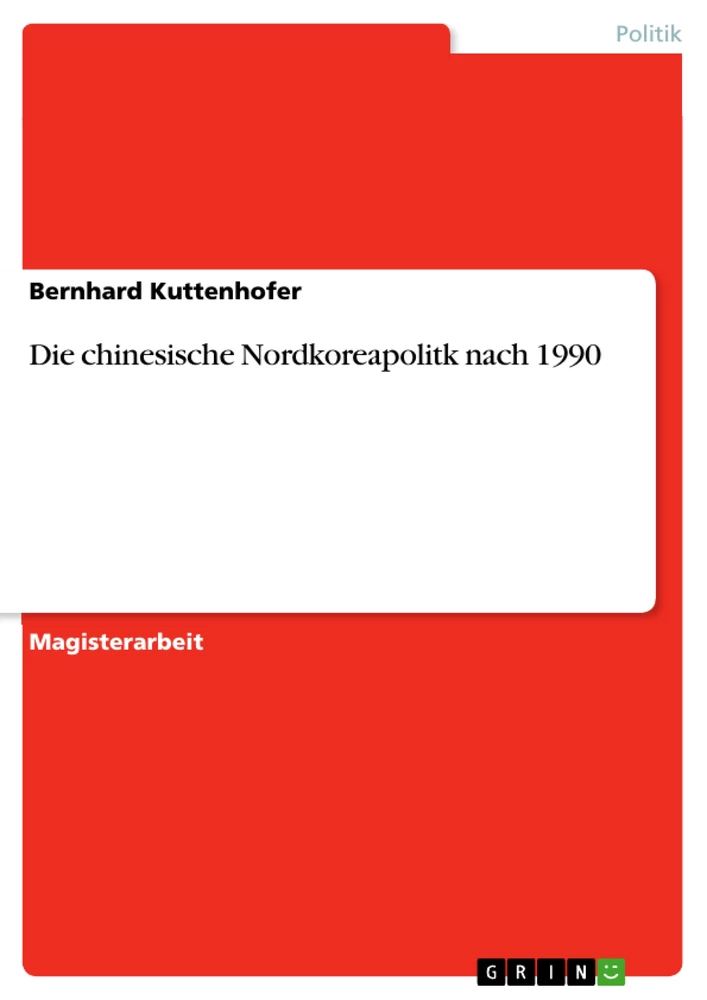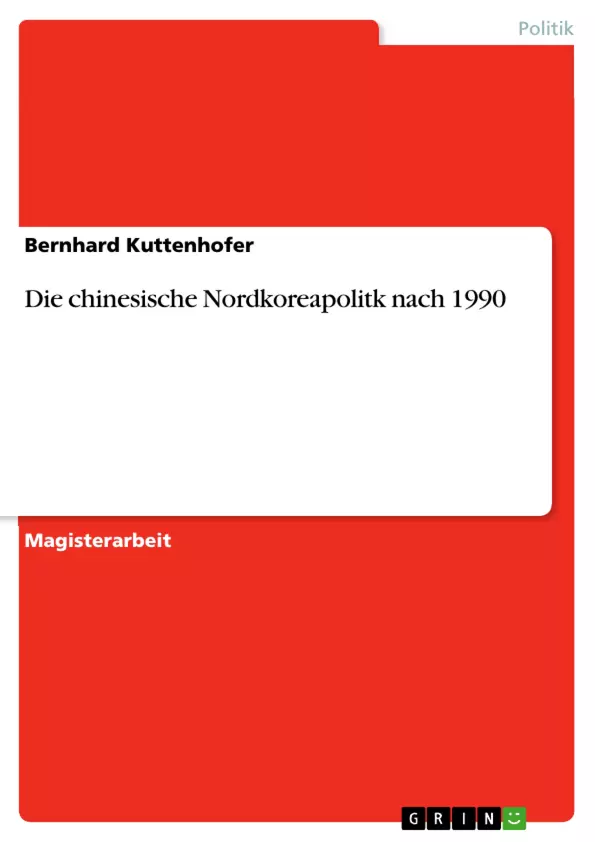„Wenn China erwacht, wird die Erde beben.“ Dieses Napoleon zugeordnete Zitat wird bei Abhandlungen zum heutigen China nach wie vor gerne genannt. Stets als Hinweis auf das mögliche hohe Potenzial an wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und militärischer Kraft gedacht, ordnet es China den Status als „kommende“ Macht zu. Schon das Alter dieses Ausspruchs, der nach wie vor passend zu sein scheint - etwa 200 Jahre - zeigt, wie lange - wenn auch nicht ohne Unterbrechung - China schon als aufsteigende Macht gesehen wird. Die Erwartungen gegenüber dem China der Zukunft reichten und reichen vom „regionalen Hegemon“ bis hin zu einer möglicherweise absoluten Weltmacht. Selbst die Weltbank wurde im Jahr 1997 - etwas voreilig - dazu verleitet, die Ablösung der USA als größte Wirtschaftsmacht für das Jahr 2020 vorherzusagen. Darüber hinaus glauben nicht wenige Menschen, dass China den Vereinigten Staaten von Amerika, die ihrerseits die Weltmacht des 20. Jahrhunderts gewesen seien, und den Europäern, die die Welt des 19 Jahrhunderts beherrscht hätten, im 21. Jahrhundert nachfolgen könnten, und somit ein „chinesisches Jahrhundert“ anbrechen würde. Eine aktuelle Bestandsaufnahme zeigt: so weit ist es noch nicht2. Handelt es sich bei der Volksrepublik China zwar zweifelsohne um eine der wichtigsten Mächte Ostasiens - von der Rolle des regionalen Hegemons ist man noch weit entfernt. Unbestreitbar ist dennoch die wachsende Bedeutung chinesischer Außenpolitik und chinesischer Interessen für die Region Ostasien. Das aktuelle Beispiel dazu ist der Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm. Dieser hat bis dato zu zwei großen Krisen geführt: 1993 nach der Verkündung Nordkoreas aus dem Atomwaffensperrvertrag auszutreten und 2002, als der US-Staatssekretär Kelly Nordkorea vorwirft, weiter geheim an einem Plutoniumprogramm zu arbeiten. Eine der jüngsten Entwicklungen im Februar 2005 durch das offene Bekenntnis Nordkoreas, nun im Besitz funktionstüchtiger Atomwaffen zu sein, hat ein weiteres Kapitel der zweiten Krise aufgeschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- Anmerkungen
- A. Problemstellung
- a) Fragestellung
- b) Theoretischer Ansatz
- B. Hypothesenüberprüfung
- 1. Die Distanzierungsphase (1990-1993)
- 1.1 Nordkoreapolitik direkt: Kürzung der Wirtschaftshilfe
- a) Der teure Nachbar: Nordkorea als wirtschaftliche Bürde
- b),,Juche“ über alles: Frustration Chinas über die Wirtschaftspolitik Nordkoreas
- 1.2. Nordkoreapolitik indirekt: China will Südkorea gewinnen und Nordkorea isolieren
- a) Attraktiverer Partner: Südkoreas Wirtschaft
- b) Möglicher machtpolitischer Meilenstein: Koreas Wiedervereinigung
- c) Korea als Machtfaktor im Ringen mit Japan, Russland und den USA
- d) China will der Vermittler sein: Die bewusste Isolierung Nordkoreas
- 2. Die Kooperationsphase (ab 1993)
- 2.1 Nordkoreas Atomrüstung als machtpolitische Bedrohung
- a) Der amerikanische Raketenabwehrschirm
- b) Die Bombe für alle - Nordkorea als potenzieller Proliferateur
- 2.2 Instabilität und ein nordkoreanischer Kollaps als Bedrohung
- a) Furcht um die Stabilität der Region
- b) Furcht vor dem nordkoreanischen Kollaps
- C. Ergebnisse
- a) Systemische Effekte – die Umverteilung der Capabilities
- b) Die Veränderung in der Struktur des Systems
- c) Begründung für die Zäsuren in der chinesischen Nordkoreapolitik
- D. Anhang
- Die Analyse der chinesischen Nordkoreapolitik im Kontext der regionalen Machtverschiebungen
- Die Untersuchung der wirtschaftlichen und strategischen Interessen Chinas in Bezug auf Nordkorea
- Die Bewertung der Bedeutung Nordkoreas für die chinesische Sicherheitspolitik
- Die Rolle Chinas als Vermittler zwischen Nordkorea und der internationalen Gemeinschaft
- Die Auswirkungen der Nordkoreanischen Atomwaffenentwicklung auf die chinesische Nordkoreapolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Nordkoreapolitik der Volksrepublik China seit 1990 und analysiert die Veränderungen in dieser Politik im Kontext der sich wandelnden Machtverhältnisse und Interessenlagen in Ostasien.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Distanzierungsphase der chinesischen Nordkoreapolitik zwischen 1990 und 1993. Es werden die Gründe für die Reduzierung der Wirtschaftshilfe an Nordkorea analysiert, unter anderem die steigenden Kosten der Wirtschaftshilfe und die Unzufriedenheit Chinas mit der wirtschaftlichen Entwicklung Nordkoreas. Außerdem wird die wachsende Bedeutung Südkoreas als wirtschaftlicher und politischer Partner für China im Vergleich zu Nordkorea untersucht.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Kooperationsphase der chinesischen Nordkoreapolitik ab 1993. Hier werden die Gefahren der Nordkoreanischen Atomrüstung für die regionale Sicherheit, die Furcht vor einer Destabilisierung des Wirtschaftsraumes und der Möglichkeit eines nordkoreanischen Kollapses analysiert.
Schlüsselwörter
Nordkoreapolitik, Volksrepublik China, Ostasien, Machtpolitik, Wirtschaftshilfe, Atomwaffen, regionale Sicherheit, Stabilität, Korea, Wiedervereinigung, Systemische Effekte, Capabilities.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich Chinas Nordkoreapolitik seit 1990 verändert?
Die Politik wandelte sich von einer Distanzierungsphase (1990-1993), in der China Wirtschaftshilfen kürzte und sich Südkorea zuwandte, hin zu einer Kooperationsphase ab 1993, getrieben durch Sicherheitsbedenken wegen des Atomprogramms.
Warum kürzte China Anfang der 90er Jahre die Hilfe für Nordkorea?
Nordkorea wurde zunehmend als wirtschaftliche Bürde empfunden. Zudem war China frustriert über die mangelnde Reformbereitschaft der nordkoreanischen Wirtschaftspolitik („Juche“).
Welche Rolle spielt das nordkoreanische Atomprogramm für China?
China sieht die Atomrüstung als Bedrohung für die regionale Stabilität. Es befürchtet eine atomare Proliferation in der Region und eine verstärkte US-Militärpräsenz (z. B. Raketenabwehrschirm).
Warum fürchtet China einen Kollaps Nordkoreas?
Ein Kollaps würde zu massiven Flüchtlingsströmen an die chinesische Grenze führen und könnte eine Wiedervereinigung Koreas unter US-Einfluss bedeuten, was Chinas strategische Interessen gefährdet.
Wie agiert China als Vermittler im Korea-Konflikt?
China nutzt seine einzigartige Position als letzter großer Verbündeter Nordkoreas, um zwischen Pjöngjang und der internationalen Gemeinschaft (insbesondere den USA) zu vermitteln und Eskalationen zu verhindern.
- Quote paper
- Bernhard Kuttenhofer (Author), 2005, Die chinesische Nordkoreapolitk nach 1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65354