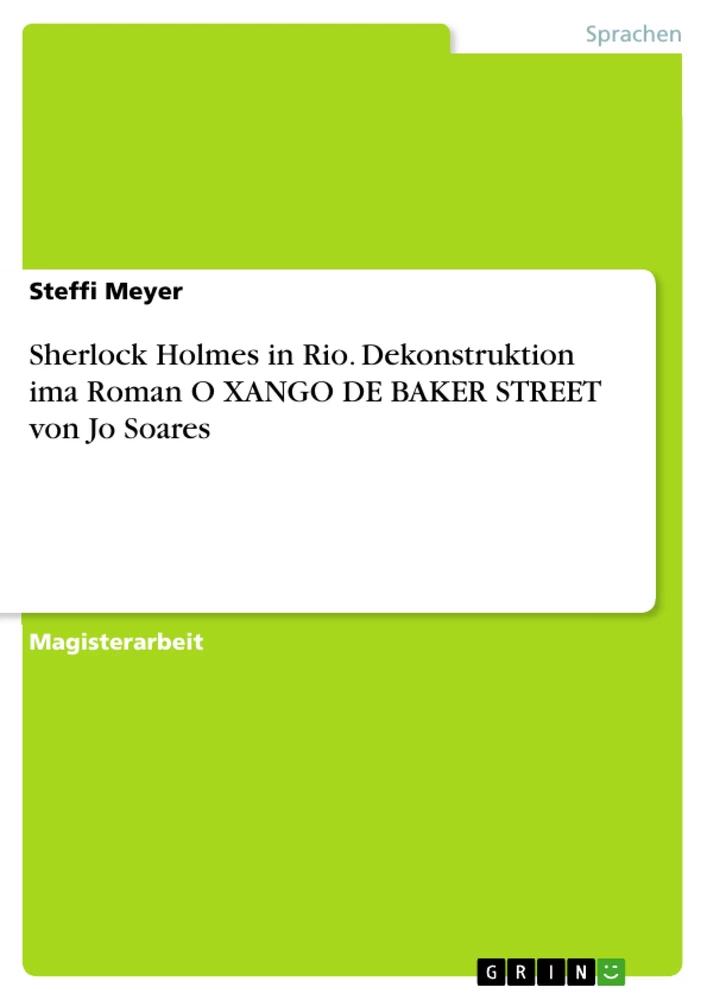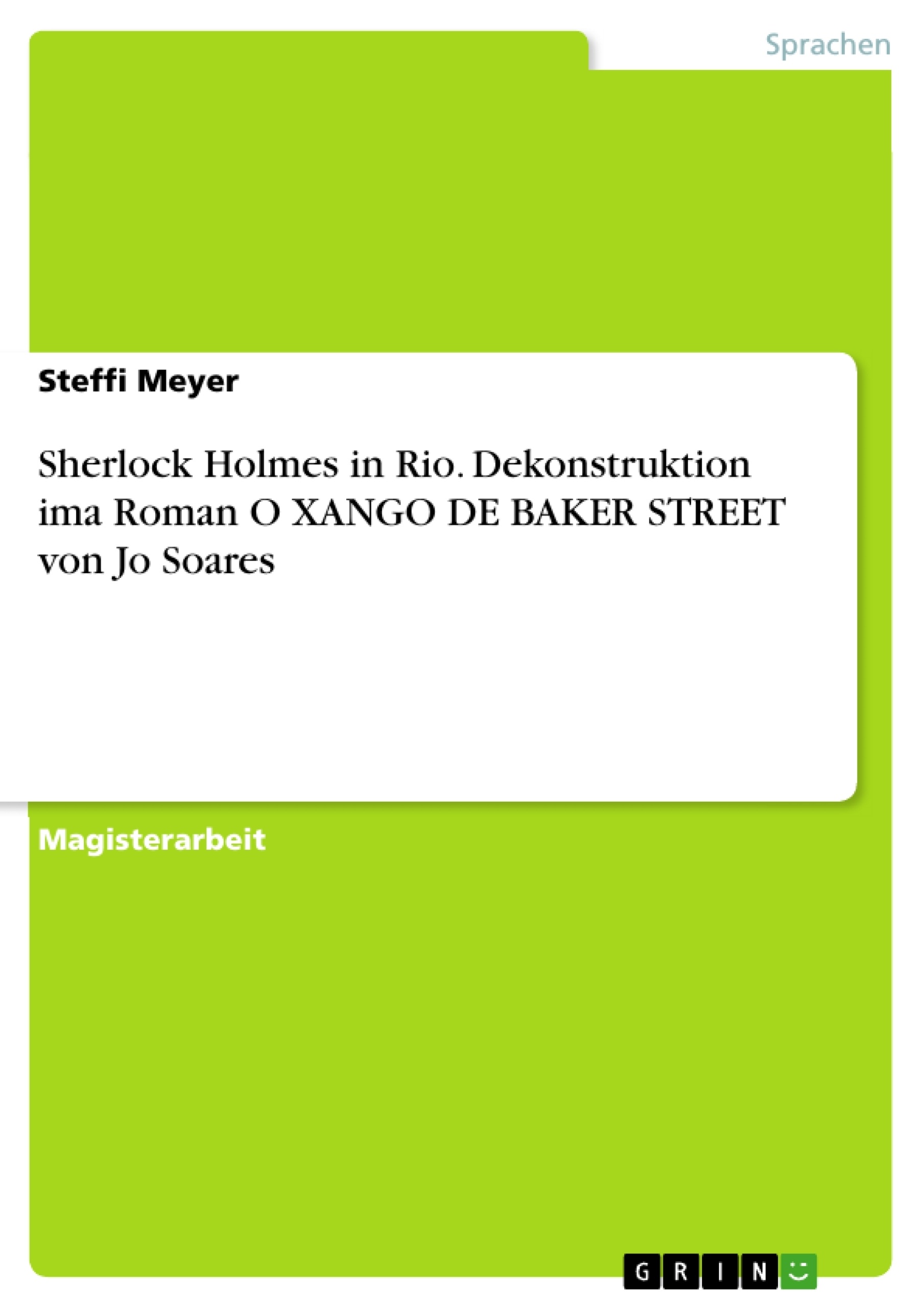Seit nunmehr beinahe 120 Jahren begeistern die Abenteuer von Sherlock Holmes Liebhaber von Detektivgeschichten auf der ganzen Welt. Kaum jemand kennt ihn nicht, den Engländer im karierten Cape, mit der Pfeife im Mund und der großen Lupe in der Hand, der 1887 inA Study in Scarletzum ersten Mal ermittelte. Gemeinsam mit seinem Assistenten und Vertrauten Dr. Watson hat er unzählige Fälle bearbeitet und dank der ihm eigenen Ermittlungsweise -the Science of Deduction and Analysis(Doyle 2001: 15) - so manchen Missetäter zur Strecke gebracht. Selbst ein von seinem Schöpfer Sir Arthur Conan Doyle (1859 -1930) inszenierter Tod des Detektivhelden in The Adventure of the Final Problem(1893) konnte dem Verlangen seiner Anhänger nach neuen Abenteuern keinen Abriss tun, stattdessen musste er den Helden 1901 in The Hounds of Baskerville wieder auferstehen lassen und zur Aufklärung weiterer Fälle verpflichten. Die Figur des Sherlock Holmes erfreute sich derartig großer Beliebtheit, dass bei so manchem Leser die Grenze zwischen Realität und Fiktion verwischte und er z. T. sogar als realer englischer Detektiv gehandelt wurde. Insgesamt veröffentlichte Doyle 56 Kurzgeschichten und vier Romane, in denen er seinen Helden samt seinem Assistenten aus der Baker Street 221B mit unterschiedlichsten Fällen betraut. Auf die Gesamtheit dieser Geschichten und Romane Doyles’ über Sherlock Holmes wird sich häufig als Kanon bezogen, in diesem Sinne möchte ich diesen Begriff in meiner Arbeit weiter verwenden.
Soares hat im Jahr 1995 mitO Xangô de Baker Street (XBS)eine gelungene Parodie des Holmes-Stoffes vorgelegt. Der Roman wurde in insgesamt neun Sprachen übersetzt und zum internationalen Bestseller. In Anknüpfung an den Erfolg des Buches entstand unter der Regie von Miguel Faria Jr. eine Verfilmung des Stoffes, die 2001 das (Film)Festivaldo Rioeröffnete. Der Erfolg der Geschichten und Romane rund um Sherlock Holmes und Dr. Watson beschränkt sich wie gesagt nicht nur auf den angelsächsischen Sprachraum, sondern Übersetzungen in zahlreiche andere Sprachen machen sie auch einem breiten internationalen Publikum zugänglich. In neuerer Zeit sorgen zusätzlich Medien wie Film und Hörbuch für die weitere Verbreitung des Stoffes auch unter neuen Generationen. Nun darf man jedoch nicht fälschlicherweise davon ausgehen, dass es sich bei den Reproduktionen lediglich um Neuauflagen und Übersetzungen handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Sherlock Holmes in Rio
- I Theoretischer Arbeitsrahmen
- I.1 Über und zwischen Texten
- I.2 Dekonstruktion und Re-Lektüre
- I.2.1 Versuche über den Begriff der Parodie
- I.2.2 Zitierte Texte
- II Formalien des Romans
- II.1 Struktur
- II.2 Transtextuelle Bezüge
- II.2.1 Architextualität - die Schwierigkeit der Gattungszuordnung
- II.2.2 Metatextualität - kritische Auseinandersetzung als Parodie
- II.2.3 Paratextualität - Einwirkungen auf den Erwartungshorizont
- II.2.4 Hypertextualität - die Frage nach dem Bezugspunkt
- II.2.5 Intertextualität - Polyphonie der Stimmen
- II.2.5.1 Intertextuelle Schnittstellen mit dem Kanon
- II.2.5.2 Intertextuelle Schnittstellen außerhalb des Kanons
- III Dekonstruktion in O Xangô de Baker Street
- III.1 Europa in Amerika
- III.2 Wi(e)derlesen von Geschichte
- III.3 Dekonstruktion des Helden Sherlock Holmes
- III.3.1 O Xangô de Baker Street
- III.3.2 Holmes & Dr. Watson vs. Mello Pimenta & Dr. Saraiva
- III.3.3 Holmes in Love
- IV Resümé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Dekonstruktion des Sherlock-Holmes-Stoffes im Roman O Xangô de Baker Street von Jô Soares. Im Mittelpunkt stehen die intertextuellen Bezüge, die der Autor in seinem Werk herstellt, und deren Einfluss auf die Rezeption der Figur Sherlock Holmes in einem neuen Kontext. Es soll analysiert werden, wie Soares den klassischen Detektivhelden auf parodistische Weise dekonstruiert und neu definiert, indem er ihn in das Rio de Janeiro des 19. Jahrhunderts versetzt und ihm neue Abenteuer und Herausforderungen präsentiert.
- Intertextualität und Dekonstruktion in der Literatur
- Parodie als Mittel der literarischen Kritik
- Die Rezeption des Sherlock-Holmes-Kanons im 20. Jahrhundert
- Die Figur Sherlock Holmes als kulturelles Symbol und ihr Einfluss
- Postkoloniale Perspektiven auf den Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman O Xangô de Baker Street von Jô Soares vor und erläutert die Bedeutung des Sherlock-Holmes-Stoffes in der Literatur. Sie beleuchtet die Rezeption der Figur in verschiedenen Kulturen und Medien und führt in das Konzept der Dekonstruktion und Parodie ein.
Kapitel I definiert den theoretischen Arbeitsrahmen der Arbeit, indem es die Konzepte der Intertextualität, Dekonstruktion und Parodie erklärt. Es wird auf die Bedeutung des Bezugs auf andere Texte und auf die Umdeutung klassischer Figuren im Kontext der Postmoderne eingegangen.
Kapitel II analysiert die Formalien des Romans O Xangô de Baker Street und untersucht die verschiedenen Ebenen der Transtextualität, die in ihm zum Ausdruck kommen. Es werden die gattungsspezifischen Elemente, die intertextuellen Bezüge und die paratextuellen Elemente des Romans beleuchtet.
Kapitel III befasst sich mit der Dekonstruktion des Helden Sherlock Holmes im Roman. Es wird untersucht, wie die Figur im Kontext des brasilianischen Rio de Janeiro des 19. Jahrhunderts neu interpretiert wird und welche Veränderungen und Paradoxien sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Intertextualität, Dekonstruktion, Parodie, Sherlock Holmes, Jô Soares, O Xangô de Baker Street, Rio de Janeiro, Brasilien, Postkolonialismus.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Roman „O Xangô de Baker Street“?
Es ist eine Parodie von Jô Soares, die Sherlock Holmes in das Rio de Janeiro des 19. Jahrhunderts versetzt, wo er mit brasilianischen Sitten und einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert wird.
Wie wird die Figur des Sherlock Holmes dekonstruiert?
Soares bricht mit dem klassischen Kanon, indem er Holmes' Unfehlbarkeit in Frage stellt und ihn in komische, menschliche und kulturell fremde Situationen bringt.
Welche Rolle spielt die Intertextualität in diesem Werk?
Der Roman nutzt zahlreiche Bezüge zum Originalkanon von Arthur Conan Doyle sowie zu brasilianischer Geschichte und Kultur, um eine polyphone Erzählweise zu schaffen.
Was ist mit „Postkolonialismus“ im Kontext des Romans gemeint?
Die Arbeit analysiert das Aufeinandertreffen des „europäischen Genies“ mit der Realität Südamerikas und wie tradierte Machtverhältnisse literarisch unterwandert werden.
Wer sind Mello Pimenta und Dr. Saraiva?
Sie fungieren im Roman als brasilianische Gegenstücke oder Begleiter zu Holmes und Watson und verdeutlichen den Kontrast zwischen den Kulturen.
Ist der Roman eine reine Detektivgeschichte?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass es sich primär um eine literarische Parodie und Metatext handelt, die die Gattung des Kriminalromans selbst kritisch reflektiert.
- Arbeit zitieren
- Steffi Meyer (Autor:in), 2006, Sherlock Holmes in Rio. Dekonstruktion ima Roman O XANGO DE BAKER STREET von Jo Soares, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65378