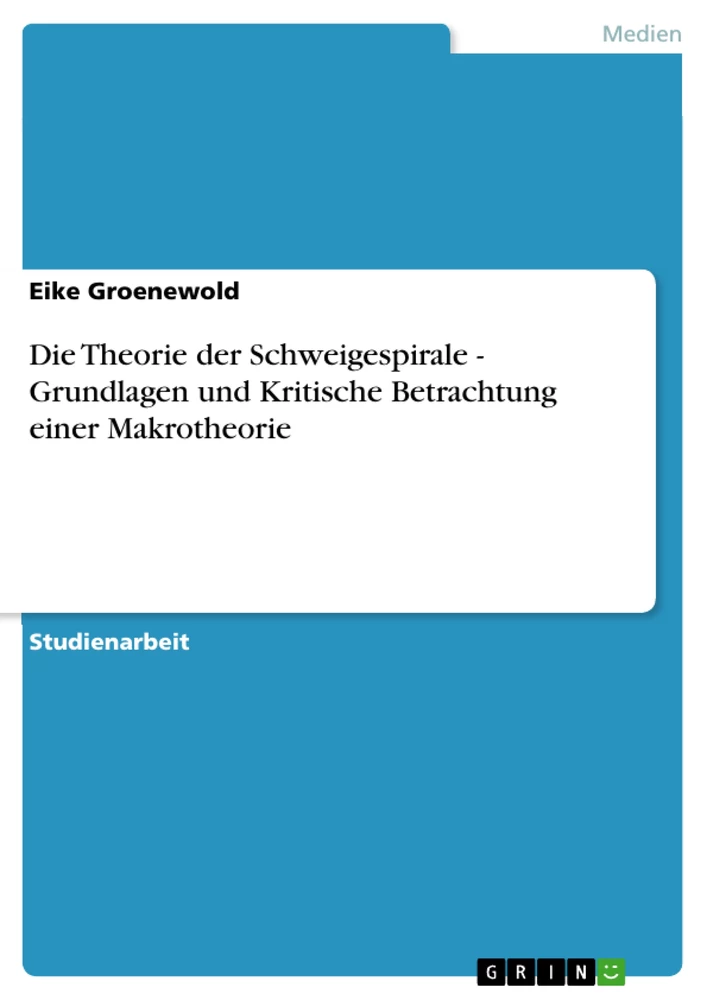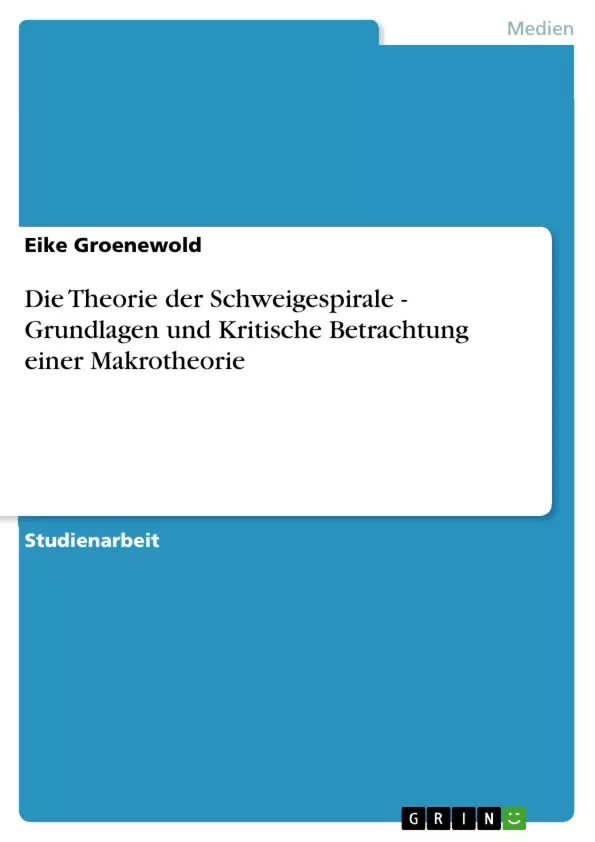Die Theorie der Schweigespirale hat Ihren empirischen Ursprung in den anfangs nicht erklärlichen Umfrageergebnissen im Vorfeld der Bundestagswahl des Jahres 1965. Hier handelt es sich um ein Konzept von öffentlicher Meinung, dass man am besten als Makrotheorie bezeichnen kann. Die breite Fächerung des Themas in verschiedene Bereiche der Wissenschaft bringt eine große Fülle an Literatur mit sich, die gleichzeitig Chance und Problematik bei der Auswahl von Lektüre bedeutet. Eine weitere Schwierigkeit stellt die Tatsache dar, dass die Theorie sich innerhalb der letzten 20 Jahre ständig weiterentwickelt hat und somit ein Überblick über die Thematik erschwert wird. Was jedoch bei der Literaturrecherche am schnellsten ins Auge fällt ist der große Anteil von kritischer Literatur zum Thema. Deshalb soll es Ziel der folgenden Arbeit sein, zu Beginn die Grundzüge der Theorie darzustellen, um sie danach kritisch beleuchten zu können. Die Grundzüge der Theorie beinhaltet methodische, wie inhaltliche Aspekte; und ebenso wird auch in der Kritik zwischen Methodik und Inhalt unterschieden werden. Um den Rahmen des Textes in Grenzen zu halten, wird Elisabeth Noelle-Neumanns geschichtsphilosophische
Forschung nur am Rande erwähnt werden, obwohl sie einen relativ hohen Standpunkt im Bereich ihrer Forschung hat. Ebenfalls wird der Begriff der Öffentlichkeit und die Rolle der Massenmedien nur in Grundzügen erläutert werden. Obgleich bekannt ist, dass die Rezeption des Themas beispielweise in den USA anders als in Deutschland zu sehen ist, beschränkt sich der Inhalt, der in dieser Arbeit verwendeten Diskussion, auf nationale Literatur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie der Schweigespirale
- Kernpunkte der Theorie
- Erläuterung des Spiralprozesses
- Belege für die Isolationsfurcht- Hypothese: Das Asch Experiment
- Methodik der Forschung
- Empirische Forschung: Der Eisenbahntest
- Öffentliche Meinung
- Kernpunkte der Theorie
- Kritische Standpunkte zur Theorie
- Inhaltliche und methodische Kritik
- Kritikpunkte nach Donsbach
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theorie der Schweigespirale, einem Konzept der öffentlichen Meinung, das als Makrotheorie bezeichnet werden kann. Sie analysiert die Grundlagen dieser Theorie und untersucht sie kritisch.
- Die Entstehung der Schweigespirale und ihre Kernaussagen
- Die Isolationsfurcht als treibende Kraft der Schweigespirale
- Die Rolle der Massenmedien in der öffentlichen Meinungsbildung
- Kritik an der Theorie der Schweigespirale hinsichtlich ihrer Methodik und Inhalte
- Die Bedeutung der Theorie der Schweigespirale für die Kommunikationswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Theorie der Schweigespirale ein und skizziert ihre Entstehung aus den Ergebnissen der Bundestagswahl 1965. Sie erläutert die Komplexität des Themas und die Herausforderungen bei der Literaturrecherche.
Kapitel 2 stellt die Kernpunkte der Schweigespirale dar, wie sie von Elisabeth Noelle-Neumann beschrieben wurde. Es erläutert den Spiralprozess, der sich aus der Isolationsfurcht entwickelt, und die Rolle der Meinungsführer.
Kapitel 2.1.2 beleuchtet die Isolationsfurcht im Kontext von psychologischen Hypothesen und verweist auf das Asch Experiment als Beleg.
Kapitel 2.2 beleuchtet die Methodik der Forschung und erläutert das Eisenbahntest als empirisches Beispiel.
Kapitel 2.3 widmet sich der öffentlichen Meinung als Grundlage der Theorie.
Kapitel 3 analysiert kritische Standpunkte zur Theorie der Schweigespirale, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Es beleuchtet Kritikpunkte nach Donsbach.
Schlüsselwörter
Öffentliche Meinung, Schweigespirale, Isolationsfurcht, Meinungsführer, Massenmedien, Kommunikationswissenschaft, Makrotheorie, Empirische Forschung, Kritik, Methodik, Inhalt, Asch Experiment, Eisenbahntest, Pluralistische Ignoranz, Bandwagon Effect, Political Correctness
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Theorie der Schweigespirale?
Menschen neigen dazu, ihre Meinung zu verschweigen, wenn sie glauben, dass diese nicht der Mehrheitsmeinung entspricht, aus Furcht vor sozialer Isolation.
Welche Rolle spielt die Isolationsfurcht?
Sie ist die treibende Kraft, die Individuen dazu bringt, die Umwelt ständig zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie nicht zur Außenseitergruppe gehören.
Was versteht man unter dem „Eisenbahntest“?
Es ist eine empirische Methode, bei der Probanden gefragt werden, ob sie in einem Abteil ein Gespräch mit einem Fremden über ein kontroverses Thema beginnen würden.
Welchen Einfluss haben Massenmedien auf die Schweigespirale?
Medien vermitteln ein Bild der vorherrschenden Meinung. Wenn sie einseitig berichten, können sie den Eindruck einer Mehrheit verstärken und die Spirale beschleunigen.
Wer entwickelte diese Theorie?
Die Theorie wurde von der Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann entwickelt, basierend auf Beobachtungen zur Bundestagswahl 1965.
- Quote paper
- Eike Groenewold (Author), 2006, Die Theorie der Schweigespirale - Grundlagen und Kritische Betrachtung einer Makrotheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65391