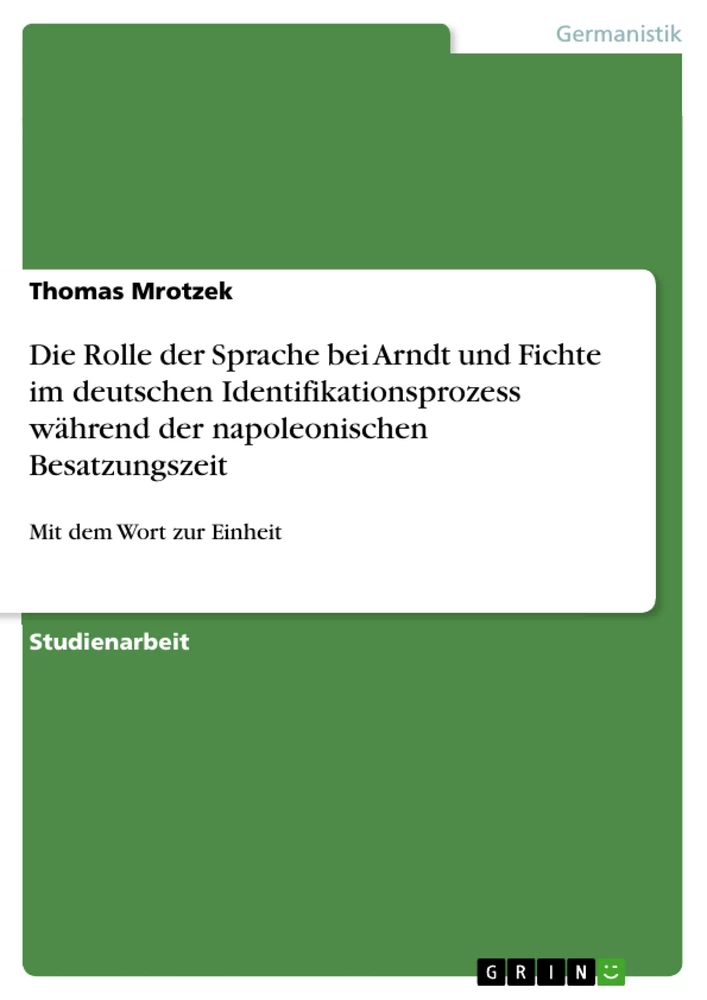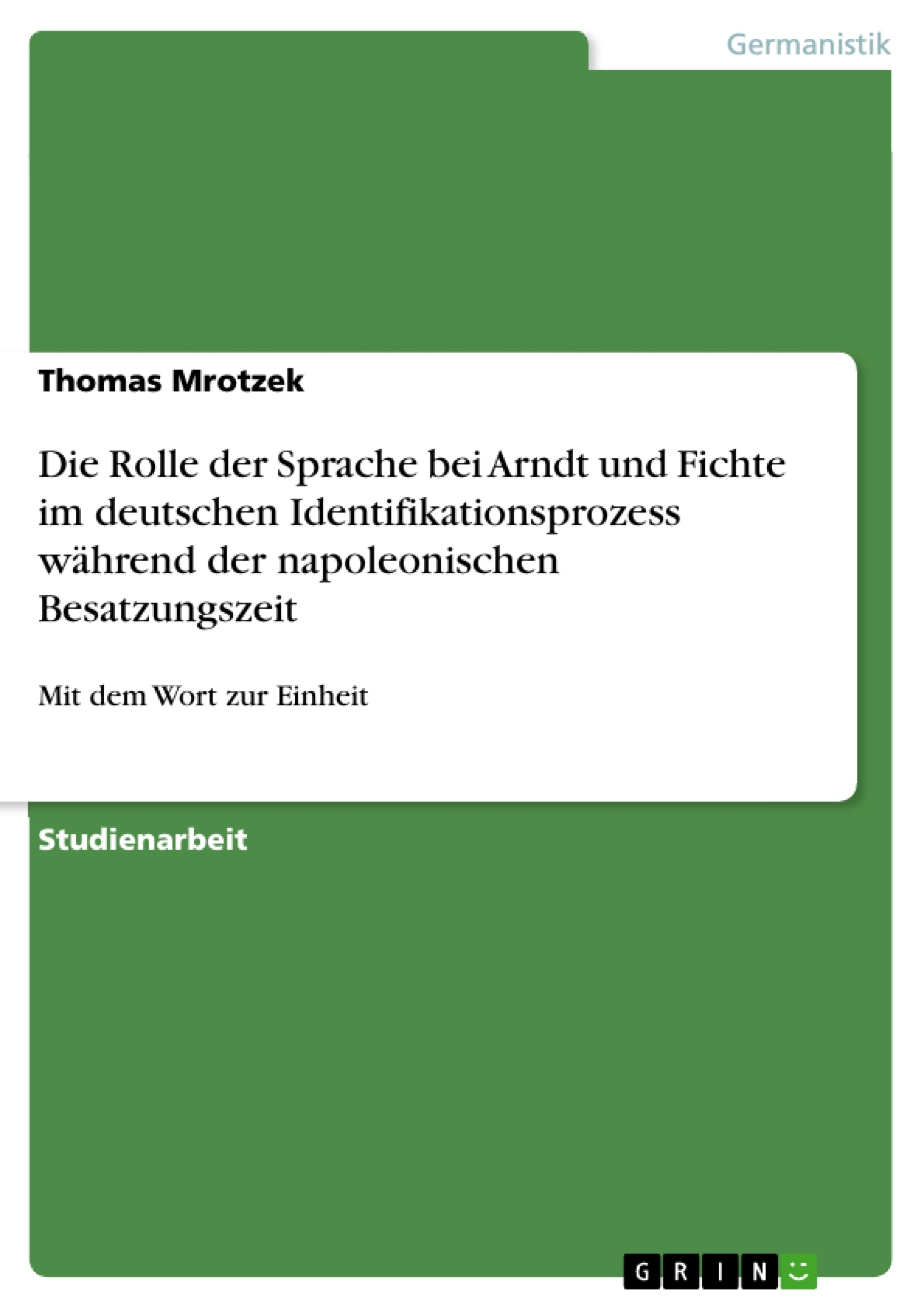Deutschland erlangte seine politische und geografische Einheit erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Der Weg dorthin war einerseits von Kriegen gegen andere europäische Staaten, andererseits vom Scheitern zahlreicher Einigungsversuche 1 gekennzeichnet. Bestrebungen, eine eigene Nation zu schaffen bzw. sich abzugrenzen, entstanden in jenen Staaten Europas, die von Napoleon besetzt wurden und überdies seit einigen hundert Jahren zersplittert waren. Zu jenen zählte auch das alte Reich. Nach dem Zusammenbruch Preußens 1806 erkannten die Reformer Preußens vom Stein und Hardenberg die Notwendigkeit einer Identifikation der Menschen mit ihrem Vaterland. Nur wenn Einigkeit und Zusammenhalt in der Bevölkerung vorherrschte, konnte gemeinsam gegen einen äußeren Feind vorgegangen werden. Das Fehlen dieser Geschlossenheit und das Nichtwissen, wofür eigentlich gekämpft werden sollte, war u. a. eine der Ursachen, warum Preußen, einen traditionellen Kabinettkrieg führend, 1806 gegen Napoleon unterlag - es fehlte eine Identität, mit welcher sich die Beherrschten identifizieren konnten. Diese sollte erst in den Folgejahren, zunächst künstlich durch staatliche Impulse, später in einem Prozess der Verselbstständigung, erreicht werden. Die Besatzung der deutschen Staaten und die damit verbundenen Kontributionszahlungen an Frankreich sowie die Bestrebungen der Regierenden, eine Identität zu stiften, führten dazu, dass ein Nationalgedanke in der deutschen Bevölkerung entstehen konnte. Forciert wurden derartige Tendenzen durch Schriftsteller und Publizisten wie Theodor Körner, Ernst-Moritz Arndt, Heinrich von Kleist sowie Ludwig Uhland und von Philosophen wie Fichte und Hegel, welche die Schaffung eines deutschen Nationalgefühles auf geistiger bzw. wissenschaftlicher Ebene nicht unwesentlich vorantrieben. Der deutschen Sprache kam in jener Debatte eine zentrale Position zu, galt sie doch zunächst als einziges Verbindungselement, das zwischen den verschiedenen Feudalstaaten und Völkern des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation vorhanden war. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbetrachtungen
- Zum historischen Entstehungskontext der betrachteten Texte
- Grundbegriffe national vs. nationalistisch
- Analyse der Ausführungen Arndts und Fichtes
- Argumentationsstrukturen
- Rolle der Sprache im Einheitsprozess
- Zusammenhang von Sprache und Identität
- Exkurs - Kleists „Germania“ in der deutschen Nationaldebatte
- Diskussion
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Rolle der Sprache im deutschen Identifikationsprozess während der napoleonischen Besatzung (1806-1814) anhand der Schriften von Ernst-Moritz Arndt und Johann Gottlieb Fichte. Sie analysiert, wie diese beiden Autoren die deutsche Geschichte und Sprache konstruieren und welche Bedeutung sie der Sprache im nationalen Einigungsprozess beimessen.
- Die Bedeutung der Sprache für die nationale Identität im Kontext der napoleonischen Besatzung
- Die Argumentationsstrukturen von Arndt und Fichte im Hinblick auf die Rolle der Sprache
- Die Konstruktion von Geschichte und Nationalität durch Sprache
- Der Vergleich der Ansichten von Arndt und Fichte zur Sprachpolitik und Nation
- Die Rolle von Sprache in der deutschen Nationaldebatte
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Arbeit dar, indem sie die politische und geografische Fragmentierung des Deutschen Reiches vor dem 19. Jahrhundert beleuchtet. Sie hebt die Rolle der Sprache als einziges verbindendes Element zwischen den verschiedenen Feudalstaaten hervor.
- Die Vorbetrachtungen setzen sich mit dem historischen Entstehungskontext der betrachteten Texte auseinander. Sie geben einen kurzen Abriss der besonderen Umstände im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und insbesondere in Preußen im Vorfeld der napoleonischen Besatzung. Außerdem wird eine Begriffsdefinition von "national" und "nationalistisch" vorgestellt.
- Die Analyse der Ausführungen Arndts und Fichtes befasst sich mit den Argumentationsstrukturen der beiden Autoren. Sie untersucht, wie sie die deutsche Geschichte und die Sprache im nationalen Einigungsprozess konstruieren und welche Rolle sie der Sprache in diesem Kontext zuschreiben.
- Die Diskussion beleuchtet kritisch die in der Analyse gewonnenen Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: deutsche Sprache, nationale Identität, napoleonische Besatzung, Arndt, Fichte, Geschichte, Sprache, Sprachpolitik, Nationalismus, Nationalität, Identifikationsprozess, Einheit.
- Quote paper
- Thomas Mrotzek (Author), 2006, Die Rolle der Sprache bei Arndt und Fichte im deutschen Identifikationsprozess während der napoleonischen Besatzungszeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65480