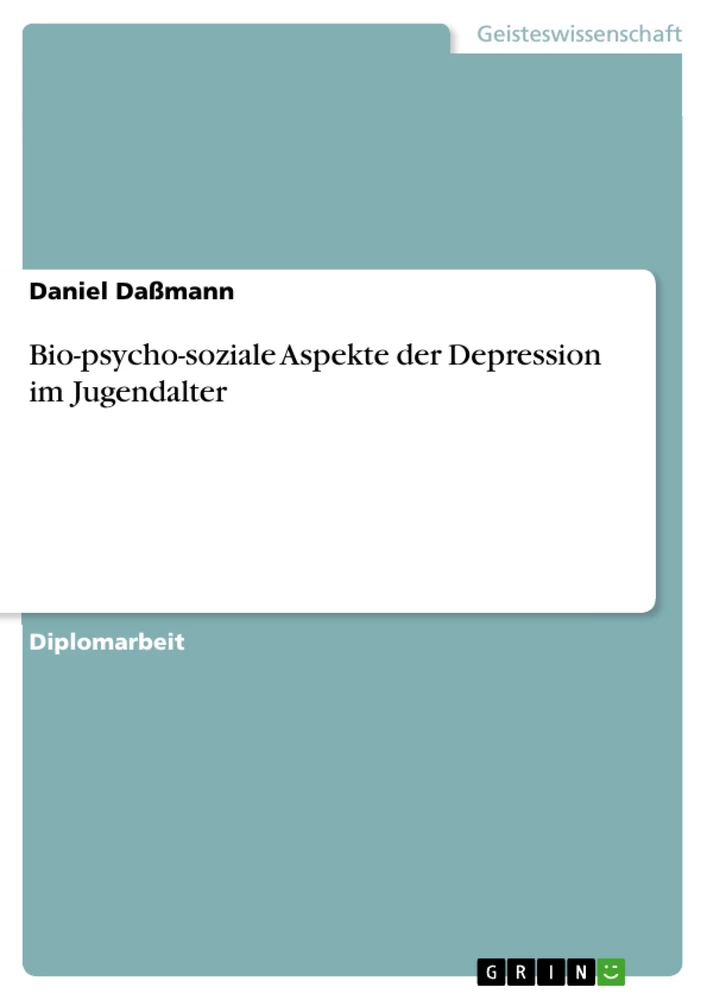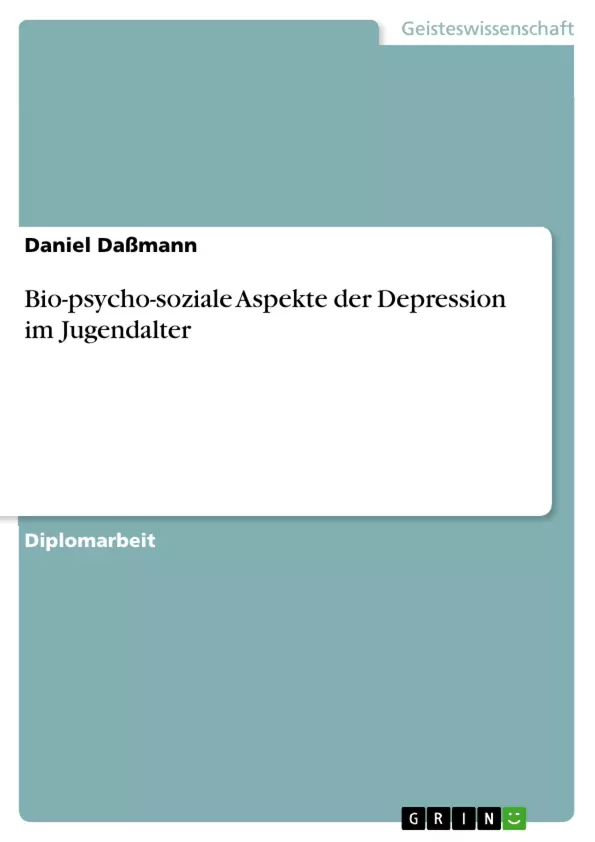1 Einleitung
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsbehörde (WHO) zählt die Depression weltweit zu den schwerwiegendsten Gesundheitsproblemen. Depressive (Ver-)Stimmungen und Erkrankungen gehören mit Abstand zu den häufigsten psychischen Krankheitserscheinungen und sind noch immer in einer rasenden Zunahme begriffen. So zeigen Untersuchungen, dass sich z.B. die depressiven Neuerkrankungen bei jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren gerade in den Städten weltweit innerhalb von 10 Jahren vervielfachten (vgl. Treichler 2003, S. 299).
Während es depressive Menschen schon immer gegeben hat, nahm man bei Jugendlichen lange Zeit an, dass diese „melancholischen Stimmungen” (Fend 2003, S. 434) normale Phänomene dieser Lebensphase seien. Heute besteht weitgehende Übereinstimmung darin, dass depressive Störungen bei Jugendlichen ein relativ weit verbreitetes und oftmals schwerwiegendes Problem darstellen. Zahlreiche epidemiologische Studien ermittelten, dass bis zu 20 % aller Jugendlichen im Laufe ihrer Entwicklung von mindestens einer ernsthaften depressiven Episode betroffen sind (vgl. Essau & Groen & Pe-termann in Braun-Scharm 2002, S. 57). Aufgrund dieser Zahlen lässt sich auch die in jüngster Zeit deutliche Zunahme von Publikationen zur Depressionsproblematik bei Jugendlichen als gesteigertes Interesse an der Thematik werten.
Trotz der immensen Fortschritte in Forschung und Wissenschaft beschränken sich viele Autoren auf einseitige biologische, psychologische oder soziologische Teilaspekte depressiver Erkrankungen (vgl. Hell 2004, S. 12). Depressionen werden zum Teil noch immer als eine monokausale Krankheit angesehen oder dargestellt. So erklärt z.B. der Psychiater Florian Holsboer seelische Leiden mit biochemischen Prozessen und lässt die psychosoziale Komponente von Depressionen weitestgehend außer Acht: „Depression ist nichts anderes als gestörter Hirnstoffwechsel.” (Holsboer, zitiert in Kerbel 2006, S. 16) Zwar kann diese Haltung dazu beitragen, die Stigmatisierung psychisch Kranker zu überwinden, andererseits jedoch reduziert diese biochemische Perspektive Menschen als „Hort von Molekülen.” (Kerbel 2006, S. 16)
Das Phänomen Depressionen nur mit der Biochemie zu erklären, erscheint mir zu kurz gegriffen. Am Beispiel der Depression im Jugendalter soll aufgezeigt werden, dass Gesundheit und Krankheit sich nicht auf (patho)physiologische-biochemische Vorgänge reduzieren lassen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aspekte der Depression
- Historisches
- Melancholie - Acedia - Depression
- Depressionen im Jugendalter
- Definition
- Erfassung und Diagnostik
- Symptomatik
- Klassifikation
- Allgemeine Veränderungen
- Klassifikation in der Entwicklungspsychologie
- Epidemiologie
- Allgemeine Entwicklung
- Entwicklung bei Jugendlichen
- Verlauf und psychosoziale Beeinträchtigung
- Verlauf
- Psychosoziale Beeinträchtigung
- Komorbidität
- Suizidverhalten
- Zusammenfassung
- Das Jugendalter
- Begriffsbestimmung
- Jugend - Pubertät - Adoleszenz
- Beginn und Ende des Jugendalters
- Ausweitung der Jugendphase
- Veränderungen in der Jugendphase
- Körperliche Veränderungen (Pubertät)
- Emotionale Veränderungen
- Kognitive Veränderungen
- Gesellschaftliche / Soziale Veränderungen
- Entwicklungsaufgaben
- Allgemeines zu Entwicklungsaufgaben
- Umgang mit körperlichen Veränderungen
- Umbau der sozialen Beziehungen
- Familie
- Die Gruppe der Gleichaltrigen
- Erwerb von Kompetenzen zum Schulabschluss und zur Berufsfindung
- Identitätsarbeit
- Bewältigung von Entwicklungsaufgaben
- Zusammenfassung
- Bio-psycho-soziale Risikofaktoren und Entstehungsmodelle
- Biologische Erklärungsmodelle
- Genetik
- Biochemie
- Das Geschlecht
- Psychologische Erklärungsmodelle
- Die kognitive Theorie
- Modell der gelernten Hilflosigkeit
- Das Verstärkerverlustmodell
- Das Problemlösungsmodell (Nezu 1989)
- Bindungstheorie (Bowlby 1980)
- Das kognitiv-interpersonale Modell (Gotlib & Hammen 1992)
- Soziale Aspekte
- Familiäre Faktoren
- Kontakt zu Gleichaltrigen
- Kritische Lebensereignisse
- Soziale Herkunft und Gesellschaftliche Faktoren
- Auslösung und Aufrechterhaltung
- Zusammenfassung
- Konsequenzen für die Soziale Arbeit
- Ziele
- Prävention und Gesundheitsförderung
- Hilfen zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben
- Stärkung der Widerstandskräfte des Jugendlichen
- Stärkung des Selbstwertgefühls / Selbstvertrauens
- Veränderung der psychosozialen Umstände
- Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit
- Lebensbewältigung
- Social Support / Das Konzept Soziale Unterstützung
- Empowerment
- Soziotherapie / Sozialtherapie
- Case Management
- Sport (und Bewegung)
- Zusammenfassung
- Definition und Klassifikation der Depression im Jugendalter
- Epidemiologie und Verlauf depressiver Erkrankungen bei Jugendlichen
- Biologische, psychologische und soziale Risikofaktoren, die die Entstehung von Depressionen im Jugendalter begünstigen
- Entwicklungs- und Lebensaufgaben des Jugendalters und deren Bedeutung für die Entstehung und Bewältigung von Depressionen
- Konsequenzen für die Soziale Arbeit und Möglichkeiten der präventiven und interventionellen Unterstützung von Jugendlichen mit depressiven Störungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, bio-psycho-soziale Aspekte der Depression im Jugendalter zu beleuchten und deren Auswirkungen auf die Lebenswelt von Jugendlichen aufzuzeigen. Die Arbeit soll ein tieferes Verständnis für die Entstehung und Ausprägung depressiver Erkrankungen im Jugendalter fördern und somit die Grundlage für eine gezielte Unterstützung von betroffenen Jugendlichen schaffen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Depression im Jugendalter heraus und verdeutlicht die wachsende Bedeutung dieser Thematik in der heutigen Gesellschaft. Zudem werden die Grenzen einer rein biochemischen Sichtweise auf Depressionen aufgezeigt und die Notwendigkeit einer multidimensionalen Betrachtungsweise betont.
Das zweite Kapitel behandelt verschiedene Aspekte der Depression. Es befasst sich mit der historischen Entwicklung des Konzepts der Depression, seiner Definition, der Erfassung und Diagnostik sowie den Symptomen und der Klassifikation von depressiven Störungen. Zudem werden epidemiologische Daten zur Häufigkeit und dem Verlauf von Depressionen bei Jugendlichen präsentiert.
Kapitel 3 fokussiert auf das Jugendalter. Es definiert den Begriff und beschreibt die körperlichen, emotionalen, kognitiven und sozialen Veränderungen, die während der Jugendphase stattfinden. Die wichtigsten Entwicklungsaufgaben des Jugendalters werden beleuchtet, insbesondere die Bedeutung der Familie, der Peer-Group und der Identitätsfindung für die psychische Entwicklung von Jugendlichen.
Kapitel 4 untersucht bio-psycho-soziale Risikofaktoren und Entstehungsmodelle für Depressionen im Jugendalter. Es werden verschiedene biologische, psychologische und soziale Erklärungsmodelle für die Entstehung depressiver Störungen vorgestellt.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Konsequenzen für die Soziale Arbeit. Es werden präventive und interventionelle Ansätze zur Unterstützung von Jugendlichen mit depressiven Störungen beleuchtet und verschiedene Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit vorgestellt, die zur Förderung der Lebensbewältigung und des Empowerments von Jugendlichen beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Depression im Jugendalter, wobei die bio-psycho-sozialen Aspekte im Vordergrund stehen. Die Kernbegriffe umfassen die Definition und Klassifikation der Depression, epidemiologische Daten, Risikofaktoren und Entstehungsmodelle, Entwicklungsaufgaben des Jugendalters, die Bedeutung sozialer Beziehungen und Konzepte der Sozialen Arbeit zur Unterstützung von Jugendlichen mit depressiven Störungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie häufig sind Depressionen bei Jugendlichen?
Studien zeigen, dass bis zu 20 % aller Jugendlichen im Laufe ihrer Entwicklung von mindestens einer ernsthaften depressiven Episode betroffen sind.
Ist Depression nur ein gestörter Hirnstoffwechsel?
Obwohl biochemische Prozesse eine Rolle spielen, ist eine rein biologische Sichtweise zu kurz gegriffen. Depressionen entstehen meist durch ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren (bio-psycho-soziales Modell).
Welche psychologischen Erklärungsmodelle gibt es?
Wichtige Modelle sind die kognitive Theorie, das Modell der gelernten Hilflosigkeit, das Verstärkerverlustmodell sowie die Bindungstheorie nach Bowlby.
Welche Rolle spielen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter?
Jugendliche müssen Aufgaben wie die Identitätsfindung, den Umgang mit körperlichen Veränderungen und den Umbau sozialer Beziehungen bewältigen. Misslingen diese, kann dies das Risiko für Depressionen erhöhen.
Was sind soziale Risikofaktoren für eine Depression?
Dazu gehören familiäre Probleme, kritische Lebensereignisse, Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen (Peer-Group) sowie die soziale Herkunft.
Wie kann die Soziale Arbeit bei Depressionen helfen?
Durch Konzepte wie Empowerment, Case Management, soziale Unterstützung und Hilfen zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben kann die Widerstandskraft der Jugendlichen gestärkt werden.
- Quote paper
- Daniel Daßmann (Author), 2006, Bio-psycho-soziale Aspekte der Depression im Jugendalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65486