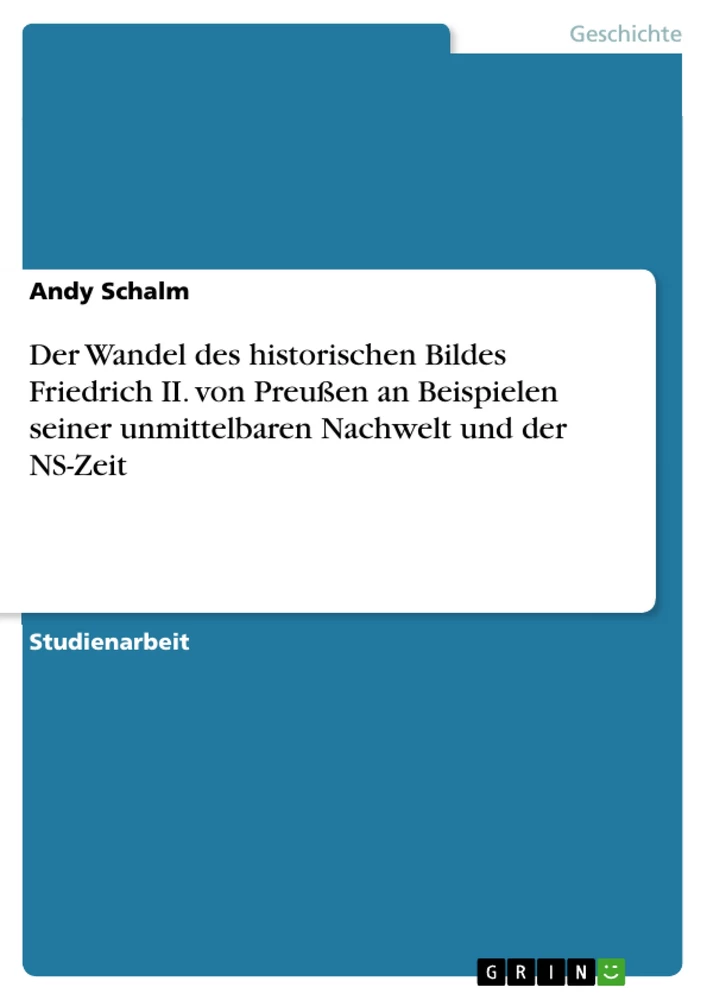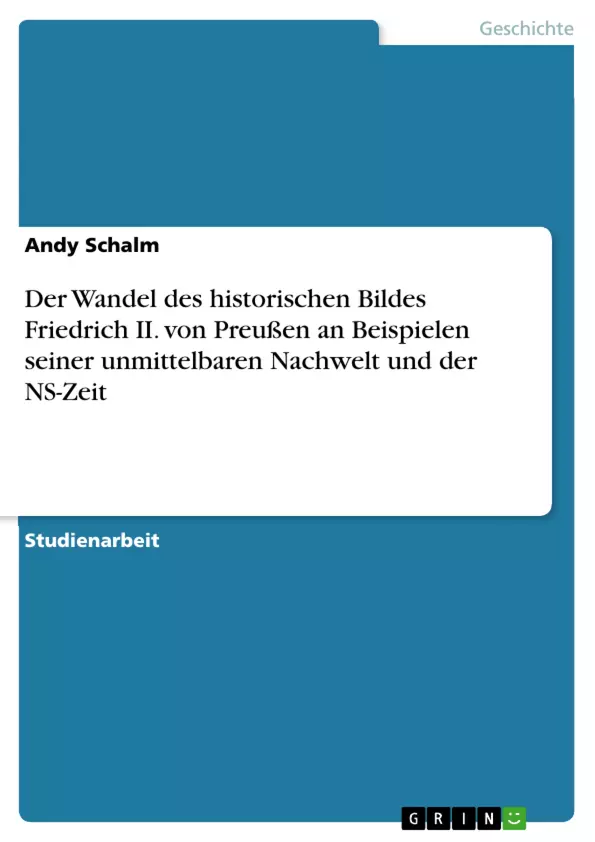Das öffentliche Bild nur weniger historischer Figuren ist im Laufe der Jahrhunderte einem derartigen Wandel unterworfen gewesen, wie das des „Alten Fritz“, Friedrich II. von Preußen. Bereits zu seinen Lebzeiten war Friedrich II. der Gegenstand zahlreicher Erzählungen und Anekdoten des Volkmundes, die ihn mehrheitlich glorifizierten. Seit seinem Ableben im Jahre 1786 scheint das Bild dieser historischen Gestalt bei der Nachwelt einem steten Wandel zu unterliegen. Die Darstellung seiner Person reicht vom „Mehrer des Reiches“, „Zerstörer des Reiches“ bis zum scheinbar diametral entgegen gesetzten „Gründer des Reiches“. Je nachdem wie die zeitgenössische politische Ausrichtung aussah, passte sich die Sicht auf den Preußenkönig entsprechend an, so dass er in den vergangenen zwei Jahrhunderten nicht nur eine historische Gestalt, sondern auch zu einem Politikum wurde. Der Historiker Walter Bußmann bemerkte diesbezüglich treffend: „Wer es unternimmt, eine Geschichte des Friedrich-Bildes zu schreiben, leistet einen Beitrag zur Geschichte des politischen Bewusstseins.“ Es scheint, als könnte der aufmerksame Beobachter aus der Friedrich-Rezeption Rückschlüsse auf Ideologien, Ideale, politische Ausrichtungen der konkreten Rezeptionszeit ziehen. Es soll das Ziel dieser Arbeit sein, zu zeigen, wie sehr Bilder von Friedrich II. zu zwei unterschiedlichen Zeiten differieren und welche Schlussfolgerungen sich aus diesen Deutungen für das jeweils zeitgenössische Politikverständnis ergeben.
Zuerst wird aufgezeigt, welche Deutungen seiner Regentschaft in seiner unmittelbaren Nachwelt, mit dem Aufkommen des neuen Geistes der Frühromantiker, in einer Zeit, in der Gelehrte und Volk begannen, von einem vereinten Deutschland zu träumen, populär wurden, um dann einen Vergleich zu ziehen zu den zwölf Jahren, in welchen Hitler der deutsche Reichskanzler war und Propagandaminister Goebbels die Deutschen von den Zielen der Nationalsozialisten mit Presse, Rundfunk, Kino – und dem Bilde vom „Alten Fritz“ – zu überzeugen suchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Friedrich der Große im Urteil seiner unmittelbaren Nachwelt
- 1.1 Die absolutistische Herrschaft
- 1.2 Der „Reichsverderber“
- 2. Friedrich der Große in der NS-Propaganda
- 2.1 Der Wandel der Zeiten und Ideologien
- 2.2 Instrumentalisierung im nationalsozialistischen Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wandel des öffentlichen Bildes von Friedrich II. von Preußen im Laufe der Geschichte, insbesondere im Kontext seiner unmittelbaren Nachwelt und der NS-Zeit. Das Ziel ist es, aufzuzeigen, wie stark die Interpretationen von Friedrich II. in diesen beiden Epochen differierten und welche Schlussfolgerungen sich daraus für das jeweilige politische Verständnis ableiten lassen.
- Die Entwicklung des öffentlichen Bildes von Friedrich II. nach seinem Tod
- Die unterschiedlichen Interpretationen von Friedrichs Herrschaft in der frühen Romantik und im Nationalsozialismus
- Die Instrumentalisierung Friedrichs als politisches Symbol in verschiedenen Epochen
- Der Einfluss des politischen Kontextes auf die Rezeption Friedrichs
- Die Rolle von Anekdoten und Mythen in der Gestaltung des Friedrich-Bildes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die historische Bedeutung von Friedrich II. von Preußen heraus und führt die zentralen Fragestellungen der Arbeit ein. Sie beleuchtet den Wandel des Friedrich-Bildes im Laufe der Geschichte und betont dessen Relevanz als Spiegelbild des politischen Bewusstseins verschiedener Epochen.
1. Friedrich der Große im Urteil seiner unmittelbaren Nachwelt
Dieses Kapitel beleuchtet die Reaktionen auf Friedrichs Tod in seiner unmittelbaren Nachwelt und analysiert die ersten Interpretationen seiner Herrschaft. Es zeigt, wie die Abkehr vom Absolutismus und das Aufkommen neuer Ideen in der Frühromantik die Rezeption Friedrichs beeinflussten.
1.1 Die absolutistische Herrschaft
Dieser Abschnitt fokussiert auf die Kritik an Friedrichs absolutistischer Herrschaft in den Jahren nach seinem Tod. Die Arbeit analysiert die Positionen von Kritikern, die die negativen Aspekte seiner Regierungsweise und die Folgen seines Herrschaftsverständnisses aufzeigen.
1.2 Der „Reichsverderber“
Hier wird die negative Interpretation Friedrichs als „Reichsverderber“ untersucht, die sich in seiner unmittelbaren Nachwelt durchsetzte. Es werden die Argumente und Kritikpunkte beleuchtet, die zu diesem negativen Bild beitrugen.
Schlüsselwörter
Friedrich II. von Preußen, Preußen, Absolutismus, Frühromantik, Nationalsozialismus, Propaganda, Anekdoten, Geschichtsbild, Politikverständnis, Rezeption, Ideologien.
Häufig gestellte Fragen
Wie wandelte sich das Bild von Friedrich II. nach seinem Tod?
Sein Bild schwankte zwischen dem glorifizierten "Alten Fritz", dem kritisierten "Reichsverderber" und dem "Gründer des Reiches", je nach politischer Ausrichtung der Epoche.
Wie instrumentalisierte die NS-Propaganda Friedrich den Großen?
Goebbels und Hitler nutzten sein Bild als Symbol für preußische Tugenden, unerschütterlichen Durchhaltewillen und als historischen Vorläufer für die nationalsozialistische Führung.
Was kritisierten die Frühromantiker an Friedrich II.?
Mit dem Aufkommen neuer Bildungsideale und dem Wunsch nach einem vereinten Deutschland wurde seine absolutistische Herrschaft oft kritisch hinterfragt.
Warum wurde Friedrich II. zu einem "Politikum"?
Da seine Regentschaft so prägend war, diente er jeder späteren Regierung als Projektionsfläche zur Legitimation der eigenen Ideologien und Ziele.
Welche Rolle spielten Anekdoten für sein Image?
Zahlreiche Volksgeschichten vermittelten das Bild eines volksnahen, gerechten und bescheidenen Königs, was seine Popularität über Jahrhunderte festigte.
- Quote paper
- Andy Schalm (Author), 2006, Der Wandel des historischen Bildes Friedrich II. von Preußen an Beispielen seiner unmittelbaren Nachwelt und der NS-Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65514