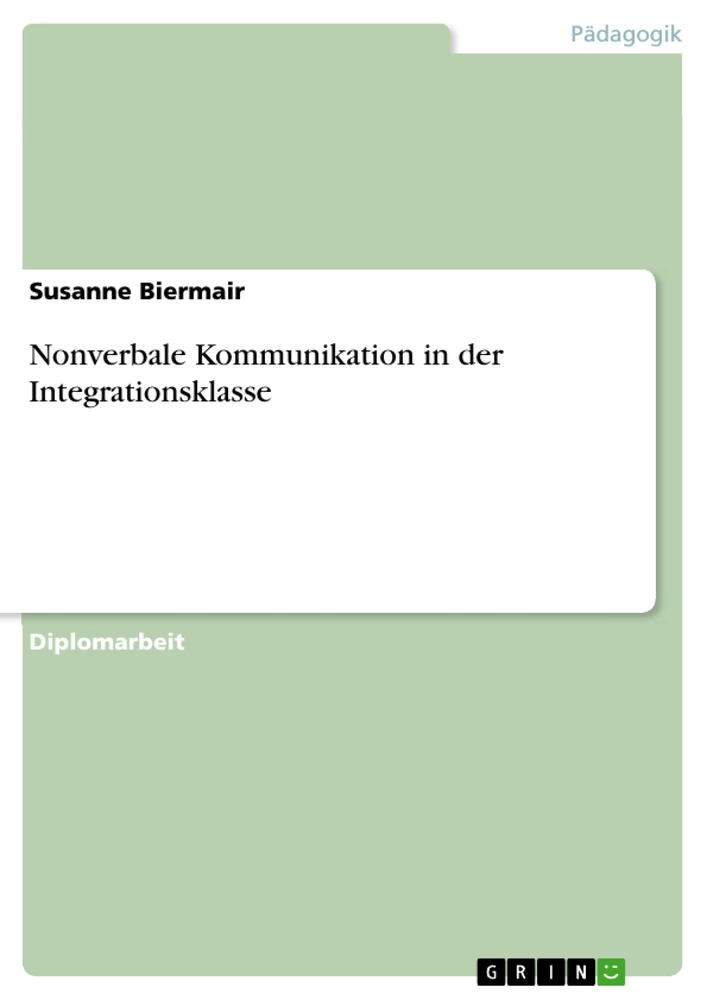Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich mich schon immer sehr für die Thematik „Schwerstbehinderte Kinder in der schulischen Integration“ interessiert habe, vor allem weil ich mitbekommen habe, dass sich viele Lehrer/innen vor dieser Thematik „fürchten“ und scheuen. Besonders interessierte mich zusätzlich der Aspekt der nonverbalen Kommunikation. Da ich Jona schon seit vier Jahren persönlich kenne und auch in seiner Klasse ein Semester unterrichten durfte, schien es für mich perfekt, diese drei Aspekte der Schwerstbehinderung, Integration und der nonverbalen Kommunikation in einer Arbeit zu vereinigen. Die Problemstellung dieser Arbeit ist es, anhand dieses Einzelfalles, die Bedeutsamkeit einer funktionierenden Integration zu veranschaulichen. Hierfür wird der Fall von Jona, einem schwerstbehinderten, nonverbalen Kindes, beschrieben, das trotz seiner Behinderung gut im Klassenverband integriert ist. Dazu wählte ich die Methode der Einzelfallanalyse. In dieser Methode finden sich mehrere Aspekte, einen einzelnen Fall genauesten zu durchleuchten. Die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historischen, lebensgeschichtliche Hintergrund sollen hier betont werden. Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen (siehe Mayring, 2002, S.42). Das Material für Fallanalysen kann sehr vielfältig sein. In dieser Arbeit wurden folgende Methoden bzw. Materialien verwendet: Interviews mit Mutter und Sonderschullehrerin, Fragebögen an die Mitschüler/innen, von Ärzten erhobene Krankengeschichten (Anamnesen), persönliche Lebenskurve und die Erfolgs- bzw. Misserfolgsquote diverser Therapien.
Diese Arbeit soll angehenden Lehrer/innen Mut machen, Herausforderungen in ihrem Beruf anzunehmen und zu versuchen aus jeder neuen Situation das Bestmögliche zu machen. Jedes behinderte Kind ist in seinem Wesen individuell und dies gilt es herauszufinden, was das jeweilige Kind für sich benötigt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Theoretische Einführungen
- Definition von Behinderung
- Definition der Integration
- Kinder mit schweren Behinderungen in der Schule
- Wesensmerkmale der Kommunikation
- Unterstützte Kommunikation (UK)
- Zukunftsperspektiven für Jona
- Empirischer Teil
- Die Methode
- Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die nonverbale Kommunikation eines schwerstbehinderten Kindes namens Jona in einer Integrationsklasse. Ziel ist es, das individuelle Kommunikationssystem Jonas zu erforschen und die Herausforderungen und Chancen der Integration schwerstbehinderter Kinder in den Schulunterricht aufzuzeigen.
- Definition und Herausforderungen von Schwerstbehinderung
- Integration und Inklusion im Bildungssystem
- Nonverbale Kommunikationsformen und Unterstützte Kommunikation (UK)
- Individuelle Kommunikationssysteme von Kindern mit Schwerstbehinderung
- Zukunftsperspektiven und Unterstützungsmöglichkeiten für Jona
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort stellt Jona und seine Lebensgeschichte vor und bietet einen Einblick in seine Perspektive auf seine Behinderung.
- Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz der Thematik.
- Der theoretische Teil beschäftigt sich mit der Definition von Behinderung und Integration sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Integration schwerstbehinderter Kinder.
- Die Kapitel 3 und 4 untersuchen die schulische Situation schwerstbehinderter Kinder und die Bedeutung der Kommunikation.
- Kapitel 5 befasst sich mit der Unterstützten Kommunikation (UK) und analysiert verschiedene nonverbale Kommunikationstechniken.
- Kapitel 6 beleuchtet die Zukunftsperspektiven für Jona und diskutiert die Bedeutung von Selbstbestimmung und persönlicher Assistenz.
- Der empirische Teil der Diplomarbeit beschreibt die Methode der Einzelfallanalyse und die verwendeten Methoden der Datenerhebung und -auswertung.
- Kapitel 8 bietet eine Zusammenfassung des Falls Jona und strukturiert die gewonnenen Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Themen Schwerstbehinderung, Integration, Inklusion, nonverbale Kommunikation, Unterstützte Kommunikation (UK), individuelle Kommunikationssysteme, Fallstudie, Einzelfallanalyse.
- Quote paper
- Mag. Susanne Biermair (Author), 2005, Nonverbale Kommunikation in der Integrationsklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65531