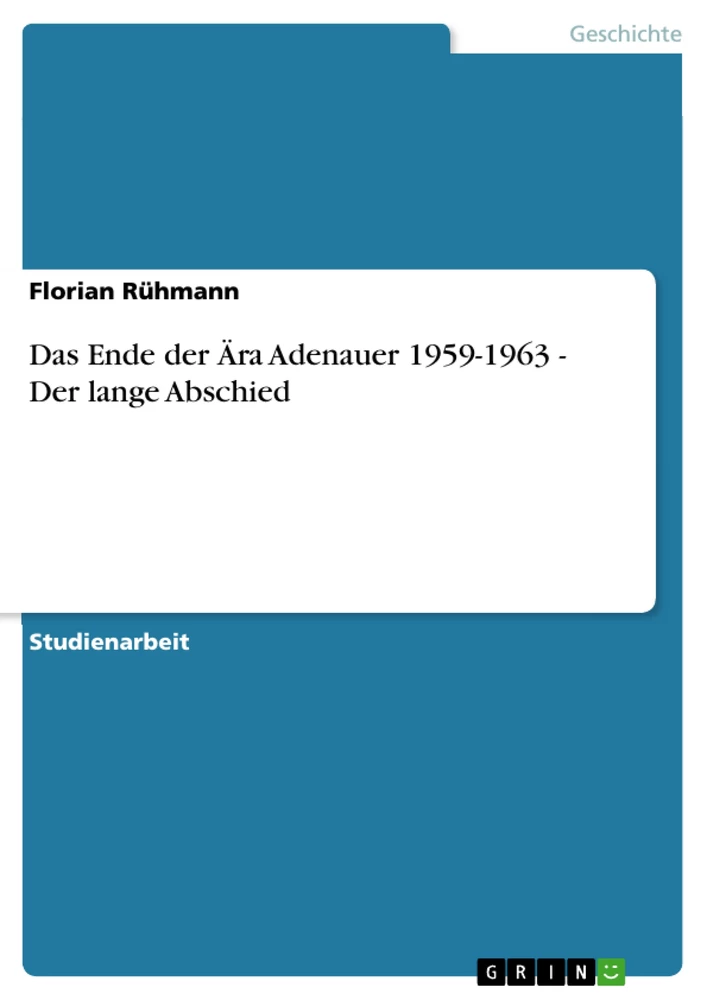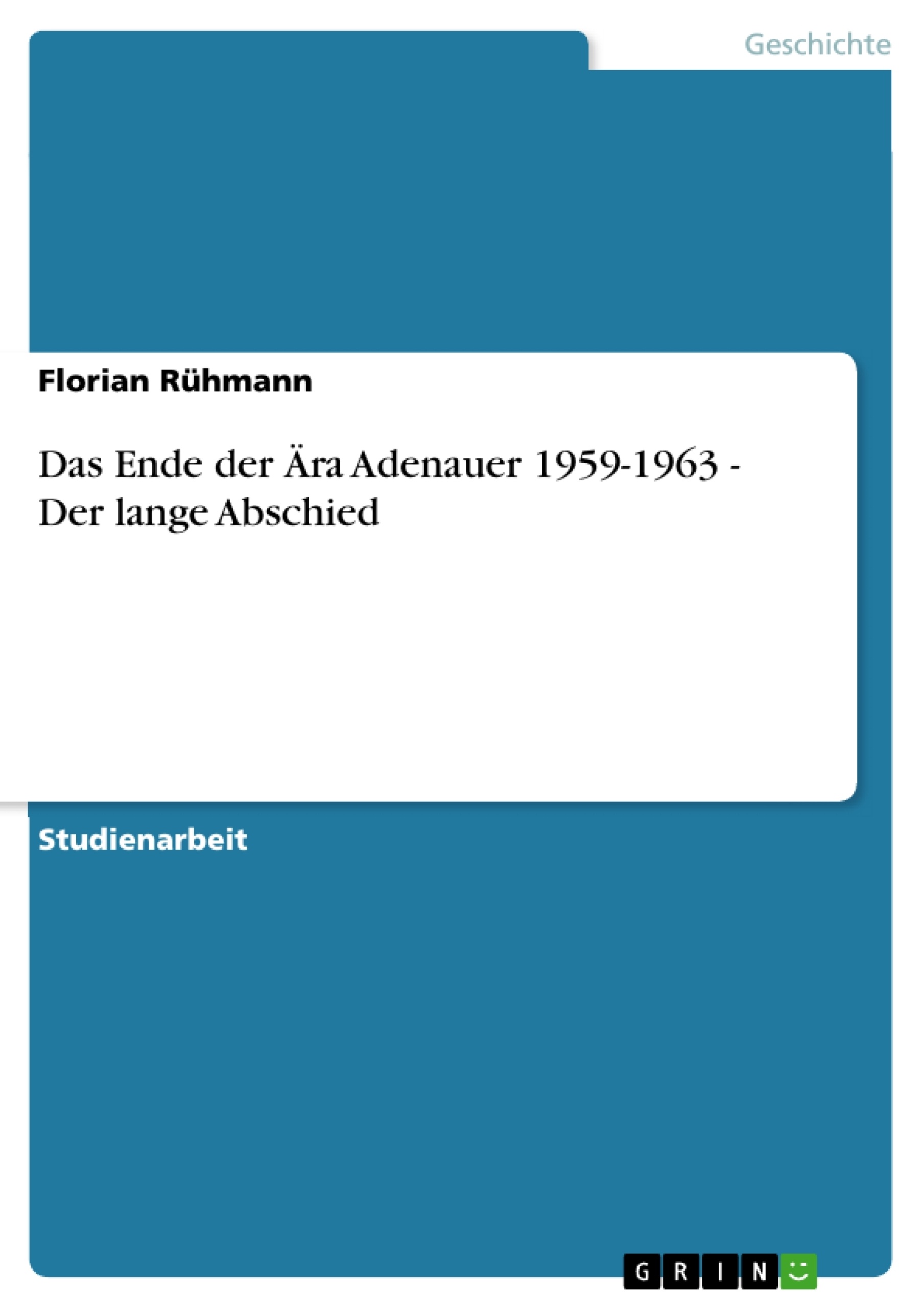Bei der Bundestagswahl am 15. September 1957 erreichte die CDU/CSU 50,2% der abgegebenen Zweitstimmen und verteidigte damit ihre absolute Mehrheit im Bundestag. Nach diesem grandiosen Wahlsieg bestand kein Zweifel darin, dass der bereits 81-jährige Konrad Adenauer erneut als Bundeskanzler vereidigt werden würde. Doch trotz seiner enormen Popularität und ungebrochenen Vitalität verlor Adenauer innerhalb dieser so selbstbewusst begonnenen dritten Legislaturperiode zunehmend an Autorität. Es zeigte sich immer deutlicher, dass der Bundeskanzler mit diesem Wahltriumph seinen Zenit erreicht hatte.
In der vorliegenden Arbeit werden exemplarisch fünf krisenhafte Ereignisse der letzten Kanzlerjahre dargelegt und die Bewältigungsstrategien Adenauers untersucht. Anhand der Präsidentschaftskrise 1959, dem Bau der Berliner Mauer 1961, der Regierungsbildung 1961, der Spiegel-Affäre 1962 sowie der Nachfolgediskussion und dem Rücktritt 1963 werden Verfehlungen Adenauers aufgezeigt, welche zu dessen Autoritätsverlust beigetragen haben. Darüber hinaus sollen Erklärungen für das jeweilige spezifische Agieren Adenauers während der einzelnen Krisen gefunden werden. Trugen möglicherweise auch Altersgründe zur wachsenden Führungsschwäche des Kanzlers bei? Wäre die 1959 anvisierte Lösung, Adenauer zum Bundespräsidenten zu wählen, die richtige gewesen? Was veranlasste Adenauer, seinen Rücktritt immer weiter hinauszuschieben? Wurde Adenauer letztlich von seiner eigenen Partei aus dem Amt gedrängt?
Ausgehend von der Bundestagswahl 1957 wird in einem ersten Schritt kurz die Situation zu Beginn der dritten Kanzlerschaft Adenauers nachgezeichnet. Um die Stimmungslage, vor deren Hintergrund sich die zugespitzte Entwicklung 1959 bis 1963 vollzog, besser nachempfinden zu können, werden vorab erste innen- und außenpolitische Krisen aufgezeigt. Im zweiten Schritt stehen dann die bereits genannten krisenhaften Geschehnisse der letzten Kanzlerjahre Adenauers im Mittelpunkt der Untersuchungen. Ziel ist es, die letzten Jahre der Kanzlerschaft Adenauers im Hinblick auf dessen stetigen Machtverlust zu untersuchen und sowohl die Gründe als auch die Wirkung seines Handelns während der einzelnen Krisen herauszustellen. Abschließend soll die Frage diskutiert werden, ob Adenauer den Zeitpunkt für seinen Rücktritt mit Bedacht wählte, oder ob dieser günstigere Augenblicke für sein Ausscheiden als Bundeskanzler verstreichen ließ.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausgangslage - Bundeskanzler Adenauer auf dem Zenit seiner Macht
- Erste innenpolitische Krisen
- Erste außenpolitische Krisen
- Von einer Krise in die nächste - Adenauers letzte Jahre als Bundeskanzler
- Präsidentschaftskrise 1959
- Bau der Berliner Mauer 1961
- Regierungsbildung 1961
- Spiegel-Affäre 1962
- Nachfolgediskussion und Rücktritt 1963
- Der zu lange Abschied? (Schlussbetrachtung)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die letzten Jahre der Kanzlerschaft Konrad Adenauers (1959-1963) unter dem Aspekt seines zunehmenden Machtverlustes. Es werden die Gründe für diesen Verlust und die Auswirkungen auf Adenauers Handeln in verschiedenen Krisensituationen analysiert. Die Arbeit fragt nach den Ursachen für Adenauers Agieren während dieser Krisen und evaluiert die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt seines Rücktritts.
- Adenauers Machtverlust im Kontext der dritten Legislaturperiode
- Analyse von Krisenereignissen (Präsidentschaftskrise, Mauerbau, Spiegel-Affäre etc.)
- Bewertung von Adenauers Entscheidungsfindung und Führungsstil in Krisensituationen
- Die Rolle von innen- und außenpolitischen Faktoren
- Die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt für Adenauers Rücktritt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: Adenauers grandioser Wahlsieg 1957 und der darauffolgende, allmähliche Verlust an Autorität in seiner dritten Legislaturperiode. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf fünf krisenhafte Ereignisse und deren Analyse, um Adenauers Bewältigungsstrategien und die Ursachen seines Autoritätsverlustes zu untersuchen. Dabei werden Fragen nach dem Einfluss des Alters und der Möglichkeit einer früheren Ablösung thematisiert.
2. Die Ausgangslage – Bundeskanzler Adenauer auf dem Zenit seiner Macht: Dieses Kapitel beschreibt die Situation zu Beginn der dritten Kanzlerschaft Adenauers nach dem Wahlsieg von 1957. Es wird die unangefochtene Position Adenauers innerhalb der CDU/CSU dargestellt, gleichzeitig aber auch der Aufstieg Ludwig Erhards als möglicher Nachfolger erwähnt. Das Kapitel beleuchtet die erste innenpolitische und außenpolitische Krisen, die den Ton für die folgenden Jahre setzten. Die Entstehung der „Brigade Erhard“ und das Bestreben der CDU/CSU nach einem Zweiparteiensystem werden behandelt.
2.1 Erste innenpolitische Krisen: Die zunehmende Skepsis gegenüber Adenauers Deutschlandpolitik im Bundestag wird hier analysiert. Die parlamentarische Niederlage Adenauers 1958 wird im Detail betrachtet, sowie die Kritik von Oppositionsparteien an Adenauers vermeintlichem Mangel an Willen zur Einigung mit der Sowjetunion. Das Kapitel betont die Annäherung von FDP und SPD in ihren Positionen zur Wiedervereinigungsfrage und den Einfluss dieser Entwicklung auf Adenauers Position.
2.2 Erste außenpolitische Krisen: Die Anerkennung der DDR durch Jugoslawien und die daraufhin angewandte Hallstein-Doktrin stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels. Die Konsequenzen der harten Linie Adenauers gegenüber Jugoslawien und die außenpolitische Bedeutung der Hallstein-Doktrin werden erläutert. Es wird die konsequente Umsetzung der Alleinvertretungsanspruch der BRD dargestellt.
Schlüsselwörter
Konrad Adenauer, Bundeskanzler, dritte Legislaturperiode, Machtverlust, Krisenmanagement, innenpolitische Krisen, außenpolitische Krisen, Präsidentschaftskrise 1959, Berliner Mauer 1961, Spiegel-Affäre 1962, Regierungsbildung 1961, Nachfolgediskussion, Rücktritt 1963, Deutschlandpolitik, Hallstein-Doktrin, CDU/CSU, Ludwig Erhard, Wiedervereinigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Adenauers letzte Jahre als Bundeskanzler
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die letzten Jahre (1959-1963) der Kanzlerschaft Konrad Adenauers unter dem Aspekt seines zunehmenden Machtverlustes. Sie untersucht die Gründe für diesen Machtverlust und dessen Auswirkungen auf Adenauers Handeln in verschiedenen Krisensituationen. Ein zentraler Punkt ist die Evaluation des optimalen Zeitpunkts für seinen Rücktritt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Adenauers Machtverlust während seiner dritten Legislaturperiode. Im Detail werden Krisenereignisse wie die Präsidentschaftskrise 1959, der Bau der Berliner Mauer 1961, die Spiegel-Affäre 1962 und die Regierungsbildung 1961 analysiert. Weiterhin werden Adenauers Entscheidungsfindung, Führungsstil in Krisensituationen, der Einfluss innen- und außenpolitischer Faktoren und die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt seines Rücktritts bewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Ausgangslage (Adenauer auf dem Zenit seiner Macht mit Unterkapiteln zu innen- und außenpolitischen Krisen), ein Kapitel über Adenauers letzte Jahre mit detaillierten Beschreibungen der oben genannten Krisen und eine Schlussbetrachtung zum Thema „Der zu lange Abschied?".
Wie wird die Ausgangslage beschrieben?
Das Kapitel zur Ausgangslage beschreibt Adenauers unangefochtene Position nach dem Wahlsieg 1957, erwähnt aber gleichzeitig den Aufstieg Ludwig Erhards als potenziellen Nachfolger. Es beleuchtet erste innen- und außenpolitische Krisen, die Entstehung der „Brigade Erhard“ und das Bestreben nach einem Zweiparteiensystem.
Welche innenpolitischen Krisen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die wachsende Skepsis gegenüber Adenauers Deutschlandpolitik im Bundestag, seine parlamentarische Niederlage 1958 und die Kritik an seinem vermeintlichen Mangel an Willen zur Einigung mit der Sowjetunion. Die Annäherung von FDP und SPD in der Wiedervereinigungsfrage und deren Einfluss auf Adenauers Position werden ebenfalls thematisiert.
Welche außenpolitischen Krisen werden behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anerkennung der DDR durch Jugoslawien und die daraufhin angewandte Hallstein-Doktrin. Es erläutert die Konsequenzen von Adenauers harter Linie gegenüber Jugoslawien und die außenpolitische Bedeutung der Hallstein-Doktrin sowie die konsequente Umsetzung des Alleinvertretungsanspruchs der BRD.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Konrad Adenauer, Bundeskanzler, dritte Legislaturperiode, Machtverlust, Krisenmanagement, innenpolitische Krisen, außenpolitische Krisen, Präsidentschaftskrise 1959, Berliner Mauer 1961, Spiegel-Affäre 1962, Regierungsbildung 1961, Nachfolgediskussion, Rücktritt 1963, Deutschlandpolitik, Hallstein-Doktrin, CDU/CSU, Ludwig Erhard, Wiedervereinigung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtung ("Der zu lange Abschied?") befasst sich mit der Frage, ob Adenauer zu lange im Amt blieb und bewertet den optimalen Zeitpunkt für seinen Rücktritt im Kontext der dargestellten Krisen und seines Machtverlustes. Dies wird durch die Analyse seiner Bewältigungsstrategien und der Ursachen seines Autoritätsverlustes unter Einbezug des Einflusses seines Alters erreicht.
- Quote paper
- Florian Rühmann (Author), 2006, Das Ende der Ära Adenauer 1959-1963 - Der lange Abschied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65550