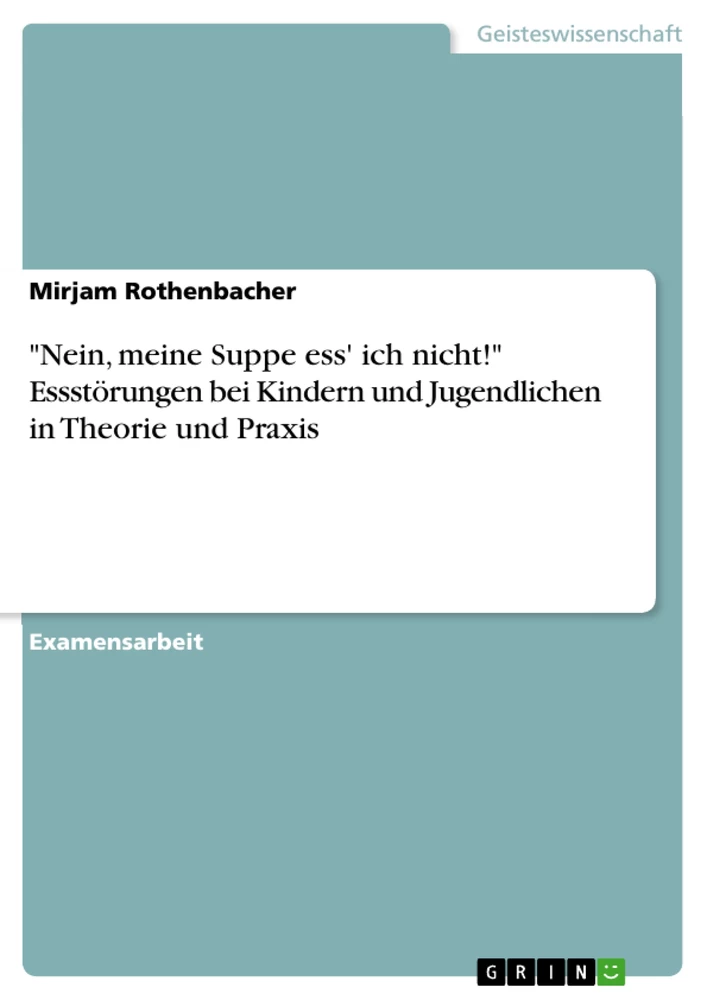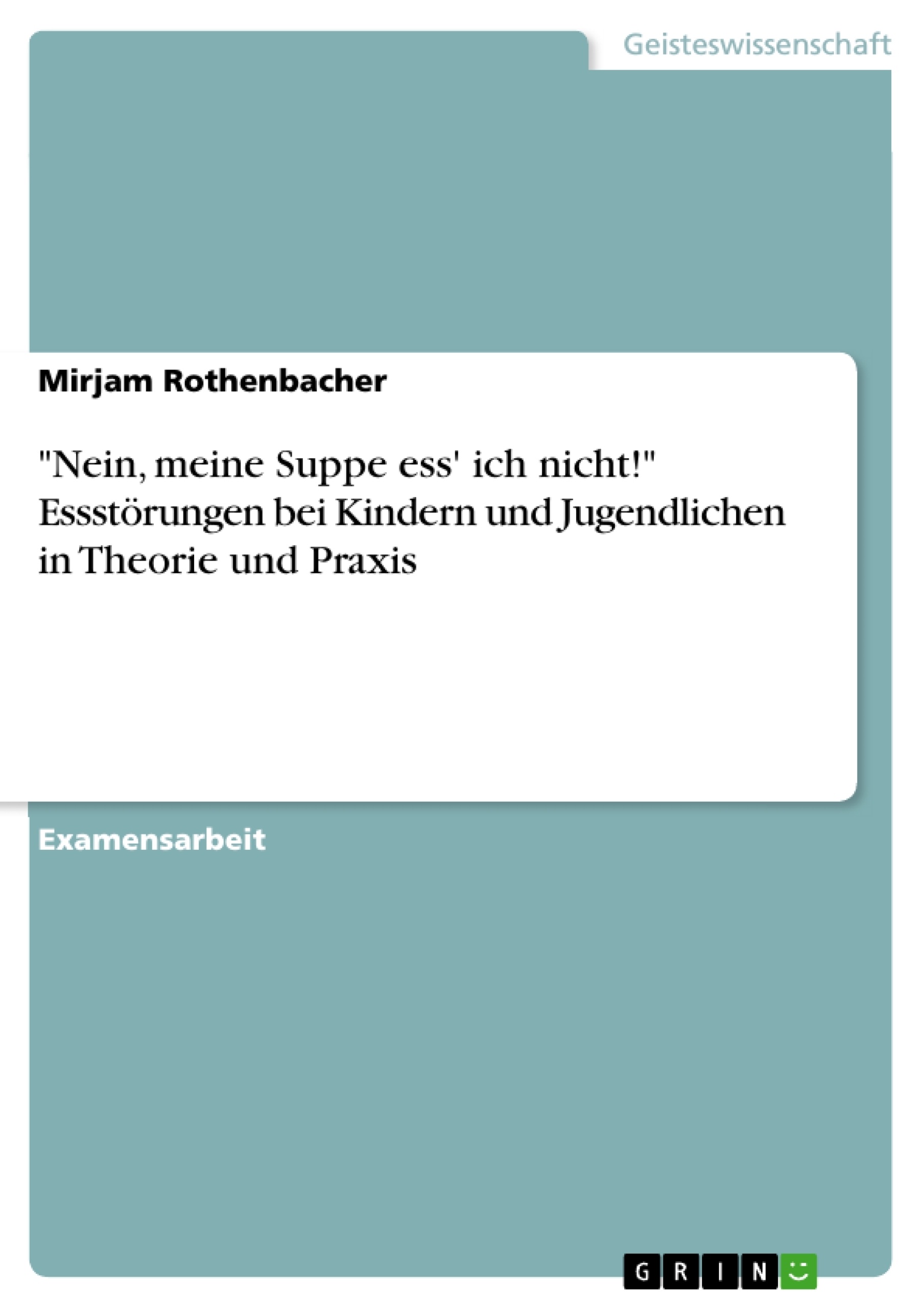„Ich esse keine Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht! Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“ Dieser berühmte Ausspruch des Suppenkaspars aus dem Jahre 1844 scheint dem unkundigen Leser erstmal nichts mitteilen zu wollen, außer der Tatsache, dass ein kleiner, molliger Junge womöglich aus Trotz oder Protest gegen die Eltern keine Lust hat, seine Suppe zu essen. Diese vermeintliche Oberflächlichkeit entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Trugschluss, hat die Geschichte doch nach einheitlicher wissenschaftlicher Überzeugung eine tiefgründigere Thematik und offenbart bei näherer Betrachtung und bei Kenntnis des Tätigkeitsgebiets des Autors wohl eines der ersten Zeugnisse der Neuzeit für eine Essstörung. Zum Märchen „degradiert“, thematisiert sie erstmalig für die breite Öffentlichkeit ein bis dato weitgehend unbekanntes oder ignoriertes oder nicht ernst genommenes Krankheitsbild und macht es durch zahlreiche Kinderbücher publik.
Der Autor des „Suppenkaspars“, Dr. Heinrich Hoffmann, lebte von 1809 bis 1894 und war Nervenarzt in Frankfurt in einer „Anstalt für Irre und Epileptiker“. Sein Gebiet war die Jugendpsychiatrie. Da er für seinen damals dreijährigen Sohn kein passendes Geschenk zu Weihnachten fand, entschloss er sich, ein Kinderbuch selbst zu verfassen und es ihm zu schenken. Der „Struwwelpeter“ war geboren, wenn auch vorerst noch unter einem anderen Titel. In dem Buch fand sich auch die Geschichte des Suppenkaspars wieder. Inhaltlich wurde darin zum einen die Erziehung des Bürgertums pointiert thematisiert, die bis dato nur auf eine Berufsausbildung denn eine Charakterbildung fixiert war, zum anderen griff Hoffmann ein Thema auf, das zur damaligen Zeit weiten Teilen der Bevölkerung völlig neu war: Die freiwillige Essensverweigerung! Durch die vorausgegangenen, jahrelangen Hungersnöte breiter Teile der Bevölkerung erschien ein vorsätzlicher Verzicht auf Nahrung ja geradezu absurd. Der Suppenkaspar ist wahrscheinlich das erste bekannte literarische Zeugnis eines Anorektikers, vielleicht sogar ein authentischer Fall aus der Praxis Hoffmanns.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Geschichte vom Suppenkaspar - Märchen oder harte Realität?
- 2 Begriffliche Einordnung und wissenschaftliche Engführung
- 2.1 Die Anorexia nervosa
- 2.2 Die Bulimia nervosa
- 2.3 Fazit
- 3 Selbstaushungerung und Magersucht im Spiegel der Zeit
- 4 Diverse Erklärungsansätze für die Krankheitsursachen
- 4.1 Der kulturgebundene Ansatz
- 4.2 Ein psychoanalytischer Erklärungsversuch
- 4.3 Die systemtheoretische Sichtweise
- 4.4 Traumatische Erlebnisse als Ursache für Essstörungen
- 4.5 Suchtimmanente Aspekte
- 4.6 Die genetische Veranlagung als Prädisposition
- 5 Therapieansätze im Bezirksklinikum Regensburg
- 6 Gesellschaftliche und mediale Antwortmöglichkeiten auf die Essstörungen
- 6.1 Essgestörte und das Internet: „Pro-Ana“- und „Pro-Mia“- Seiten - Eine Hilfe für Erkrankte oder Beihilfe zum Selbstmord auf Raten?
- 6.2 Andere Länder, andere Sitten: Spanien sagt den Magermodels den Kampf an!
- 6.3 Die Kampagne der Kosmetikfirma Dove – Ein Schritt in die richtige Richtung?
- 7 Die Schule - Prävention an der Quelle
- 7.1 Vorträge an Schulen und Unterrichtsgänge mit den Schulklassen
- 7.2 Der Lehrer: Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik
- 8 Essstörungen: Ein Thema an den Hauptschulen im Regierungsbezirk Oberpfalz?
- 9 Wie geht's weiter? Ein Blick in die Zukunft
- 10 Ein Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen und verfolgt das Ziel, ein umfassendes Bild dieser komplexen Thematik zu zeichnen. Sie beleuchtet sowohl die geschichtliche Entwicklung des Themas als auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Entstehung, Ursachen und Therapieformen.
- Begriffliche Einordnung von Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
- Kulturelle, psychologische und systemische Faktoren bei der Entstehung von Essstörungen
- Therapieansätze und deren Wirksamkeit
- Gesellschaftliche und mediale Einflüsse auf das Essverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Präventionsmöglichkeiten an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Geschichte des Suppenkaspars, eines literarischen Beispiels, das die Thematik der Essstörung bereits im 19. Jahrhundert aufgreift. Die Kapitel zwei und drei befassen sich mit der Definition von Anorexia nervosa und Bulimia nervosa und geben einen Überblick über die Entwicklung der Erkrankung im Laufe der Zeit. Kapitel vier analysiert verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Essstörungen, wobei kulturelle, psychologische, systemische und traumatische Faktoren betrachtet werden. Kapitel fünf beschäftigt sich mit den Therapieansätzen im Bezirksklinikum Regensburg, während Kapitel sechs die Rolle der Medien und der Gesellschaft bei der Entstehung und Bewältigung von Essstörungen beleuchtet. Kapitel sieben konzentriert sich auf die Prävention von Essstörungen an Schulen, wobei die Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik beleuchtet werden. Kapitel acht untersucht die Verbreitung von Essstörungen an Hauptschulen in der Oberpfalz. Das letzte Kapitel wirft einen Blick in die Zukunft und diskutiert Prognosen zur weiteren Entwicklung der Krankheit.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Kultur, Psychologie, Systemtheorie, Trauma, Therapie, Medien, Gesellschaft, Schule, Prävention, Hauptschulen, Oberpfalz, Zukunft.
- Quote paper
- Mirjam Rothenbacher (Author), 2006, "Nein, meine Suppe ess' ich nicht!" Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen in Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65565