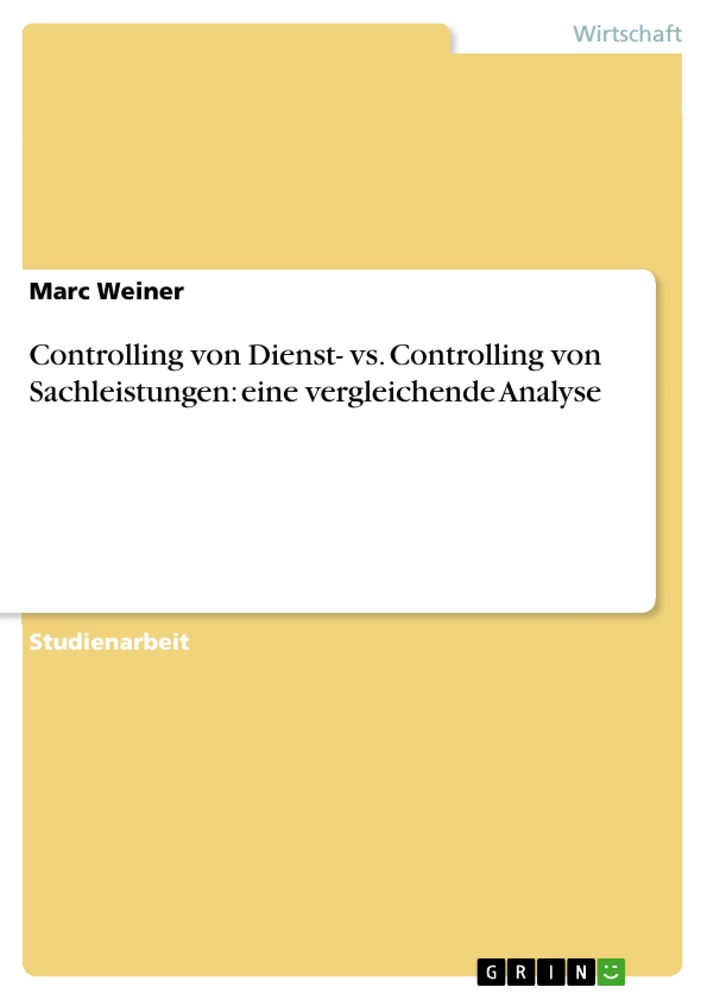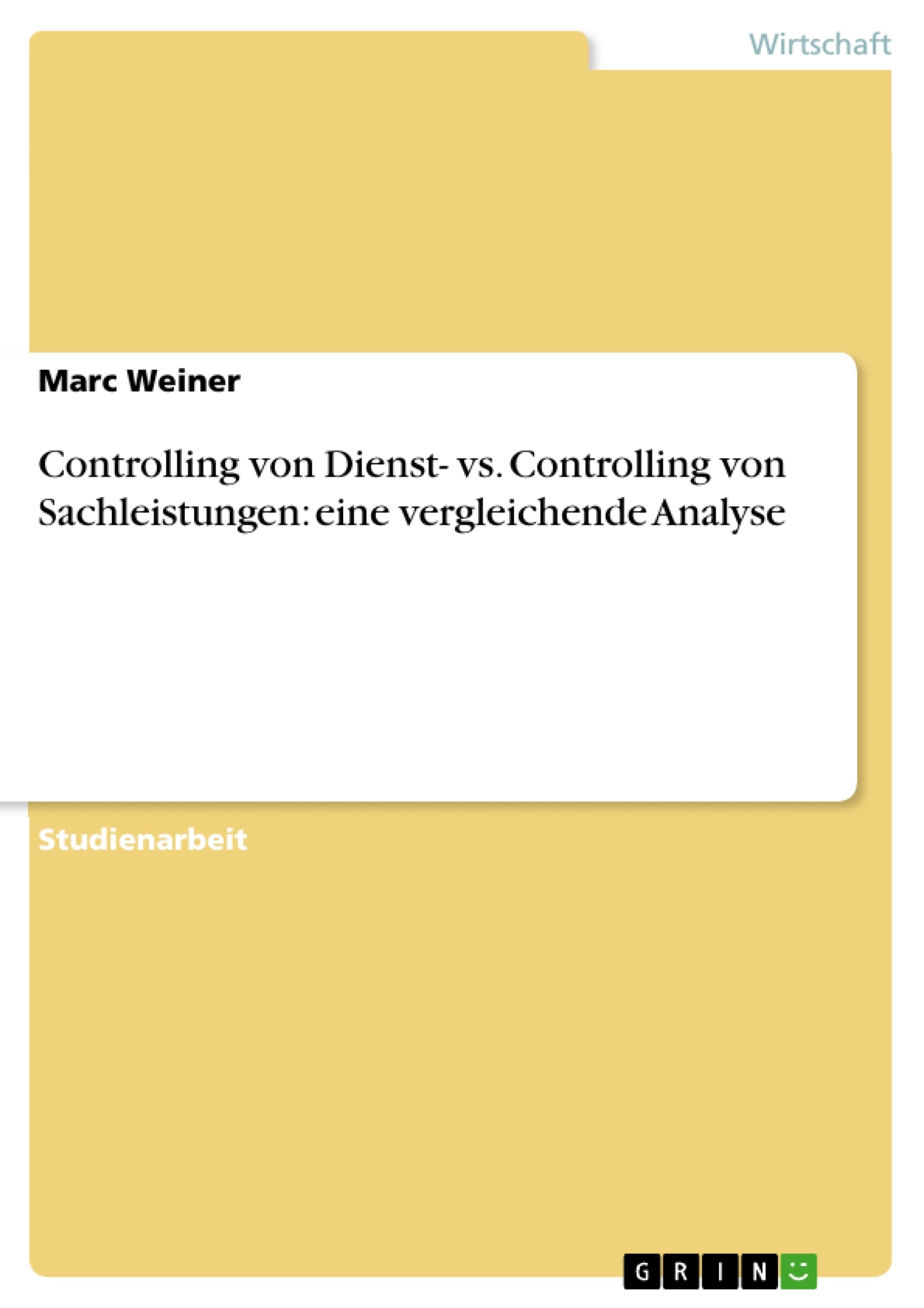Ein Blick auf die bis in die 1980er Jahre hinein erschienene betriebswirtschaftliche Fachliteratur zeigt, dass dem Controlling in Dienstleistungsunternehmen bislang wenig Beachtung zukam. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde die Betriebswirtschaftslehre mit einer Industriebetriebs-lehre gleichgestellt, in der Dienstleistungen keine nennenswerte Rolle spielten. Letztere Studien zeigen aber, dass viele Industrienationen in einem strukturellen Wandel stecken. Die traditionellen Berufe der Landwirtschaft und Industrie sterben aus oder wandern ab. Die Menschen aber leben immer länger und schneller, und um dieses Leben mit immer komplizierterer Technik am Laufen zu halten, bedarf es des vermehrten Service. Es entsteht zunehmend eine neue Dienstleistungsgesellschaft in der die Relevanz des speziellen Dienstleistungscontrolling mit leistungsfähigen Instrumenten immer wichtiger wird: „Leistungsfähigeren Ansätzen des Dienstleistungscontrolling kommt in der Zukunft entscheidende Bedeutung zu“. Die Unterstützung und Koordination kundenbezogener Aktivitäten im Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit ist, sowohl in produzierenden Unternehmen als auch in Dienstleistungsunternehmen, das grundsätzliche Ziel des Controlling. Angesichts der etablierten Standardwerke zum Controlling stellt sich folglich die Frage, ob bzw. wie sich Ziele und Aufgaben des Dienstleistungscontrolling mit denen des Controlling von Sachleistungen unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptionelle Grundlagen von Dienstleistung und Dienstleistungscontrolling
- Der Dienstleistungsbegriff
- Der Begriff des Dienstleistungscontrolling (DLC)
- Systematischer Vergleich zwischen den Zielen/Aufgaben des DLC mit dem Controlling von Sachleistungen
- Besonderheiten des DLC
- Wertender Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die spezifischen Herausforderungen des Controllings in Dienstleistungsunternehmen im Vergleich zum Controlling von Sachleistungen. Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Zielen, Aufgaben und Instrumenten beider Ansätze.
- Die Besonderheiten des Dienstleistungsbegriffs und ihre Auswirkungen auf das Controlling
- Der Vergleich der Ziele und Aufgaben des Dienstleistungscontrolling mit dem Controlling von Sachleistungen
- Die Herausforderungen des Dienstleistungscontrolling im Kontext von Kapazitäts-, Personal- und Qualitätscontrolling
- Eine alternative Sichtweise auf die Unterschiede des Controllings von Dienst- vs. Sachleistungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungscontrolling im Kontext der modernen Dienstleistungsgesellschaft und stellt die grundlegende Fragestellung nach den Unterschieden zwischen dem Controlling von Dienst- und Sachleistungen in den Vordergrund.
- Konzeptionelle Grundlagen von Dienstleistung und Dienstleistungscontrolling: Dieses Kapitel definiert den Dienstleistungsbegriff und seine spezifischen Merkmale wie Immaterialität, Integrativität und Verhaltensunsicherheiten zwischen Anbieter und Nachfrager. Auf dieser Basis werden die Besonderheiten des Dienstleistungscontrolling (DLC) erläutert.
- Systematischer Vergleich zwischen den Zielen/Aufgaben des DLC mit dem Controlling von Sachleistungen: Hier wird ein systematischer Vergleich der Ziele und Aufgaben des Dienstleistungscontrolling mit dem Controlling von Sachleistungen anhand der vier wesentlichen Controllingaufgaben (Planungs-, Koordinations-, Kontroll- und Informationsaufgaben) durchgeführt.
- Besonderheiten des DLC: Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen des Dienstleistungscontrolling im Detail, insbesondere im Kontext von Kapazitäts-, Personal- und Qualitätscontrolling.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Dienstleistungen, Dienstleistungscontrolling, Kapazitätscontrolling, Personalcontrolling, Qualitätscontrolling und den Vergleich von Dienstleistungen mit Sachleistungen im Kontext des Controllings.
Häufig gestellte Fragen
Warum gewinnt Dienstleistungscontrolling (DLC) an Bedeutung?
Durch den strukturellen Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft benötigen Unternehmen spezielle Instrumente, um die Immaterialität und Komplexität von Services wirtschaftlich zu steuern.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Dienstleistungs- und Sachleistungs-Controlling?
Unterschiede ergeben sich vor allem aus der Immaterialität, der Beteiligung des Kunden (Integrativität) und der fehlenden Lagerfähigkeit von Dienstleistungen.
Welche spezifischen Controlling-Bereiche werden im Text vertieft?
Die Arbeit behandelt insbesondere das Kapazitäts-, Personal- und Qualitätscontrolling im Dienstleistungskontext.
Was ist das Ziel des Controllings in beiden Unternehmensformen?
Das grundsätzliche Ziel ist die Unterstützung und Koordination kundenbezogener Aktivitäten im Hinblick auf deren Wirtschaftlichkeit.
Welche Rolle spielt die Verhaltensunsicherheit im DLC?
Da Dienstleistungen oft Interaktionen zwischen Menschen erfordern, ist die Steuerung der Verhaltensunsicherheit zwischen Anbieter und Nachfrager eine zentrale Herausforderung.
- Citar trabajo
- Dipl.-Ing. Marc Weiner (Autor), 2006, Controlling von Dienst- vs. Controlling von Sachleistungen: eine vergleichende Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65584