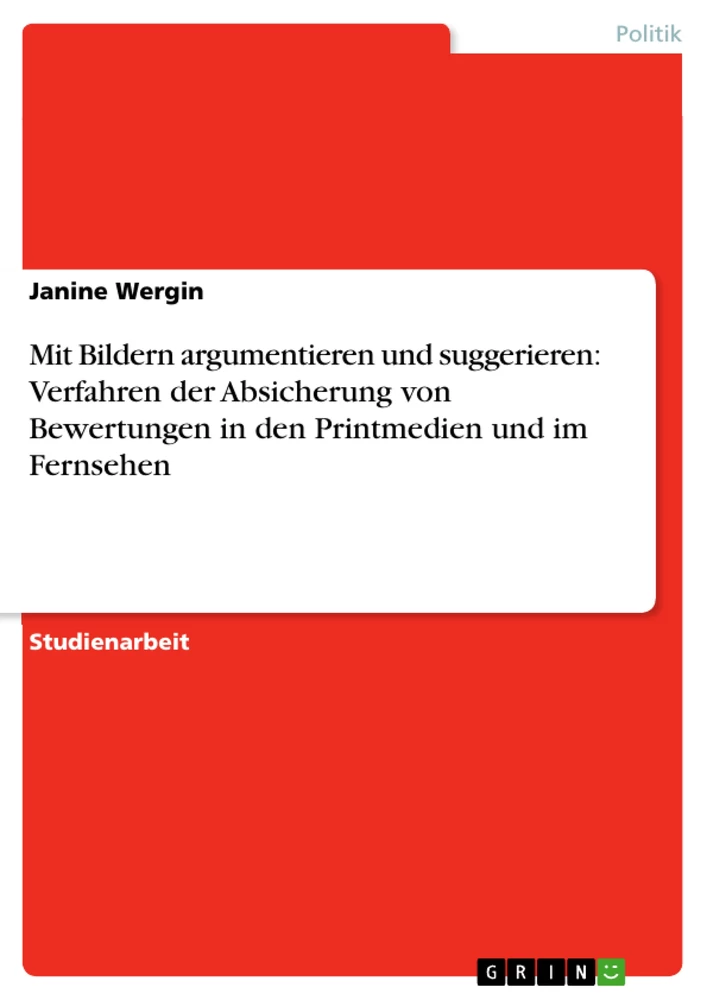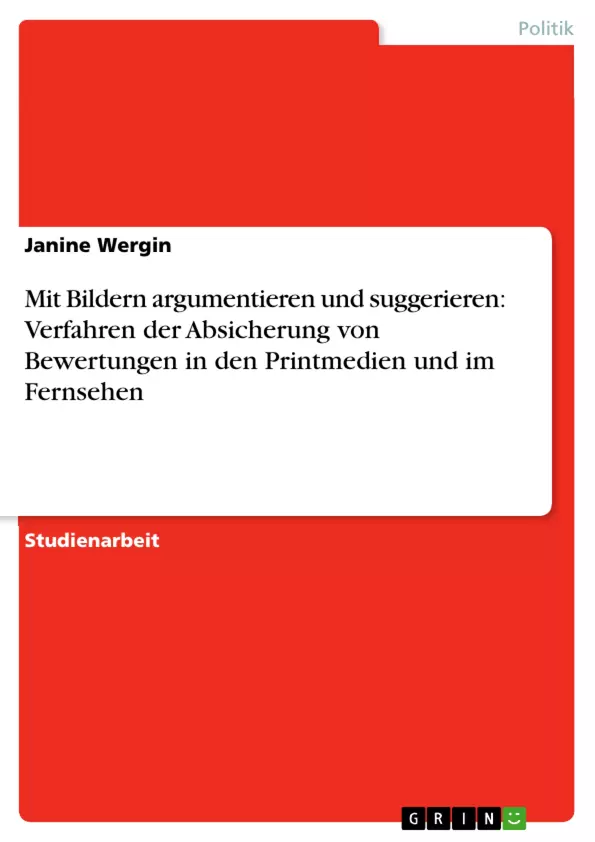Gegenüber der traditionellen Buch- und Zeitungskultur erscheint die heutige Medienöffentlichkeit als „bildlastig“, wenn nicht als „bilddominiert“. Sie wird gemäß Werner Holly beherrscht vom „Bildmedium“ Fernsehen und einer optisch immer aufwändiger gestalteten (Boulevard-)Presse. Bilder dienen zur Stützung von Bewertungen. Diese Arbeit führt anhand von Beispielen aus den Printmedien und dem Fernsehen vor, wie in den Massenmedien mit Bildern argumentiert und suggeriert wird. Die Analyse verdeutlicht, dass die Redewendung „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ nicht zutrifft, wenn es um einen Vergleich der möglichen Absicherungsverfahren von Bewertungen in Sprache und Bild geht. Die Kraft der Bilder zeigt sich vor allem bei irrationalen, suggestiven Verfahren. Bei rationalen, argumentativen Verfahren weist das Bild deutliche Defizite gegenüber der Sprache auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Untersuchungsgegenstand
- 2. Allgemeine Typologisierung
- 3. Das Verhältnis zwischen Bild und Text
- 4. Absicherungsverfahren für Bewertungen in der Dimension des Bildes
- 4.1 Bildmotivik
- 4.2 Bildtechnik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verfahren, mit denen Bilder in Printmedien und im Fernsehen zur Stützung von Bewertungen eingesetzt werden. Ziel ist es, die Effektivität von Bildstrategien im Vergleich zu sprachlichen Argumentationsmethoden zu analysieren und dabei den Unterschied zwischen rationalen und irrationalen, suggestiven Verfahren herauszuarbeiten.
- Vergleich sprachlicher und bildlicher Bewertungsabsicherung
- Unterscheidung zwischen argumentativen und suggestiven Bildverfahren
- Analyse der Bildmotivik und -technik als Mittel der Bewertungsunterstützung
- Die Rolle von Bildern in der politischen Kommunikation
- Spezifische Anwendung von Bildstrategien in Printmedien und Fernsehen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Untersuchungsgegenstand: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt den Wandel der Medienlandschaft hin zu einer „bildlastigen“ Öffentlichkeit. Es wird die Bedeutung von Bildern zur Stützung von Bewertungen erläutert und der Fokus auf Printmedien und Fernsehen gelegt. Der Autor begründet die Auswahl dieser Medien und erklärt die Ausklammerung des Internets und des Hörfunks. Die Arbeit grenzt sich von bestehenden Forschungsarbeiten ab, insbesondere von Kleins Aufsatz aus dem Jahr 1994, und kündigt eine detaillierte Untersuchung der Bilddimension an, die über Kleins Arbeit hinausgeht.
2. Allgemeine Typologisierung: Das Kapitel befasst sich mit der Typologie der Verfahren zur Absicherung von Bewertungen. Es wird die sprachliche Natur von Bewertungen hervorgehoben und die drei Möglichkeiten ihrer Stützung – sprachlich, durch Bilder und durch Ton – beschrieben. Der Autor differenziert zwischen argumentativen (rational, logisch) und suggestiven (irrational) Verfahren. Argumentative Verfahren werden unterteilt in Kategorien wie Bezug auf Regelhaftigkeit, kausale Faktoren, Teilsymptome und Analogien. Suggestive Verfahren beinhalten hingegen Strategien wie das Präsentieren von Sympathieträgern, das Setzen von Atmosphäre und das Kontrastieren oder Hervorheben von Inhalten. Der Autor betont den fließenden Übergang zwischen diesen Verfahren.
Schlüsselwörter
Bild, Bewertung, Medien, Printmedien, Fernsehen, Argumentation, Suggestion, Bildmotivik, Bildtechnik, politische Kommunikation, Absicherungsverfahren, Typologisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Verfahren der Bildlichen Bewertungsabsicherung in Printmedien und Fernsehen
Was ist der Untersuchungsgegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Bilder in Printmedien und im Fernsehen eingesetzt werden, um Bewertungen zu stützen. Sie analysiert die Effektivität von Bildstrategien im Vergleich zu sprachlichen Argumentationsmethoden und unterscheidet zwischen rationalen und irrationalen, suggestiven Verfahren. Der Fokus liegt auf Printmedien und Fernsehen; Internet und Hörfunk werden explizit ausgeschlossen. Die Arbeit baut auf bestehenden Forschungsarbeiten auf, geht aber in der detaillierten Untersuchung der Bilddimension über diese hinaus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Effektivität von Bildstrategien im Vergleich zu sprachlichen Argumentationsmethoden zu analysieren und den Unterschied zwischen rationalen und irrationalen, suggestiven Verfahren herauszuarbeiten. Konkret werden der Vergleich sprachlicher und bildlicher Bewertungsabsicherung, die Unterscheidung zwischen argumentativen und suggestiven Bildverfahren sowie die Analyse der Bildmotivik und -technik als Mittel der Bewertungsunterstützung untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Vergleich sprachlicher und bildlicher Bewertungsabsicherung; Unterscheidung zwischen argumentativen und suggestiven Bildverfahren; Analyse der Bildmotivik und -technik als Mittel der Bewertungsunterstützung; die Rolle von Bildern in der politischen Kommunikation; und die spezifische Anwendung von Bildstrategien in Printmedien und Fernsehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 führt in den Untersuchungsgegenstand ein; Kapitel 2 befasst sich mit einer allgemeinen Typologisierung von Verfahren zur Absicherung von Bewertungen; Kapitel 3 analysiert das Verhältnis zwischen Bild und Text; Kapitel 4 untersucht Absicherungsverfahren für Bewertungen in der Dimension des Bildes (Bildmotivik und -technik); und Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Typologisierung von Bewertungsabsicherungsverfahren wird verwendet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen sprachlicher, bildlicher und tonaler Stützung von Bewertungen. Innerhalb der bildlichen Stützung werden argumentative (rational, logisch) und suggestive (irrational) Verfahren unterschieden. Argumentative Verfahren werden weiter in Kategorien wie Bezug auf Regelhaftigkeit, kausale Faktoren, Teilsymptome und Analogien unterteilt. Suggestive Verfahren umfassen Strategien wie das Präsentieren von Sympathieträgern, das Setzen von Atmosphäre und das Kontrastieren oder Hervorheben von Inhalten. Der Übergang zwischen diesen Verfahren wird als fließend beschrieben.
Was wird im Kapitel über das Verhältnis zwischen Bild und Text behandelt?
Das Kapitel 3, das das Verhältnis zwischen Bild und Text behandelt, wird im bereitgestellten Auszug nicht detailliert beschrieben. Weitere Informationen sind aus dem Volltext der Arbeit zu entnehmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bild, Bewertung, Medien, Printmedien, Fernsehen, Argumentation, Suggestion, Bildmotivik, Bildtechnik, politische Kommunikation, Absicherungsverfahren, Typologisierung.
- Quote paper
- Janine Wergin (Author), 2006, Mit Bildern argumentieren und suggerieren: Verfahren der Absicherung von Bewertungen in den Printmedien und im Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65590