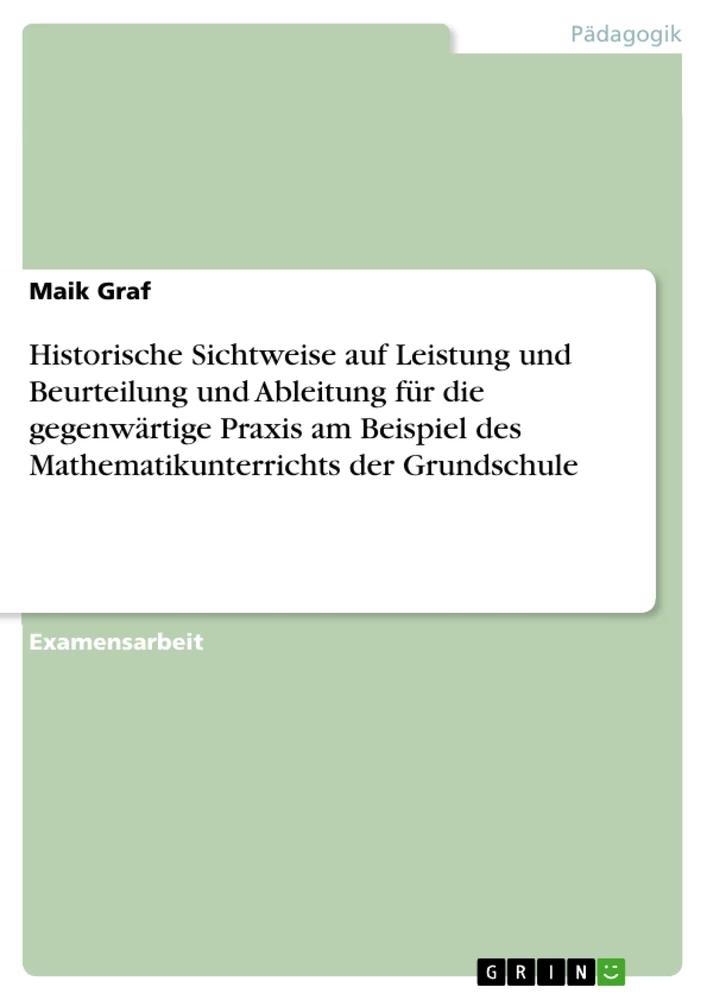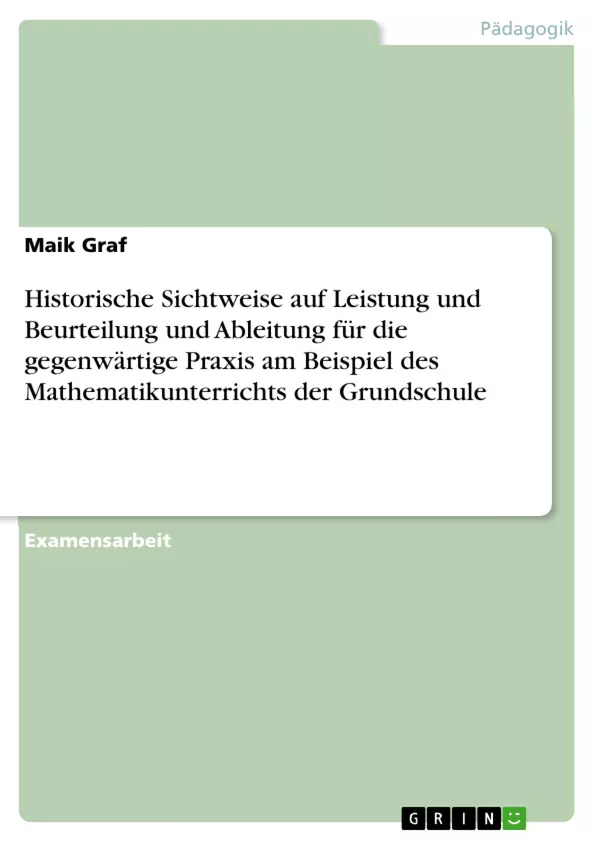Wir leben in einem sozialen Gefüge, welches sich selber den Titel einer Leistungsgesellschaft auferlegt. Leistung wird dabei zu einem höchst differenzierenden Mittel, das perspektivisch eine sehr große Tragweite für das gesamte Leben haben kann. Bisher war Schule der stille Lieferant für diese geforderten Kompetenzen. Doch spätestens seit PISA rückt die Schule wieder ins Visier einer breiten Öffentlichkeit, die plötzlich ein viel stärkeres Interesse an Bildungsfragen hat, denn der internationale Vergleich der zukünftigen Leistungsträger und das formal nicht so gute Abschneiden, werfen ein negativen Schatten auf dieses Land und sein Eigenverständnis. Es wird der Ruf nach Reformen laut, und alles muss sich schnellstmöglich an den nun nachgewiesen Besten orientieren, um schnell wieder die Schatten zu erhellen. Die Schule wird reformiert, ein Prozess der so nicht ungewöhnlich, doch in diesem Fall sehr einseitig ausgerichtet ist. Ziel ist Leistung und Kompetenz zu produzieren und dies unter dem sich nun regelmäßig wiederholenden Vergleichsmittel PISA.
Was macht aber Leistung in der Schule aus? Was bedeutet eine Note für einen Schüler wirklich? Was verbirgt sich hinter dem schulischen Leistungsbegriff und ist dieser überhaupt in Einklang mit den Wünschen der Gesellschaft zu bringe? Diese Fragen sollen im Folgenden näher ergründet werden. Dabei führt der Blick als erstes zurück in die Vergangenheit und beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Zeugnisses und der Zensur. Es soll im Weiteren versucht werden, die Beurteilungspraxis näher zu beschreiben, um darüber auch mögliche Schwächen herauszufiltern. Die aktuelle Schulsituation soll schließlich am Beispiel des Mathematikunterrichtes der Grundschule aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Funktion der Schule aus gesellschaftlicher Sicht
- Die Geschichte des Zeugnisses
- Das Benefizienzeugnis
- Das Reifezeugnis
- Das Abgangszeugnis
- Das periodische Zeugnis
- Die Entstehungsgeschichte der Zensur
- Die Zensur im schulischen Kontext
- Zusammenfassung unter der Betrachtung der Entwicklung von unterschiedlichen Funktionen des Zeugnisses und der Zensur
- Die Orientierungs- und Berichtfunktion
- Die pädagogische Funktion
- Die Zeugnisregelung in der Bundesrepublik und in Sachsen
- § 19 Halbjahresinformationen
- § 20 Jahreszeugnisse
- § 21 Bildungsempfehlung
- Leistung
- Leistung im Kontext Schule
- Leistung als Prinzip der Gesellschaft
- Ansatz eines pädagogischen Leistungsbegriffes
- Leistung mit produkt- und prozessorientiertem Charakter
- Leistung in der Schule bedeutet individuelles und zugleich soziales Lernen
- Leistung als problemmotiviertes Prinzip
- Leistung als norm- und zweckbezogenes Mittel der Schule
- Die Schulleistung unterliegt stets einer Eigen- und Fremdbewertung
- Anerkennung und Ermutigung über den Leistungsbegriff
- Zusammenfassung
- Die Qualität von Leistungsbeurteilung
- Die Bezugnormenfindung
- Die subjektorientierte (individuelle) Bezugsnorm
- Die lernzielorientierte (sachliche) Bezugsnorm
- Die vergleichsorientierte (soziale) Bezugsnorm
- Zusammenfassung unter Berücksichtigung der pädagogischen Umsetzung
- Die Bezugnormenfindung
- Gütekriterien der Qualitätssicherung von Messergebnissen
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Urteilsfehler
- Der Hof- oder Haloeffekt
- Der Erwartungseffekt (Pygmalioneffekt)
- Die unterschiedlichen Beurteilungstendenzen
- Der Projektionsfehler
- Zusammenfassung unter Berücksichtigung des Wunsches, die Note als exaktes Instrument zu sehen
- Die Kritik an der Zensur: Zwei Begründungen
- Die aktuelle Beurteilungspraxis im Fach Mathematik -Anforderungen an die moderne Grundschule-
- Begriffdifferenzierung von Leistungsbeurteilung und Leistungsbewertung
- Leistungsbeurteilung
- Leistungsbewertung
- Leistungsbegriff im aktuellen Mathematikunterricht
- Formen der Leistungsmessung im Mathematikunterricht der Grundschule
- Die mündliche Leistungsmessung
- Durchführung von mündlichen Leistungsmessungen
- Die Klassenarbeit
- Erarbeiten einer Klassenarbeit für die Grundschule
- Durchführung einer Klassenarbeit
- Bewertung einer Klassenarbeit
- Die mündliche Leistungsmessung
- Zusammenfassung
- Begriffdifferenzierung von Leistungsbeurteilung und Leistungsbewertung
- Die Suche nach Alternativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung von Leistungsmessung und -beurteilung im schulischen Kontext, insbesondere im Mathematikunterricht der Grundschule. Sie analysiert die gesellschaftlichen Funktionen von Zeugnissen und Noten und hinterfragt deren Gütekriterien. Ziel ist es, die aktuelle Praxis zu beleuchten und mögliche Alternativen aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung von Zeugnissen und Zensuren
- Gesellschaftliche Funktionen von Leistungsmessung
- Gütekriterien und mögliche Fehlerquellen bei der Leistungsbeurteilung
- Der Leistungsbegriff im Mathematikunterricht der Grundschule
- Alternativen zur traditionellen Zensur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext der Leistungsgesellschaft und die Bedeutung von Schulnoten. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor und skizziert den Aufbau.
Die Funktion der Schule aus gesellschaftlicher Sicht: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Schule in der Gesellschaft, die Anforderungen an die Schüler und die Erwartungen an das Bildungssystem. Es wird beleuchtet, wie die Schule als Institution auf die gesellschaftlichen Erwartungen reagiert und wie diese sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Die Geschichte des Zeugnisses: Hier wird die historische Entwicklung verschiedener Zeugnisformen (Benefizien-, Reife-, Abgangs-, periodische Zeugnisse) detailliert nachgezeichnet. Der Wandel der Zeugnisformen spiegelt die Entwicklung der gesellschaftlichen Anforderungen und pädagogischen Konzepte wider und liefert einen wichtigen Kontext für das Verständnis der heutigen Beurteilungspraktiken.
Die Entstehungsgeschichte der Zensur: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der Zensur im schulischen Kontext. Es analysiert die verschiedenen Funktionen der Zensur, ihre Veränderungen im Laufe der Zeit und die damit verbundenen pädagogischen Implikationen. Der Fokus liegt dabei auf dem Wandel der Funktion der Zensur, von rein administrativen Zwecken hin zu komplexeren pädagogischen Aspekten.
Die Zeugnisregelung in der Bundesrepublik und in Sachsen: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen der Zeugniserteilung in Deutschland und Sachsen. Die Analyse der gesetzlichen Regelungen bietet einen wichtigen Einblick in die formalen Aspekte der Leistungsbeurteilung und deren rechtliche Grundlagen.
Leistung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem vielschichtigen Begriff "Leistung" selbst. Es werden verschiedene Dimensionen von Leistung beleuchtet, sowohl im Kontext der Schule als auch in der Gesellschaft. Es wird ein pädagogischer Leistungsbegriff entwickelt, der sowohl produkt- als auch prozessorientierte Aspekte berücksichtigt und individuelle sowie soziale Lernprozesse einbezieht.
Die Qualität von Leistungsbeurteilung: Hier werden die verschiedenen Bezugnormen (individuell, sachlich, sozial) bei der Leistungsbeurteilung analysiert und ihre Auswirkungen auf die Beurteilungspraxis diskutiert. Der Fokus liegt auf den pädagogischen Implikationen der verschiedenen Bezugnormen und deren praktische Umsetzung.
Gütekriterien der Qualitätssicherung von Messergebnissen: Dieses Kapitel erläutert die wichtigsten Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) für die Qualitätssicherung von Leistungsbeurteilungen. Die Diskussion dieser Kriterien dient dazu, die Genauigkeit und Fairness von Leistungsbeurteilungen zu beurteilen.
Urteilsfehler: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Urteilsfehler (Halo-Effekt, Erwartungseffekt, Beurteilungstendenzen, Projektionsfehler), die bei der Leistungsbeurteilung auftreten können. Es wird untersucht, wie diese Fehler die Objektivität und Fairness von Beurteilungen beeinträchtigen können.
Die Kritik an der Zensur: Zwei Begründungen: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert verschiedene Kritikpunkte an der traditionellen Zensur, die die Problematik des Notenystems beleuchten und alternative Bewertungsansätze motivieren.
Die aktuelle Beurteilungspraxis im Fach Mathematik -Anforderungen an die moderne Grundschule-: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Praxis der Leistungsbeurteilung im Mathematikunterricht der Grundschule. Es differenziert zwischen Leistungsbeurteilung und -bewertung und analysiert verschiedene Formen der Leistungsmessung (mündlich, schriftlich).
Schlüsselwörter
Leistungsbeurteilung, Leistungsbewertung, Zeugnis, Zensur, Mathematikunterricht, Grundschule, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität, Bezugsnorm, Urteilsfehler, historische Entwicklung, gesellschaftliche Funktionen, pädagogischer Leistungsbegriff, Alternativen zur Zensur.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Leistungsbeurteilung im Mathematikunterricht der Grundschule
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert die historische Entwicklung, die gesellschaftlichen Funktionen und die Gütekriterien von Leistungsmessung und -beurteilung im schulischen Kontext, insbesondere im Mathematikunterricht der Grundschule. Es beleuchtet die aktuelle Praxis und mögliche Alternativen zur traditionellen Zensur.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt eine breite Palette an Themen, darunter die historische Entwicklung von Zeugnissen und Zensuren, die gesellschaftlichen Funktionen von Leistungsmessung, Gütekriterien und mögliche Fehlerquellen bei der Leistungsbeurteilung, den Leistungsbegriff im Mathematikunterricht der Grundschule sowie Alternativen zur traditionellen Zensur. Es beinhaltet auch eine detaillierte Betrachtung verschiedener Bezugnormen und Urteilsfehler.
Welche Arten von Zeugnissen werden im historischen Kontext betrachtet?
Der historische Überblick umfasst Benefizienzeugnisse, Reifezeugnisse, Abgangszeugnisse und periodische Zeugnisse, um den Wandel der Zeugnisformen und der gesellschaftlichen Anforderungen im Laufe der Zeit aufzuzeigen.
Welche Funktionen der Zensur werden analysiert?
Das Dokument analysiert die Zensur unter verschiedenen Aspekten, einschließlich ihrer Orientierungs- und Berichtfunktion sowie ihrer pädagogischen Funktion. Es untersucht, wie sich diese Funktionen im Laufe der Zeit verändert haben.
Welche gesetzlichen Regelungen zur Zeugniserteilung werden behandelt?
Das Dokument beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen der Zeugniserteilung in Deutschland und speziell in Sachsen, unter Bezugnahme auf relevante Paragraphen (§19 Halbjahresinformationen, §20 Jahreszeugnisse, §21 Bildungsempfehlung).
Wie wird der Begriff "Leistung" definiert und differenziert?
Das Dokument entwickelt einen pädagogischen Leistungsbegriff, der sowohl produkt- als auch prozessorientierte Aspekte berücksichtigt und individuelle sowie soziale Lernprozesse einbezieht. Es unterscheidet auch zwischen Leistungsbeurteilung und Leistungsbewertung.
Welche Bezugnormen werden bei der Leistungsbeurteilung betrachtet?
Die Analyse umfasst subjektorientierte (individuelle), lernzielorientierte (sachliche) und vergleichsorientierte (soziale) Bezugnormen und deren Auswirkungen auf die Beurteilungspraxis.
Welche Gütekriterien für die Qualitätssicherung werden erläutert?
Die zentralen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität werden im Detail erläutert und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Genauigkeit und Fairness von Leistungsbeurteilungen diskutiert.
Welche Urteilsfehler werden im Dokument beschrieben?
Das Dokument beschreibt den Hof- oder Haloeffekt, den Erwartungseffekt (Pygmalioneffekt), unterschiedliche Beurteilungstendenzen und den Projektionsfehler sowie deren Einfluss auf die Objektivität der Leistungsbeurteilung.
Welche Kritikpunkte an der traditionellen Zensur werden genannt?
Das Dokument präsentiert und analysiert verschiedene Kritikpunkte an der traditionellen Zensur, um die Problematik des Noten-Systems aufzuzeigen und alternative Bewertungsansätze zu motivieren.
Wie wird die aktuelle Beurteilungspraxis im Mathematikunterricht der Grundschule dargestellt?
Das Dokument beschreibt die aktuelle Praxis der Leistungsbeurteilung im Mathematikunterricht der Grundschule, differenziert zwischen Leistungsbeurteilung und -bewertung und analysiert verschiedene Formen der Leistungsmessung (mündlich, schriftlich, Klassenarbeiten).
Welche Alternativen zur traditionellen Zensur werden vorgeschlagen?
Das Dokument skizziert die Suche nach Alternativen zur traditionellen Zensur, ohne konkrete Alternativen im Detail vorzustellen. Es dient als Aufhänger für weitere Diskussionen.
- Quote paper
- Maik Graf (Author), 2006, Historische Sichtweise auf Leistung und Beurteilung und Ableitung für die gegenwärtige Praxis am Beispiel des Mathematikunterrichts der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65649