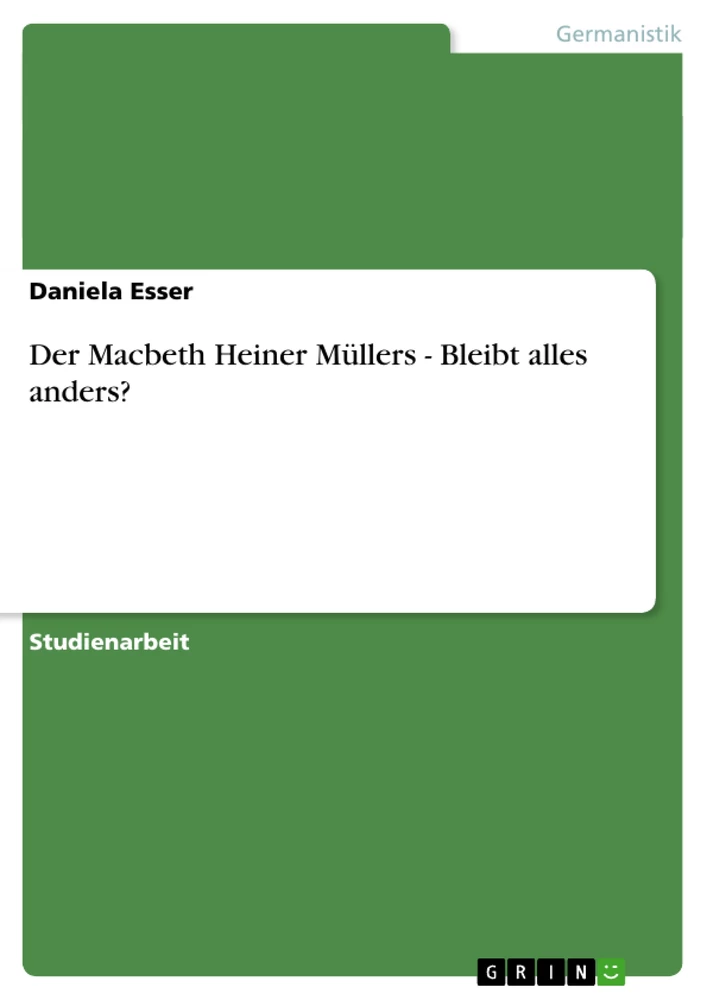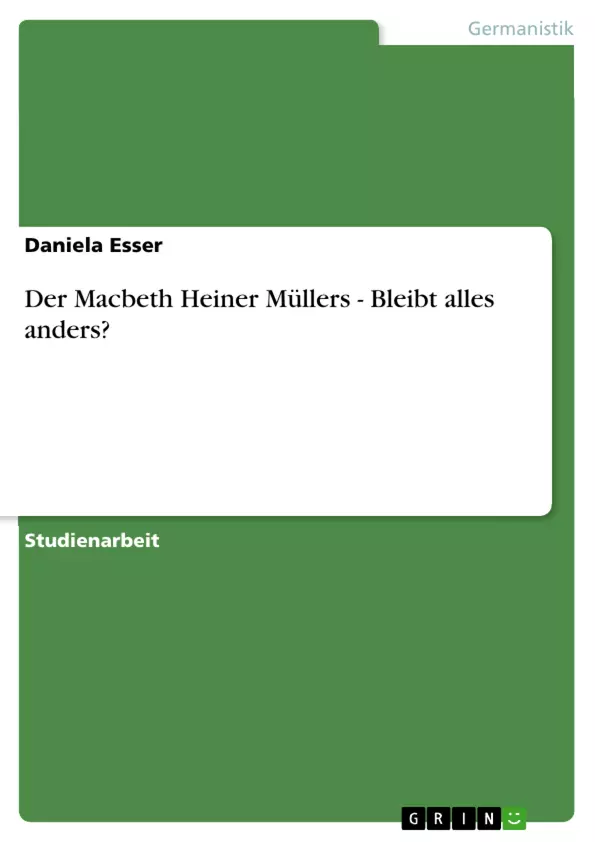In Shakespeares Macbeth wird direkt in der ersten Szene das Thema von der Umkehr aller Werte formuliert; die Welt des Grauenhaften, Dämonischen tritt dem Zuschauer/Leser entgegen durch das Treffen der drei Hexen. Diese Hexen standen in der elisabethanischen Weltordnung für das Böse. Ebenso ist der Aufruhr in der Natur eine Metapher für das Böse, die im Drama immer wieder auftaucht.
Heiner Müller dagegen beginnt seinen Macbeth mit der ursprünglichen zweiten Szene und setzt damit die Hexen sowie den Aufruhr in der Natur aus gutem Grund nicht als Ausgangspunkt des Übels. Es geht ihm darum, ein Machtspiel als Zyklus darzustellen und er integriert dabei das auf grausame Weise unterdrückte Volk. Müllers Stück beschreibt im Gegensatz zum linearen Tragödienmodell Shakespeares eine "dramaturgische Kreisform, die am Ende alles wieder auf Anfang stellt." Da Müller die "Monstrosität der geschilderten Verhältnisse als unaufgehobene Signatur eines Weltganzen [zeigt]" , wurde ihm Geschichtspessimismus vorgeworfen; seine Bearbeitung des Macbeth wurde sogar als Verirrung bezeichnet.
Lehmann argumentiert, das Drama beschreibe "Geschichte im Stillstand" und untersuche, unter welchen Bedingungen Geschichte stockt. Die Beschreibung des Dramas als Geschichte im Stillstand zeigt eine deutliche Parallele zu Kotts Interpretation der Shakespeareschen Königsdramen, nämlich daß die Feudalgeschichte als "Großer Mechanismus" dargestellt sei. Die Feudalgeschichte bei Shakespeare "ist eine große Treppe, über die ununterbrochen der Zug der Könige schreitet. Jede Stufe, jeder Schritt nach oben ist von Mord, Treubruch oder Verrat gezeichnet." Allerdings, räumt Kott ein, sei der Große Mechanismus nicht auf Shakespeares Macbeth anwendbar. Zu der von Müller gezeigten Geschichte im Stillstand in seiner Macbeth-Bearbeitung hingegen paßt die Interpretation der Geschichte als Großer Mechanismus sehrwohl.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Die Welt hat keinen Ausgang als zum Schinder“ – Die Gewalt, das Irreale und Geschichte als Zyklus
- Die Gewalt als grauenhafte Realität
- Das Irreale
- Macbeth im „Räderwerk des blutigen Geschichtslaufs“: Geschichte im Stillstand
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Heiner Müllers Macbeth-Bearbeitung im Kontext von Shakespeares Vorlage und untersucht die Veränderung des ursprünglichen Stoffes in der Inszenierung der Gewalt, des Irrationalen und der Geschichtsschreibung.
- Vergleich der Gewalt in Müllers und Shakespeares Macbeth
- Das Irreale und seine Rolle im Stück
- Die Interpretation von Geschichte als Zyklus
- Kritik am Geschichtspessimismus in Müllers Werk
- Die Figur Macbeths als Produkt und Repräsentant einer grausamen Sozialordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Unterschiede zwischen Shakespeares und Müllers Macbeth-Versionen dar.
Das zweite Kapitel analysiert die Darstellung von Gewalt, Irrationalität und Geschichte in Müllers Macbeth. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Gewalt als ein zirkuläres Prinzip, das Macbeth gefangen hält.
Schlüsselwörter
Heiner Müller, Shakespeare, Macbeth, Gewalt, Irreale, Geschichte, Zyklus, Machtspiel, Geschichtspessimismus, Königsmord, Sozialordnung, Tragödie.
- Quote paper
- Daniela Esser (Author), 2000, Der Macbeth Heiner Müllers - Bleibt alles anders?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6572