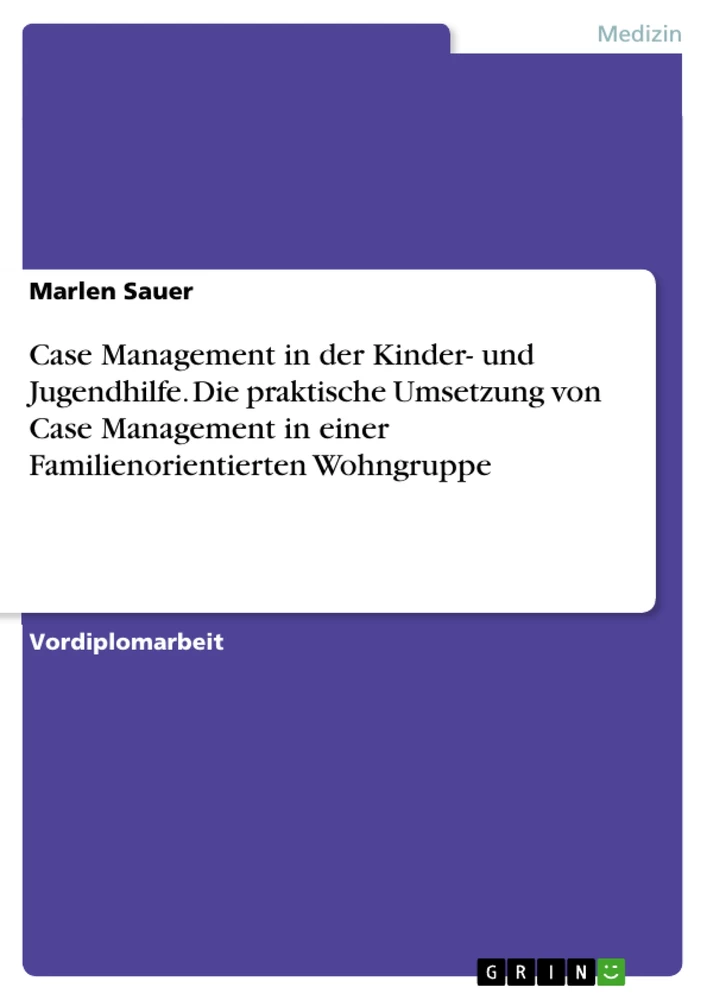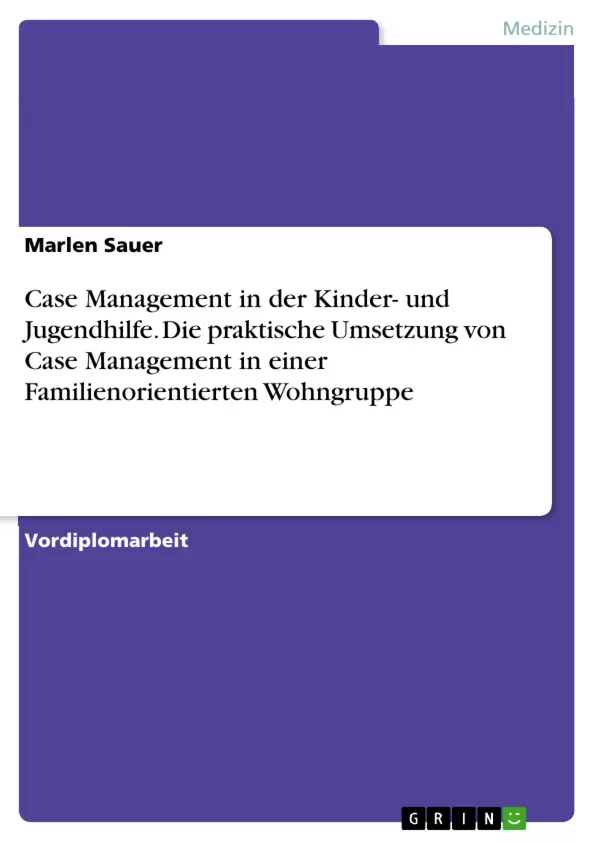Im Rahmen der Vorlesung „Soziale Einzelhilfe“ des Bereiches Sozialarbeit/Sozialpädagogik habe ich mit anderen Kommilitonen ein Referat über das Thema „Case Management“ gehalten. Dieses Thema fand ich sehr interessant. Natürlich kannte ich das Hilfeplanverfahren in der Kinder- und Jugendhilfe schon aus meinen Praxisphasen. Bis dahin wusste ich aber noch nicht, dass es für den gesamten Hilfeprozess theoretische Grundlagen und fundierte Literatur für dieses Verfahren gibt. Nachdem ich durch das Referat mehr zum Case Management erfahren hatte, nahm ich die Abläufe zum Hilfegeschehen eines Klienten meiner Praxiseinrichtung bewusst wahr. Nun interessierte es mich, wie genau das theoretische Basiswissen auf die Praxis übertragbar ist und inwieweit sich Theorie und Praxis überschneiden.
Zu Anfang des dritten Semesters der Praxisphase nahm die Einrichtung zwei Kinder auf. Zuerst sollte ich gemeinsam mit einem Kollegen die Kinder als Bezugserzieher betreuen. Später ergab sich, dass ich für beide Kinder der Ansprechpartner und alleinige Bezugserzieher bin. In meinen Theoriephasen wurden die Kinder von einer Kollegin weiter betreut. Da ich nun die Rolle der Bezugserzieherin übernahm, ergaben sich für mich mehrere Aufgaben, die ich bis dahin noch nicht selbst ausgeführt hatte. Und als Bezugserzieherin identifiziert man sich teilweise mit der Rolle und den Funktionen eines Casemanagers.
Somit ergab sich die optimale Gelegenheit, mein theoretisches Wissen aus dem Studium auf die Praxis zu übertragen. Die Ziele des Reflexionsberichtes sind nun vielseitig. Vor allem möchte ich anhand des Fallbeispiels meine Tätigkeiten in der Einrichtung aufzeigen und meine gewonnenen pädagogischen Fähigkeiten darstellen. Das Fallbeispiel, mein Einsatz als Bezugserzieherin im dritten und vierten Semester und dessen Beschreibung, in Bezug auf den Hilfeprozess nehmen den größeren Teil des Berichtes ein. Anfangs möchte ich das theoretische Wissen mit Hilfe von Literatur zum Thema Case Management aufzeigen, insbesondere werde ich die Phasen des Verfahrens, wie sie in der Fachliteratur optimal beschrieben werden, darstellen. Anschließend beschreibe und stelle ich dar, anhand eines Fallbeispiels aus der Familienorientierten Wohngruppe, wie meine Tätigkeit als Bezugserzieher aussieht. Ich möchte den gesamten realen Hilfeprozess in einzelne Aspekte aufspalten und diese richtig in die Phasen des Case Managements einordnen bzw. zuordnen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung der Themenwahl und Ziele
- Case Management in der Literatur - Ablauf und Phasen
- "outreach" – Vorabklärung
- "assessment" – Einschätzung und Bedarfsklärung
- "planning" – Zielvereinbarung und Hilfeplanung
- "intervention" - Durchführung
- "monitoring" – Kontrolle und Überwachung
- "evaluation" – Bewertung und Auswertung
- "disengagement" - Entpflichtung
- Verfahren des Case Management am Fallbeispiel
- Kurzvorstellung der Einrichtung – "Familienorientierte Wohngruppe"
- Ablauf des Case Management am Fallbeispiel
- "outreach" - Vorabklärung
- "assessment" - Einschätzung und Bedarfsklärung
- "planning" – Zielvereinbarung und Hilfeplan
- "intervention" - Durchführung
- "monitoring" – Kontrolle und Überwachung
- "evaluation" - Bewertung und Auswertung
- Reflexion und alternatives Vorgehen
- zyklische Wiederholungen der Phasen
- Reflexion positiver Aspekte
- Reflexion veränderbarer Aspekte
- Abschließende Bemerkung
- Quellenverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Arbeit „Case Management in der Kinder- und Jugendhilfe“ befasst sich mit der praktischen Umsetzung von Case Management in einer Familienorientierten Wohngruppe. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse und Reflexion des Hilfeprozesses anhand eines konkreten Fallbeispiels. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Case Management mit der Praxis zu verknüpfen und die Übertragbarkeit der Theorie auf den praktischen Arbeitsalltag zu untersuchen.
- Die einzelnen Phasen des Case Management in der Literatur
- Die konkrete Anwendung des Case Management in einer Familienorientierten Wohngruppe
- Die Analyse des Hilfeprozesses anhand eines Fallbeispiels
- Die Reflexion der eigenen Tätigkeit als Bezugserzieherin im Kontext des Case Management
- Die Herausforderungen und Chancen der praktischen Umsetzung des Case Management
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Case Management in der Kinder- und Jugendhilfe ein und beschreibt die Motivation und Ziele der Arbeit. Sie stellt den Kontext des Fallbeispiels vor, das im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert wird. Das zweite Kapitel befasst sich mit der theoretischen Basis des Case Management. Es werden die einzelnen Phasen des Verfahrens – "outreach", "assessment", "planning", "intervention", "monitoring", "evaluation" und "disengagement" – ausführlich erläutert und ihre Funktionen im Hilfeprozess beschrieben. Das dritte Kapitel widmet sich der konkreten Anwendung des Case Management in der Familienorientierten Wohngruppe. Anhand des Fallbeispiels wird der gesamte Hilfeprozess in die einzelnen Phasen des Case Management eingeordnet und die konkrete Umsetzung des Verfahrens in der Praxis dargestellt. In der Reflexion und dem alternativen Vorgehen im vierten Kapitel wird die eigene Tätigkeit als Bezugserzieherin im Kontext des Case Management reflektiert. Dabei werden sowohl positive Aspekte als auch veränderbare Punkte des Hilfeprozesses beleuchtet.
Schlüsselwörter
Case Management, Kinder- und Jugendhilfe, Familienorientierte Wohngruppe, Hilfeplanung, Bezugserzieherin, Hilfeprozess, "outreach", "assessment", "planning", "intervention", "monitoring", "evaluation", "disengagement", Reflexion, Praxis, Theorie.
- Quote paper
- Marlen Sauer (Author), 2005, Case Management in der Kinder- und Jugendhilfe. Die praktische Umsetzung von Case Management in einer Familienorientierten Wohngruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65781