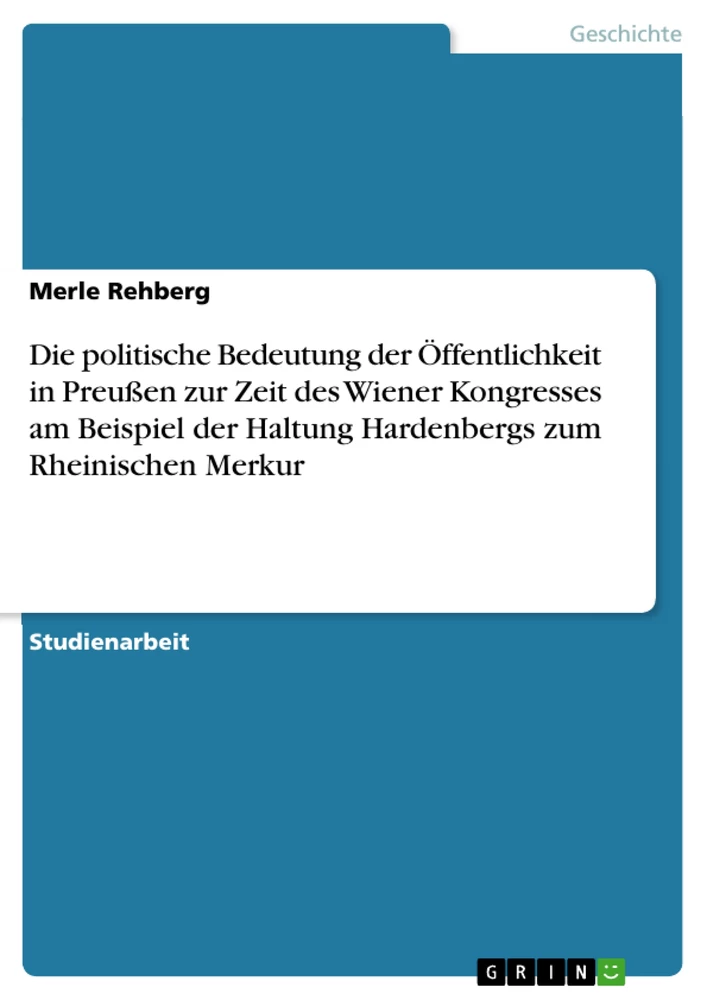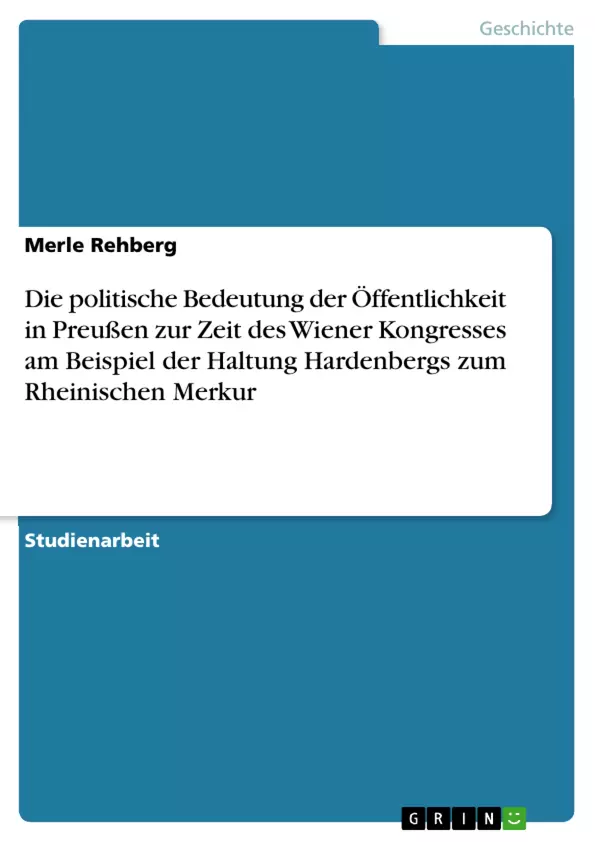Bei der Durchsicht der vorhandenen Literatur zur Öffentlichkeit in Preußen im frühen 19. Jahrhundert fällt die überwältigende Anzahl von Schriften betreffend den Fürsten von Hardenberg auf. Bei einer näheren Betrachtung wird der Grund hierfür in einer offenbar allgemein geteilten Auffassung ersichtlich: die liberale Haltung des Reformministers ermöglichte in weiten Teilen Preußens ein Maß bürgerlich-politischer Öffentlichkeit und Kommunikation, wie es bis dahin nicht möglich gewesen war. Gerade an Hardenbergs Umgang mit dem politischen Tagesschrifttum wird dies immer wieder gezeigt. Die Frage nach den Gründen für Hardenbergs liberale Haltung wird dabei leider außer Acht gelassen und es bleibt bei der lapidaren Feststellungen einer persönlichen Entscheidung. Diese Begründung kann nicht genügen, denn die Haltung des Staatskanzlers kann nicht allein aus seiner persönlichen liberalen Einstellung heraus erklärt werden, sondern muss auch im Kontext der Zeitereignisse betrachtet werden. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht daher die Frage, inwieweit Hardenberg sich gerade in Bezug auf die politische Tagesliteratur, die preußische Pressefreiheit und Zensur, vielmehr als ein geschickter Stratege darstellt, der die politischen Kräfte zu integrieren und für seine Zwecke zu nutzen suchte und weniger als heroischer „Revolutionär“ und Anwalt der freien Meinungsäußerung. Dies soll am Beispiel seiner Haltung gegenüber dem „Rheinischen Merkur“, wie sie in seinem Schreiben vom 10. Oktober 1814 aus Wien an den rheinischen Zivilgouverneur Sack zum Ausdruck kommt, versucht werden. Diese Arbeit kann außerdem als excellentes Beispiel historischer Quellenkritik gelesen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. "...der Austausch der Gedanken über Gegenstände des Gemeinwohls ..." Hardenbergs Schreiben an Sack vom 10. Oktober 1814
- 2.1 Hardenberg und die preußische Zensur nach den Befreiungskriegen
- 2.2 ... diese Ansicht...“ des Staatskanzlers – Inhalt der Quelle
- 3. Der historische Rahmen
- 3.1 Das napoleonische Erbe: Presse und Öffentlichkeit während der französischen Besatzung und den Befreiungskriegen
- 3.2 Der Rheinische Merkur – Entstehung und Ziele
- 3.3 Hardenberg auf dem Wiener Kongress: Grundzüge seiner Politik
- 4. Einschätzung
- 4.1 Der rheinische Verbündete
- 4.2 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die politische Bedeutung der Öffentlichkeit in Preußen während der Zeit des Wiener Kongresses, anhand von Hardenbergs Haltung zum Rheinischen Merkur. Das Hauptziel ist es, Hardenbergs Vorgehen im Kontext der damaligen Ereignisse zu analysieren und die Frage zu klären, inwieweit er ein geschickter Stratege war, der politische Kräfte zu seinen Gunsten nutzte, anstatt ein Verfechter der freien Meinungsäußerung.
- Hardenbergs politische Strategie und sein Umgang mit der Pressefreiheit
- Der Einfluss der napoleonischen Zeit auf die preußische Öffentlichkeit
- Die Rolle des Rheinischen Merkur in der politischen Landschaft Preußens
- Hardenbergs Position auf dem Wiener Kongress und seine Auswirkungen auf die preußische Politik
- Die Beziehung zwischen Zensur und öffentlicher Meinungsbildung in Preußen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der politischen Bedeutung der Öffentlichkeit im früh-19. Jahrhundert Preußen ein und konzentriert sich auf die scheinbar widersprüchliche Figur Hardenbergs. Sie weist auf die gängige, aber unzureichende Interpretation seiner liberalen Haltung hin und kündigt die Analyse seines Vorgehens als geschickte Strategie statt als heroischen Kampf für Meinungsfreiheit an. Der Fokus liegt auf Hardenbergs Brief an Sack vom 10. Oktober 1814 als zentrale Quelle für die Untersuchung.
2. "...der Austausch der Gedanken über Gegenstände des Gemeinwohls ...": Hardenbergs Schreiben an Sack vom 10. Oktober 1814: Dieses Kapitel analysiert Hardenbergs Brief an Sack im Detail. Es beleuchtet die Beschwerden der württembergischen Regierung über den Rheinischen Merkur und Hardenbergs Antwort, in der er zwar die Wichtigkeit des Austauschs von Gedanken betont, aber gleichzeitig eine maßvolle Sprache des Merkurs fordert. Dieser Abschnitt unterstreicht den Spagat zwischen dem Wunsch nach öffentlicher Meinungsbildung und der Notwendigkeit, politische Stabilität zu wahren.
3. Der historische Rahmen: Dieses Kapitel liefert den historischen Kontext. Es beschreibt das napoleonische Erbe, die Entwicklung der Presse und Öffentlichkeit während der französischen Besatzung und der Befreiungskriege. Weiterhin wird die Entstehung und die Ziele des Rheinischen Merkurs beleuchtet und Hardenbergs Politik auf dem Wiener Kongress skizziert. Dieser Teil etabliert die wichtigen Rahmenbedingungen für das Verständnis von Hardenbergs Handlungen.
Schlüsselwörter
Hardenberg, Preußen, Wiener Kongress, Rheinischer Merkur, Pressefreiheit, Zensur, Öffentlichkeit, politische Strategie, liberale Haltung, Befreiungskriege, napoleonisches Erbe, Tagesliteratur, Meinungsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Hardenbergs Haltung zum Rheinischen Merkur
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die politische Bedeutung der Öffentlichkeit in Preußen während des Wiener Kongresses, anhand von Hardenbergs Haltung zum Rheinischen Merkur. Sie analysiert Hardenbergs Vorgehen im Kontext der damaligen Ereignisse und befragt, inwieweit er ein geschickter Stratege war, der politische Kräfte zu seinen Gunsten nutzte, anstatt ein Verfechter der freien Meinungsäußerung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die zentrale Quelle ist ein Brief Hardenbergs an Sack vom 10. Oktober 1814. Zusätzlich wird der historische Kontext, einschließlich der Entwicklung der Presse und Öffentlichkeit während der napoleonischen Zeit und der Befreiungskriege, sowie die Entstehung und Ziele des Rheinischen Merkurs und Hardenbergs Politik auf dem Wiener Kongress berücksichtigt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse von Hardenbergs Vorgehen im Umgang mit dem Rheinischen Merkur und der Frage nach seiner politischen Strategie. Es geht darum, seine Handlungen im Kontext der damaligen politischen Landschaft zu verstehen und die gängige, aber unzureichende Interpretation seiner liberalen Haltung zu hinterfragen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Hardenbergs politische Strategie und seinen Umgang mit der Pressefreiheit, den Einfluss der napoleonischen Zeit auf die preußische Öffentlichkeit, die Rolle des Rheinischen Merkur, Hardenbergs Position auf dem Wiener Kongress und seine Auswirkungen auf die preußische Politik, sowie die Beziehung zwischen Zensur und öffentlicher Meinungsbildung in Preußen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur detaillierten Analyse von Hardenbergs Brief an Sack, einem Kapitel zum historischen Kontext, und einem abschließenden Kapitel mit Einschätzung und Schlussbemerkung. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt der Rheinische Merkur in der Arbeit?
Der Rheinische Merkur dient als wichtiger Fallbeispiel, um Hardenbergs Umgang mit der Pressefreiheit und öffentlicher Meinungsbildung zu untersuchen. Die württembergischen Beschwerden über den Merkur und Hardenbergs Reaktion bilden den Kern der Analyse.
Wie wird Hardenberg in der Arbeit dargestellt?
Hardenberg wird nicht als einfacher Verfechter der Meinungsfreiheit dargestellt, sondern seine Handlungen werden als Ergebnis einer geschickten politischen Strategie analysiert, die den Spagat zwischen dem Wunsch nach öffentlicher Meinungsbildung und der Notwendigkeit, politische Stabilität zu wahren, beinhaltet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hardenberg, Preußen, Wiener Kongress, Rheinischer Merkur, Pressefreiheit, Zensur, Öffentlichkeit, politische Strategie, liberale Haltung, Befreiungskriege, napoleonisches Erbe, Tagesliteratur, Meinungsfreiheit.
- Arbeit zitieren
- Merle Rehberg (Autor:in), 2006, Die politische Bedeutung der Öffentlichkeit in Preußen zur Zeit des Wiener Kongresses am Beispiel der Haltung Hardenbergs zum Rheinischen Merkur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65904