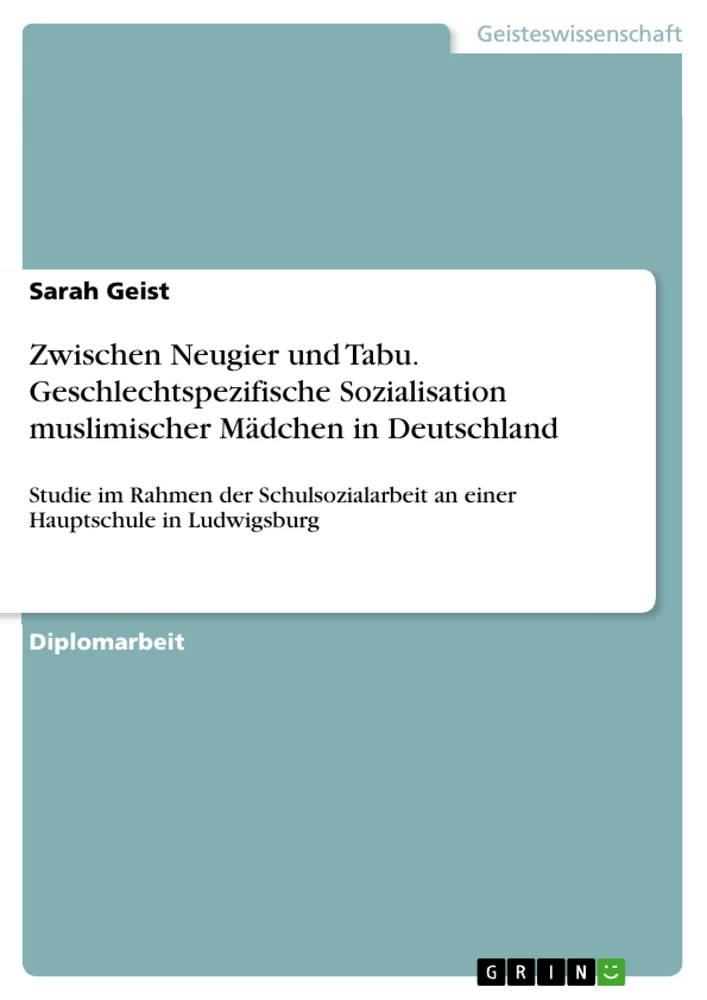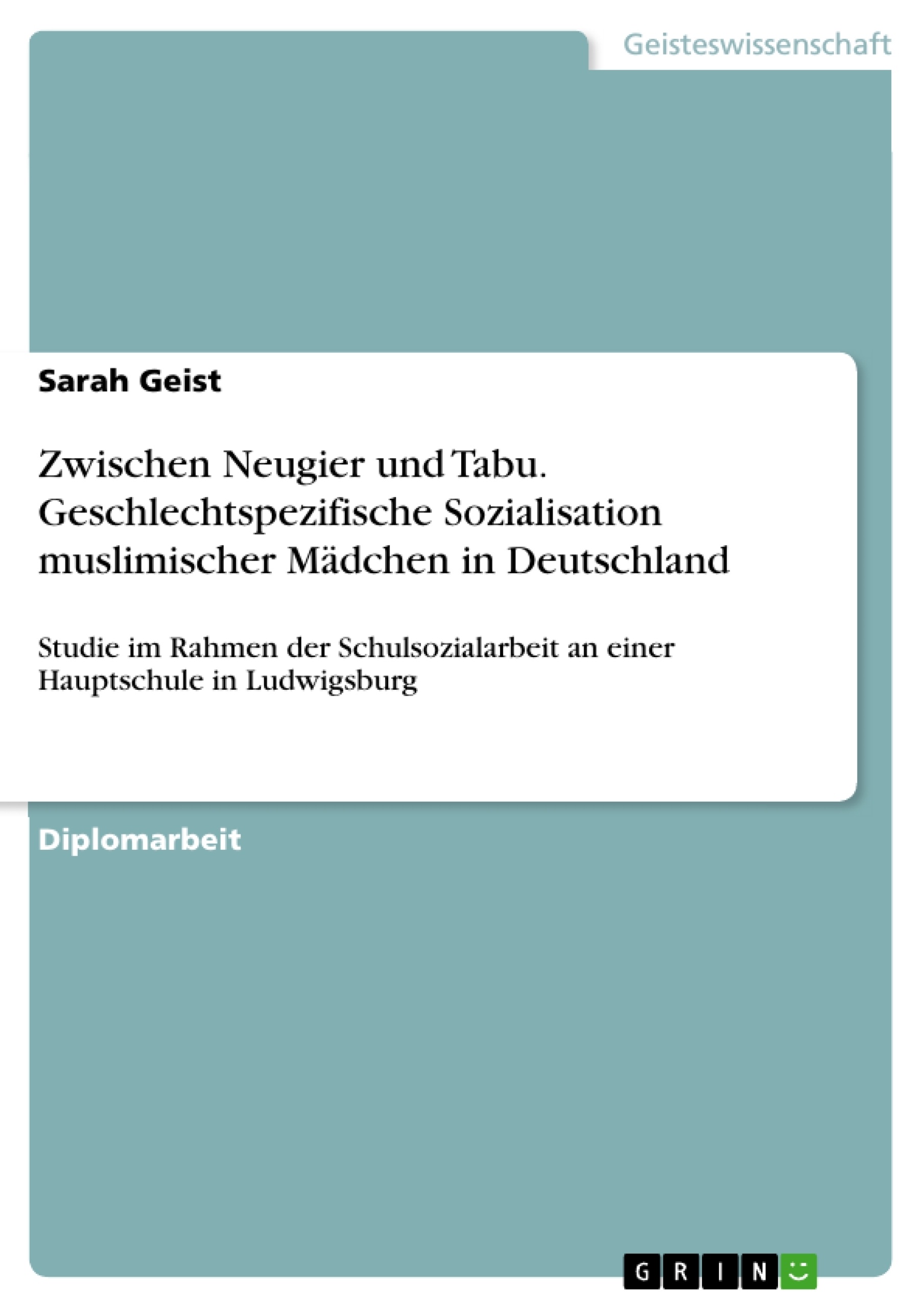2,6 Millionen aus der Türkei stammenden Menschen leben in Deutschland. Man kann nicht länger davon absehen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und in Zukunft noch stärker multikulturell sein wird. Trotz dieser Tatsache findet die Problematik der Lebenssituation muslimischer Mädchen in der deutschen Öffentlichkeit nur ein geringes Interesse. Geringe Kenntnisse sind Grund für Vorurteile und Stereotype.
In der Literatur ist hauptsächlich von muslimischen Frauen die Rede, die unselbstständig, unterdrückt und psychisch sehr stark belastet sind. Auch in den Medien dominiert, gerade in Bezug auf Frauen mit Kopftuch, ein rückständiges Frauenbild.
Doch welche Rolle spielt für die muslimischen Mädchen Gleichberechtigung und Selbständigkeit?
Wie verläuft die geschlechtsspezifische Sozialisation muslimischer Mädchen in Deutschland und welchen Einfluss üben deutsche Einrichtungen, wie die Schule, auf diese Mädchen aus? Diese und weitere Fragestellungen werden in theoretischen sowie empirischen Erhebungen dieser Arbeit aufgegriffen.
Die Motivation für dieses Thema ergab sich dadurch, dass ich im Rahmen der Mädchenarbeit in der Schulsozialarbeit immer wieder auf Themen wie die unterschiedliche Lebenswelt von muslimischen und deutschen Mädchen oder auch auf Unterschiede in der Erziehung muslimischer Mädchen und Jungen von den Mädchen angesprochen wurde. Diese Mädchen befinden sich in einem Spannungsverhältnis zwischen Neugierde, vor allem in Bezug auf Sexualität, Partnerschaft und mädchenspezifische Wünsche, und den Tabus der traditionellen türkischen Gesellschaft.
Um dieser Fragestellung gerecht zu werden, wurde die Arbeit in folgender Weise gegliedert: Im ersten Teil der Arbeit wird das Thema theoretisch erarbeitet und diskutiert. Dazu werden zunächst die wichtigsten Begrifflichkeiten in Bezug auf die Sozialisation zum besseren Verständnis der Arbeit erläutert, um im Folgenden die allgemeine Sozialisation sowie Sozialisationsinstanzen junger Menschen zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Theorie
- 2. Sozialisation und Sozialisationsinstanzen im Jugendalter
- 2.1. Begriff der Sozialisation
- 2.1.1. Allgemeine Sozialisation
- 2.1.1. Geschlechtsspezifische Sozialisation
- 2.2. Sozialisationsinstanzen
- 2.2.1. Familie
- 2.2.2. Schule
- 2.2.3. Peer-Group
- 2.2.4. Sozialpädagogische Institutionen: Schulsozialarbeit
- 2.3. Lebensphase Jugend
- 2.3.1. Abgrenzung Kindheit – Jugend
- 2.3.2. Wichtige Themen und Entwicklungen der Jugendphase
- 3. Geschlechtsspezifische Sozialisation muslimischer Mädchen
- 3.1. Definition und Grundlage zum Verständnis
- 3.1.1. Begriffsdefinition: Muslime
- 3.1.2. Verschiedene Familienformen der türkischen Migranten
- 3.1.3. Wichtigste Werte in der türkischen Familie
- 3.2. Sozialisation in der traditionellen türkischen Familie
- 3.2.1. Rolle des Glaubens
- 3.2.2. Einstellung zum Thema Sexualität
- 3.2.3. Freizeitverhalten muslimischer Mädchen
- 3.2.4. Geschlechtsspezifische Erziehung
- 3.2.4.1. Stellung der weiblichen Familienmitglieder
- 3.2.4.2. Innerfamiliäre Beziehungen
- 3.2.4.3. Konfliktthema Kopftuch
- 3.2.4.4. Die Bedeutung der Ehe
- 3.3. Bedeutung der Migration für die Sozialisation
- 3.3.1. Bedingungen der Migration in der BRD
- 3.3.2. Die erste Generation
- 3.3.3. Die zweite und dritte Generation
- 3.4. Leben zwischen den Kulturen: Sozialisation in der deutschen Gesellschaft
- 3.4.1. Zur Kulturkonflikttheorie
- 3.4.2. Sozialisation in der deutschen Schule
- 3.4.3. Sozialisation durch die deutsche Peer-Group
- 3.4.4. Sozialisation durch die Medien
- 4. Hypothesen
- Empirie
- 5. Beschreibung der Uhlandschule in Ludwigsburg
- 5.1. Ziele der Schule
- 5.2. Grundsätze der Schule
- 5.3. Schulcurriculum: Themen für muslimische Mädchen
- 6. Beschreibung der Schulsozialarbeit an der Uhlandschule
- 6.1. Klientel der Schulsozialarbeit an der Uhlandschule
- 6.2. Ziele der Schulsozialarbeit
- 6.3. Leistungsbereiche
- 6.3.1. Offene Arbeit im Schülertreff
- 6.3.2. Beratung und soziale Einzelhilfe
- 6.3.3. Gruppenarbeit: Mädchennachmittag
- 7. Untersuchung
- 7.1. Vorstellung der Untersuchungsgruppe
- 7.2. Auswahl des Untersuchungsinstruments
- 7.3. Vorbereitung und Herangehensweisen zur Untersuchung
- 7.4. Konstruktion und Aufbau des Untersuchungsinstruments
- 8. Auswertung und Interpretation
- 8.1. Einzelne biografische Besonderheiten
- 8.1.1. Feride
- 8.1.2. Hatice
- 8.1.3. Ayse
- 8.1.4. Semra
- 8.1.5. Melek
- 8.1.6. Özlem
- 8.2. Sozialisation in der Familie
- 8.2.1. Geschlechtsspezifische Sozialisation
- 8.2.2. Die Tabus in der türkischen Familie
- 8.2.3. Aufklärung und Sexualität in türkischen Familien
- 8.2.4. Die Rolle des Glaubens
- 8.2.5. Das Kopftuch: Zwang oder freiwillig?
- 8.3. Weitere wichtige Sozialisationsinstanzen für muslimische Mädchen
- 8.3.1. Die peer group und das Freizeitverhalten
- 8.3.2. Die Medien
- 8.3.3. Die Schule
- 8.3.4. Die Schulsozialarbeit und andere sozialpädagogische Einrichtungen
- 8.4. Unterschiede zwischen der deutschen und türkischen Gesellschaft
- 8.5. Zukunft
- 8.5.1. Berufliche Pläne
- 8.5.2. Soziale Lebenspläne und Erziehungsziele für die eigenen Kinder
- 8.6. Zusammenfassung
- Schlussfolgerungen
- 9. Folgerungen für die Arbeit mit muslimischen Mädchen
- 9.1. Allgemeine Folgerungen
- 9.2. Folgerungen für die Schulsozialarbeit an der Uhlandschule
- 9.3. Themen und Projekte für den „Mädchennachmittag“
- 10. Schlusswort
- 11. Literaturverzeichnis
- 12. Anhang
- 12.1. Teilstrukturierter Interviewleitfaden
- 12.2. Interview mit Herrn Kunze
- 12.3. Schriftliches Interview mit Frau Dr. H.
- 12.4. Interviews mit den muslimischen Mädchen
- Die Rolle der Familie und traditioneller Werte in der Sozialisation muslimischer Mädchen
- Die Bedeutung von Migration und kulturellem Austausch für die Identitätsfindung muslimischer Mädchen
- Der Einfluss von Schule und Schulsozialarbeit auf die Entwicklung und Integration muslimischer Mädchen
- Die Erfahrungen und Perspektiven muslimischer Mädchen in Bezug auf Geschlechterrollen und Selbstbestimmung
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Begegnung mit der deutschen Gesellschaft ergeben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Sozialisation muslimischer Mädchen in Deutschland im Kontext der Schulsozialarbeit. Sie will ein besseres Verständnis für die Lebenswelt dieser Mädchen entwickeln und den Einfluss von Familienstrukturen, kulturellen Werten und deutschen Institutionen auf ihre Entwicklung beleuchten. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen zu analysieren, die muslimische Mädchen im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne erleben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Erörterung der Sozialisation, wobei die allgemeine Sozialisation sowie die spezifischen Sozialisationsinstanzen, wie Familie, Schule, Peer-Group und Schulsozialarbeit im Jugendalter beleuchtet werden. Anschließend werden die Besonderheiten der geschlechtsspezifischen Sozialisation muslimischer Mädchen in der Türkei und der Einfluss von Migration auf die Sozialisation in Deutschland untersucht. Dabei werden Themen wie die Rolle des Glaubens, Einstellungen zur Sexualität, das Kopftuch und die Bedeutung der Ehe in der türkischen Familie betrachtet. Die Arbeit analysiert die Kulturkonflikttheorie und deren Relevanz für die Sozialisation muslimischer Mädchen in Deutschland. Die empirischen Ergebnisse der Untersuchung an einer Hauptschule in Ludwigsburg werden präsentiert, wobei die Sozialisation der muslimischen Mädchen in der Familie, in der peer group, in der Schule und durch die Medien beleuchtet wird. Die Arbeit untersucht die Erfahrungen und Perspektiven der Mädchen in Bezug auf ihre Zukunft, ihre beruflichen Pläne und ihre Erziehungsvorstellungen für die eigenen Kinder.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sozialisation, Geschlechtsspezifische Sozialisation, Muslimische Mädchen, Migration, Kulturkonflikt, Familie, Schule, Schulsozialarbeit, Peer-Group, Medien, Integration, Tradition, Moderne, Selbstbestimmung, Lebenswelt.
Häufig gestellte Fragen
Wie verläuft die Sozialisation muslimischer Mädchen in Deutschland?
Sie findet in einem Spannungsfeld zwischen traditionellen türkischen Familienwerten und den Einflüssen der deutschen Gesellschaft (Schule, Medien, Peer-Groups) statt.
Was ist die "Kulturkonflikttheorie"?
Sie beschreibt die Herausforderungen, wenn Jugendliche zwischen zwei unterschiedlichen Wertesystemen aufwachsen, was oft zu Identitätskrisen führen kann.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit für diese Mädchen?
Einrichtungen wie der "Mädchennachmittag" bieten geschützte Räume, um Tabuthemen wie Sexualität und Partnerschaft offen zu besprechen und Selbstbestimmung zu fördern.
Ist das Kopftuch immer ein Zeichen von Zwang?
Die Arbeit untersucht anhand von Interviews, ob das Kopftuch als religiöse Pflicht, Familientradition oder freiwillige Entscheidung zur Identitätsstiftung getragen wird.
Welche Zukunftspläne haben muslimische Mädchen der 2. und 3. Generation?
Die Untersuchung zeigt, dass berufliche Unabhängigkeit und Gleichberechtigung zunehmend an Bedeutung gewinnen, während familiäre Werte weiterhin wichtig bleiben.
- Citation du texte
- Diplom Sozialpädagogin Sarah Geist (Auteur), 2006, Zwischen Neugier und Tabu. Geschlechtspezifische Sozialisation muslimischer Mädchen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65944