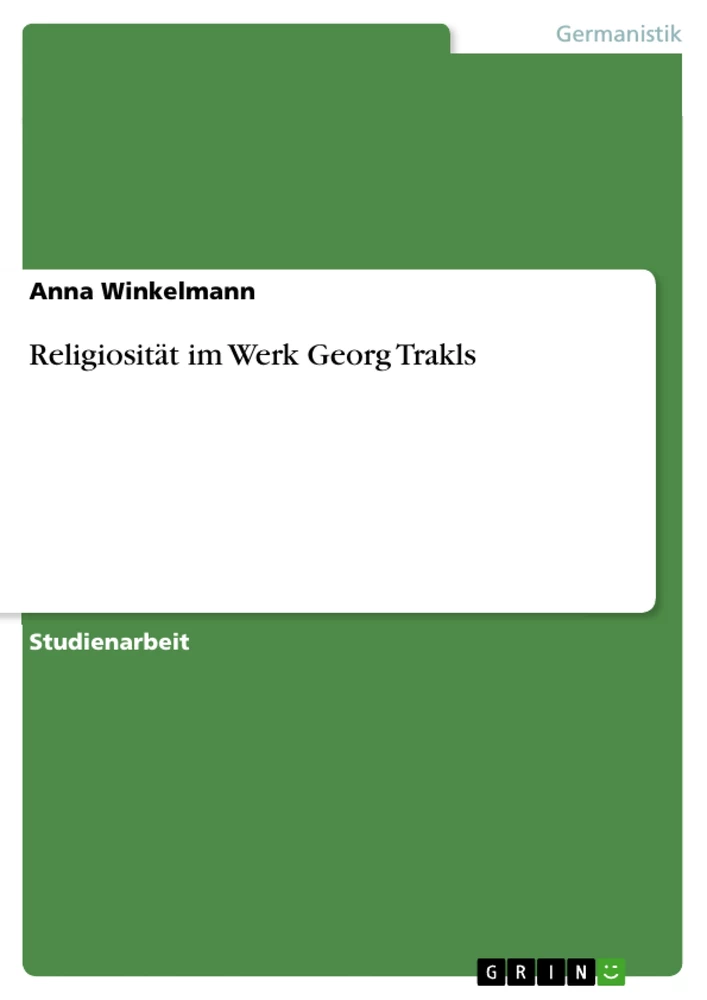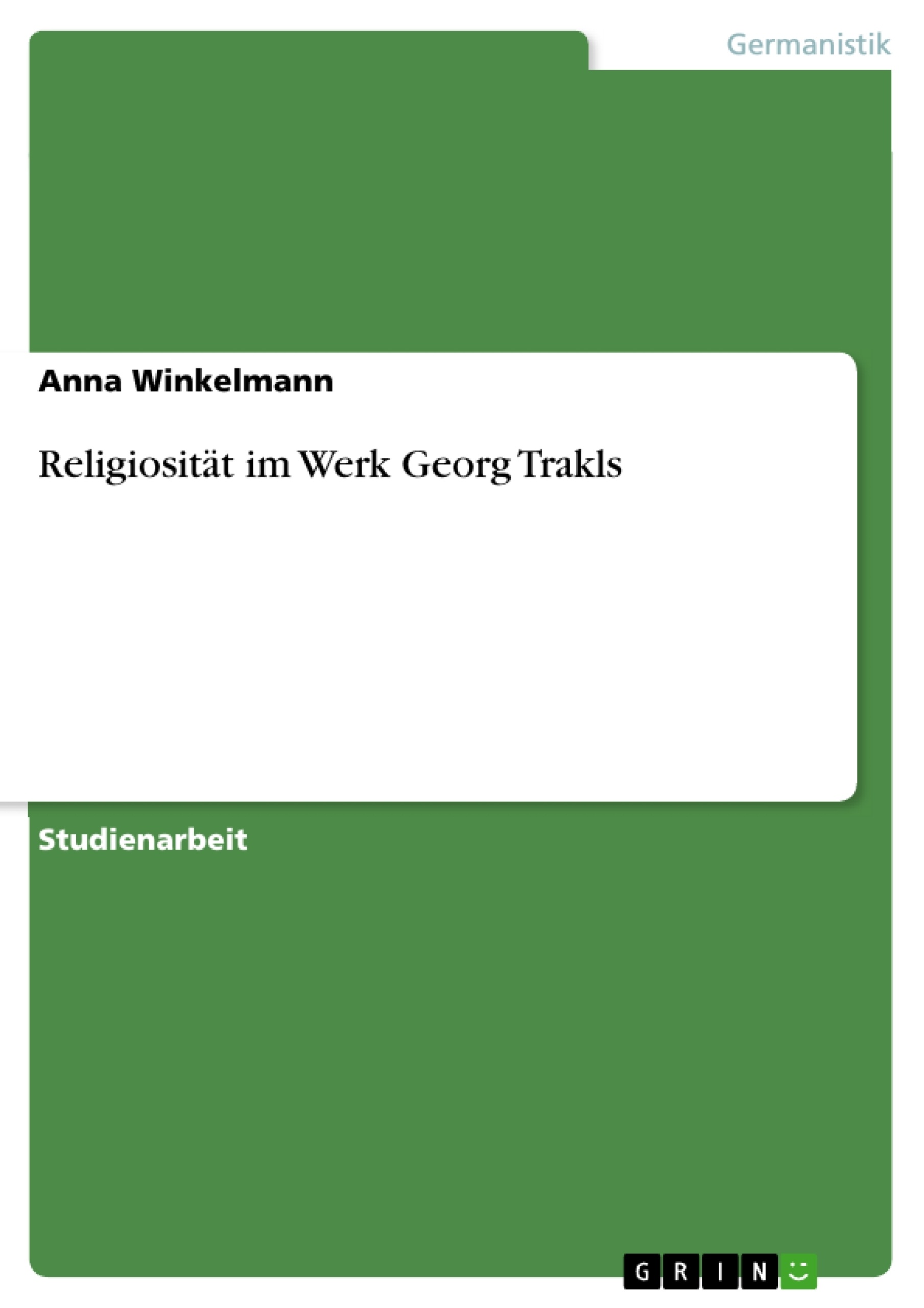Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss und der Thematisierung von Religion im Werk Georg Trakls. Sie betrachtet zunächst Nietzsches Kritik an der Theologie und seine Einsicht in die Subjektivität aller Erkenntnis, mit der er bei den Dichtern und Schriftstellern des beginnenden 20. Jahrhunderts schwerwiegende Zweifel am gesellschaftlichen Status Quo auslöste. In ihrem sinnbildlichen „Kampf des Dionysos gegen den Gekreuzigten“, den viele junge Künstler daraufhin innerlich austrugen, stellten sie die alten Gesetzen der Kirche in Frage. Es galt, sich auf die menschlichen Ur-Instinkte zurückzubesinnen und aus ihnen Sinn und Kreativität zu schöpfen.
Georg Trakl bildet innerhalb dieser künstlerischen Bewegung eine Ausnahme: zwar schloss er sich keiner religiösen Verehrung Christi an, doch auch in der Verherrlichung des irdischen Lebens und der Ur-Instinkte sah er keine Chance auf einen Neubeginn. Stattdessen kontrastiert er beide Ideale immer wieder in seinem Werk und lässt sie sich gegenseitig als Illusionen entlarven.
Der Zwiespalt Trakls zwischen christlichem Glauben und Nietzsches Religionskritik sowie die problematische Beziehung zu seiner Schwester finden ihren Ausdruck in zahlreichen Gedichten Trakls. In dieser Arbeit werden einschlägige Beispiele aus dem Werk des Dichters auf diese Thematiken hin untersucht und interpretiert. Dabei wird auch auf die hermetische Sprache Trakls eingegangen, der man sich oft nur innerhalb des Traklschen Werkes selbst annähern kann. Ihren Kode zu entschlüsseln ist bis heute eine reizvolle Herausforderung für zahlreiche Literaturwissenschaftler.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trakl und Nietzsche
- Schuld und Sünde
- Hermetik und Transparenz
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Werk von Georg Trakl im Hinblick auf die Religiosität, die darin zum Ausdruck kommt. Es soll untersucht werden, wie sich Nietzsches Theologiekritik auf Trakls Werk auswirkt und welche Rolle die Motive der Sünde und Schuld im Gesamtkontext seiner Lyrik spielen.
- Die Rezeption von Nietzsches Theologiekritik im expressionistischen Kontext
- Die Darstellung von Schuld und Sünde in Trakls Gedichten
- Die Verbindung von christlichen und nietzscheanischen Motiven in Trakls Werk
- Die Rolle der Sprache als Ausdruck von Religiosität und subjektiver Erfahrung
- Die Herausforderungen der Interpretation von Trakls hermetischer Poesie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz und den Forschungsstand der Religiosität in der expressionistischen Literatur dar, wobei die unterschiedlichen Interpretationsansätze der Dichterin Trakl beleuchtet werden.
- Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung von Nietzsches Theologiekritik für das Verständnis von Trakls Werk erörtert. Die Arbeit untersucht, wie sich die Kritik am Christentum in Trakls Gedichten niederschlägt und welche Auswirkungen sie auf seine Vorstellung von Gott und Religion hat.
- Das dritte Kapitel analysiert die Rolle der Motive Schuld und Sünde in Trakls Lyrik. Es wird untersucht, wie Trakl diese Motive literarisch verarbeitet und inwiefern sie mit seinen persönlichen Erfahrungen und dem Kontext seiner Zeit zusammenhängen.
Schlüsselwörter
Georg Trakl, Expressionismus, Religiosität, Nietzsche, Theologiekritik, Schuld, Sünde, Hermetik, Sprache, Christentum, Privatmythologie
- Citar trabajo
- Anna Winkelmann (Autor), 2005, Religiosität im Werk Georg Trakls, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65966