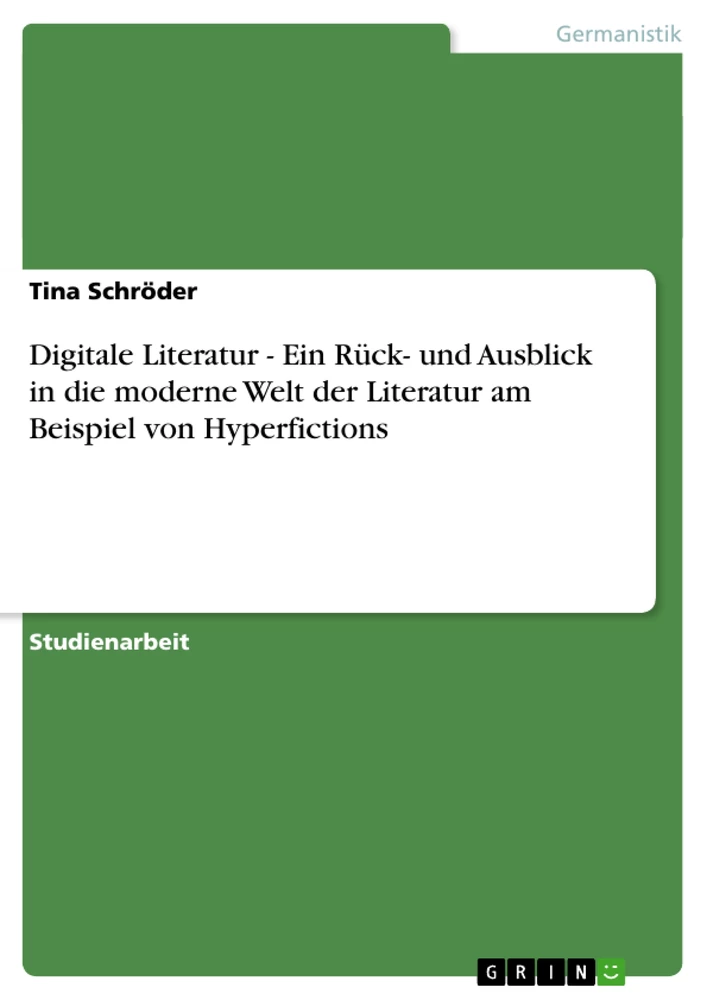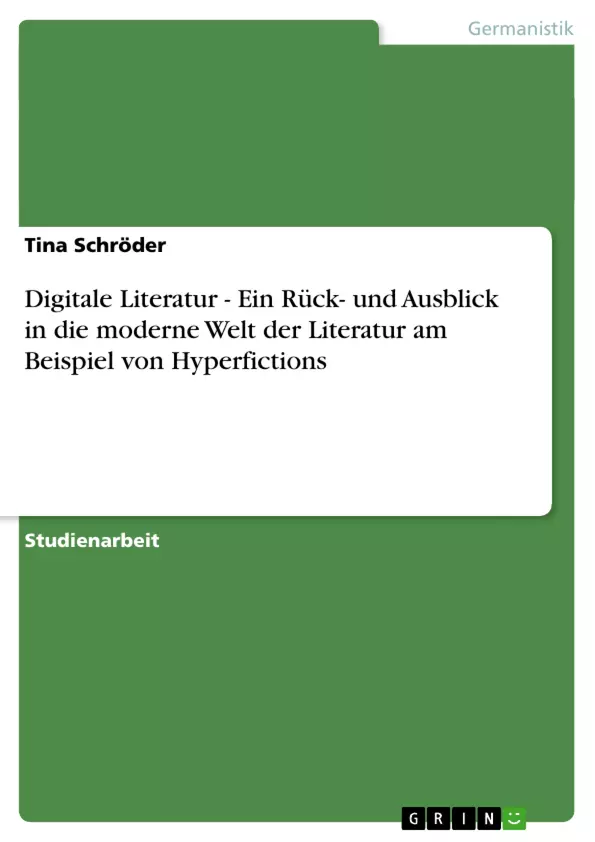Digitale Literatur - ein Begriff, der heutzutage fast als Schlagwort für einen Zweig der modernen Literatur verwendet wird. Was verbirgt sich hinter dieser Parole? Ist Digitale Literatur wirklich ein so wichtiges Thema, dass es sich lohnt, darüber eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, in der Hoffnung, neue Erkenntnisse ans Tageslicht zu bringen? Oder verbergen sich hinter der Digitalen Literatur altbekannte Formen der Literatur, die nur hinter dem Deckmantel der digitalen Welt so wirken, als wären neue Kunstformen geboren? Diese Fragen und viele mehr stehen zu Beginn dieser Arbeit. Während meines Studiums habe ich nie ernsthaft das Terrain der Digitalen Literatur betreten, daher möchte ich mich diesem literarischen Gebiet schrittweise nähern. Nach dem Einlesen in dieses Thema wurde mir erst bewusst, welcher „Hype“ um diese Form von Literatur und dessen vielzähligen Unterformen betrieben wird. Das anfängliche Unwissen und die damit verbundene Neugier reizten mich, mich mit diesem umfassenden Thema intensiver zu beschäftigen. Begriffe wie Netzliteratur, Interfictions und Internet-Literatur-Wettbewerb lassen ein ungeheures Potenzial an neuen Kunst-formen der Literatur erahnen - oder nicht?
Da der Komplex äußerst umfangreich ist, möchte ich diese Untersuchung exemplarisch mit Hilfe eines speziellen Bereichs, den Hyperfictions, durchführen. Die Hyperfictions existieren in der Welt der Digitalen Literatur schon vergleichsweise lange, so dass dieses Gebiet eine gute wissenschaftliche Diskussionsgrundlage bietet. Viele Autoren begannen früh, sich mit Hyperfictions auseinander zu setzen.
Auch wegen meines Zweitfaches Kommunikationstechnologie Druck interessiert mich dieses Gebiet, und so möchte ich bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich den ein oder anderen Punkt auch von technischer Seite durchleuchten möchte. So interessiert mich beispielsweise, welche Software-Lösungen Autoren digitaler Literatur bevorzugen. Vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung als Mediengestalterin absolviert. Die Berufserfahrungen zwingen mich beinahe, stets einen Blick auf gestalterisch-technische Umsetzungen zu werfen. Auch dieser Aspekt wird zweifelsohne an einigen Stellen dieser Arbeit eine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verwendete Literatur
- Arbeitsdefinitionen: Digitale Literatur und Hyperfictions
- Ziel dieser Arbeit
- Hyperfictions
- Die Anfänge
- Die Wettbewerbe und Symposien
- Die Meinungen der Literaturinteressierten
- Der aktuelle Stand
- Die Zukunft
- Ein Beispiel: Susanne Berkenhegers ,,Zeit für die Bombe”
- Zum Inhalt der Hyperfiction „Zeit für die Bombe”
- Die Rolle des Lesers
- Die Rolle des Autors
- Die Funktion des Links in Hyperfictions
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die digitale Literatur am Beispiel von Hyperfictions. Sie soll den aktuellen Stand dieser literarischen Form erforschen und einen Ausblick auf die Zukunft geben. Die Arbeit analysiert die Anfänge und Entwicklung von Hyperfictions, befasst sich mit Meinungen und Wettbewerben in diesem Genre und untersucht die Rolle des Lesers und des Autors in Hyperfictions.
- Definition und Merkmale der digitalen Literatur
- Die Entstehung und Entwicklung von Hyperfictions
- Die Rolle von Interaktivität und Intermedialität in Hyperfictions
- Die Bedeutung des Lesers und des Autors in Hyperfictions
- Das Beispiel von Susanne Berkenhegers Hyperfiction „Zeit für die Bombe”
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der digitalen Literatur ein und erläutert den Forschungsstand. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Hyperfictions und ihren aktuellen Stand. Kapitel 3 analysiert die Hyperfiction „Zeit für die Bombe“ von Susanne Berkenheger, untersucht die Rolle des Lesers und des Autors und die Funktion des Links in Hyperfictions.
Schlüsselwörter
Digitale Literatur, Hyperfiction, Interaktivität, Intermedialität, Netzliteratur, Internet-Literatur-Wettbewerb, Susanne Berkenheger, „Zeit für die Bombe“, Leserrolle, Autorrolle, Linkfunktion.
Häufig gestellte Fragen zur Digitalen Literatur
Was versteht man unter Digitaler Literatur?
Digitale Literatur umfasst Werke, die digitale Medien als wesentliches Ausdrucksmittel nutzen und oft nicht ohne Computer oder Internet funktionieren (z.B. Netzliteratur).
Was sind Hyperfictions?
Hyperfictions sind nicht-lineare Erzählungen, bei denen der Leser durch Hyperlinks selbst entscheiden kann, welchen Pfad der Geschichte er als nächstes verfolgt.
Wie ändert sich die Rolle des Lesers?
Der Leser wird zum "User" oder Mitgestalter, der aktiv in den Text eingreift und durch seine Klicks den Verlauf und die Bedeutung der Erzählung beeinflusst.
Was ist das Werk "Zeit für die Bombe"?
Es ist eine bekannte Hyperfiction von Susanne Berkenheger, die exemplarisch zeigt, wie Interaktivität und Humor in digitaler Literatur kombiniert werden können.
Welche Rolle spielen gestalterisch-technische Umsetzungen?
Bei digitaler Literatur sind Design, Software-Lösungen und die technische Struktur (z.B. Programmierung) untrennbar mit dem literarischen Gehalt verbunden.
- Citation du texte
- Tina Schröder (Auteur), 2004, Digitale Literatur - Ein Rück- und Ausblick in die moderne Welt der Literatur am Beispiel von Hyperfictions, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66019