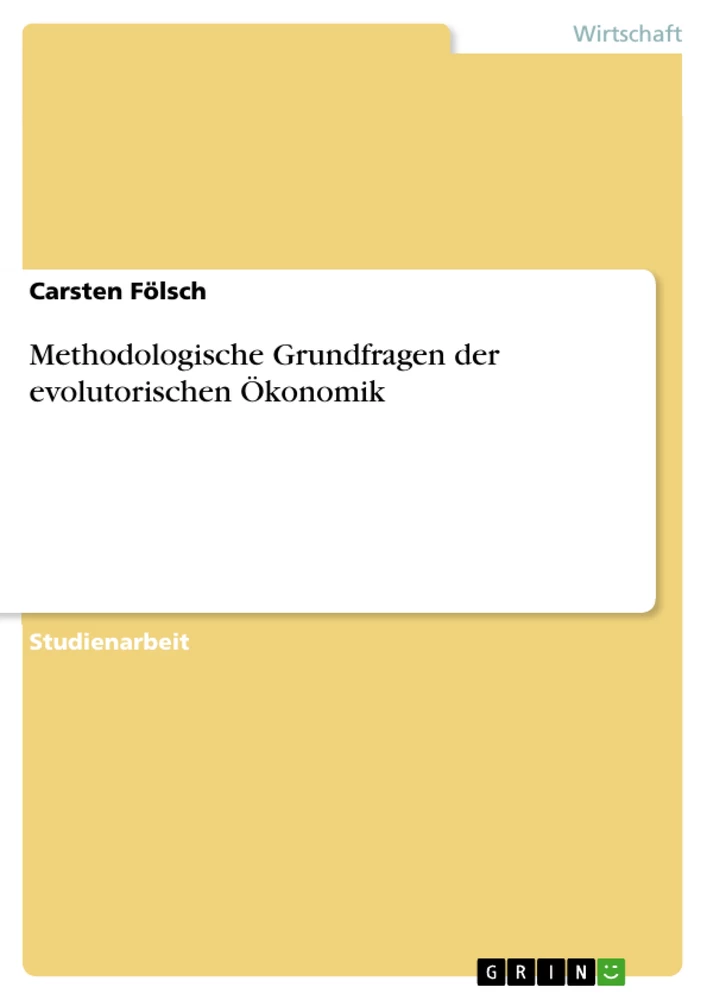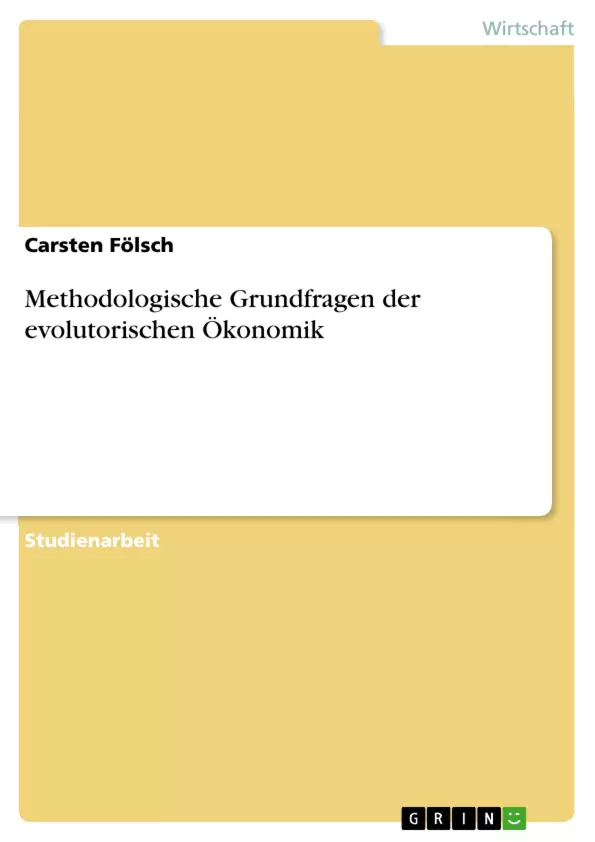Mit diesem Satz bezeichnete der Physiker Isaac Newton ein Kernproblem der Ökonomie. Das Verhalten des Menschen ist nicht vorhersehbar. In der traditionellen Ökonomie ist jenes Problem allerdings durch die Einführung des homo-oeconomicus - der rationale Mensch, der bei vollständiger Information immer die optimale Entscheidung mit dem größten Nutzen für sich trifft - einfach beseitigt worden. Wie sieht es aber in der Realität aus? Gibt es vollkommene Information? Eine Entscheidung kann in der Realität immer erst ex-post als „gut“ charakterisiert werden. Durch diese rein theoretische Lösungsidee eines Menschenbildes ist in der Wissenschaft ein heftiger Disput entstanden. In Teil 2 dieser Arbeit wird auf die Aspekte des Menschenbildes in der evolutorischen Theorie eingegangen.
Seit Adam Smith hat das Gleichgewicht eine bedeutende Rolle in der Ökonomie gespielt. In der traditionellen Ökonomie wird von einem statischen Gleichgewicht ausgegangen. Ist dies aber vereinbar mit Innovationen oder Wandel? Wie werden Ungleichgewichte und Instabilitäten berücksichtigt, die eine Vorraussetzung für das Überleben eines Systems darstellen? Ein möglicher methodologischer Lösungsansatz wird interdisziplinär in Anlehnung an die Physik in Teil 3 vorgestellt.
In Teil 4 wird nach einer kurzen Einführung in den Neodarwinismus dargelegt, ob eine 1:1 Übertragung der biologischen auf die ökonomische Evolution einer Sinn- und Zweckmäßigkeit entspricht. Dazu werden verschiedene Meinungen bezüglich möglicher Bedeutungen der Analogieschlüsse kurz dargestellt und diskutiert.
Abschließend werden in Teil 5 in einer Schlussbemerkung die Ergebnisse der methodologischen Grundfragen nochmals veranschaulicht und im Hinblick auf eine individualistische Sichtweise wird ein Resümee gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Methodologische Grundpositionen und Paradigmenwechsel
- Das Verhaltensmodell der evolutorischen Ökonomik
- Der methodologische Individualismus
- Kulturelles Lernen
- Das Menschenbild der Ökonomie
- Paradigmenwechsel in der Ökonomie
- Das Verhaltensmodell der evolutorischen Ökonomik
- Die evolutorische Ökonomik und das Verständnis des Gleichgewichts
- Die Vereinbarkeit des ökonomischen und evolutorischen Gleichgewichtsbegriffs
- Der Einfluss von Neuerungen auf den Gleichgewichtszustand und ungleichgewichtige Phasenübergänge
- Das Prinzip der spontanen Ordnung im Einklang mit einer offenen Entwicklung
- Offene Entwicklung und offene Systeme
- Die biologische Evolution und ökonomische Analogieschlüsse
- Die Biologische Evolution nach dem Neodarwinismus
- Analogieschlussproblematik der biologischen Evolutorik mit der Ökonomie
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, methodologische Grundfragen der evolutorischen Ökonomik zu beleuchten. Dabei stehen insbesondere das Verhältnis zwischen individueller Entscheidungsfindung und kulturellem Lernen, das Verständnis des Gleichgewichts in einem dynamischen System sowie die Übertragbarkeit von Analogien aus der biologischen Evolution auf ökonomische Prozesse im Fokus.
- Das Menschenbild in der evolutorischen Ökonomik und die Abkehr vom Homo oeconomicus
- Der Einfluss von Neuerungen und Wandel auf das ökonomische Gleichgewicht
- Die Bedeutung des methodologischen Individualismus und des kulturellen Lernens in der evolutorischen Ökonomik
- Die Anwendbarkeit biologischer Evolutionstheorien auf ökonomische Prozesse
- Die Rolle von Ungleichgewichten und Instabilitäten für das Überleben ökonomischer Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung
Die Einleitung stellt die Kernproblematik der Arbeit vor: Das Verhalten des Menschen ist in der traditionellen Ökonomie durch das Konzept des Homo oeconomicus vereinfacht, welches die Frage nach der Vorhersehbarkeit von Entscheidungen negiert. Die evolutorische Ökonomik bietet einen alternativen Ansatz, der die Dynamik und Unvorhersehbarkeit menschlicher Entscheidungen in den Vordergrund stellt. - Kapitel 2: Methodologische Grundpositionen und Paradigmenwechsel
Dieses Kapitel untersucht die methodologischen Grundlagen der evolutorischen Ökonomik, insbesondere den methodologischen Individualismus. Der Individualismus in der Neoklassik setzt auf die Erklärung von Marktprozessen und gesellschaftlichen Zuständen durch individuelle Entscheidungen. Die evolutorische Ökonomik baut auf dieser Grundlage auf, wobei die Rolle von kulturellem Lernen und der Einfluss von Neuerungen auf die Entscheidungsfindung im Fokus stehen. - Kapitel 3: Die evolutorische Ökonomik und das Verständnis des Gleichgewichts
Das Kapitel beleuchtet das Konzept des Gleichgewichts in der evolutorischen Ökonomik. Es wird erörtert, wie sich die evolutorische Ökonomik vom statischen Gleichgewichtsmodell der traditionellen Ökonomik unterscheidet. Das Kapitel befasst sich mit dem Einfluss von Neuerungen auf den Gleichgewichtszustand und untersucht, wie Ungleichgewichte und Instabilitäten als Voraussetzung für das Überleben eines Systems betrachtet werden können. - Kapitel 4: Die biologische Evolution und ökonomische Analogieschlüsse
Dieses Kapitel widmet sich dem Zusammenhang zwischen biologischer Evolution und ökonomischen Prozessen. Nach einer kurzen Einführung in den Neodarwinismus werden die Analogieschlüsse zwischen biologischer und ökonomischer Evolution diskutiert.
Schlüsselwörter
Evolutorische Ökonomik, methodologischer Individualismus, kulturelles Lernen, Gleichgewicht, Ungleichgewicht, Innovation, Wandel, Neodarwinismus, Analogieschlüsse, Homo oeconomicus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist evolutorische Ökonomik?
Ein ökonomischer Ansatz, der wirtschaftlichen Wandel, Innovationen und die Entwicklung von Systemen analog zu evolutionären Prozessen betrachtet, anstatt von statischen Gleichgewichten auszugehen.
Warum wird das Modell des "Homo oeconomicus" kritisiert?
Kritiker argumentieren, dass Menschen in der Realität nicht über vollkommene Information verfügen und ihre Entscheidungen oft nicht rein rational, sondern durch Lernen und Kultur geprägt sind.
Welche Rolle spielen Analogien zur Biologie in der Ökonomie?
Konzepte wie Variation, Selektion und Replikation werden genutzt, um zu erklären, wie sich neue Technologien oder Organisationsformen am Markt durchsetzen oder verschwinden.
Was bedeutet "methodologischer Individualismus"?
Es ist das Prinzip, soziale und ökonomische Phänomene aus dem Handeln und den Interaktionen einzelner Individuen heraus zu erklären.
Warum sind Ungleichgewichte wichtig für ein ökonomisches System?
In der evolutorischen Theorie sind Ungleichgewichte und Instabilitäten Voraussetzungen für Wandel und Innovation, die das langfristige Überleben des Systems sichern.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Ökonom Carsten Fölsch (Autor:in), 2004, Methodologische Grundfragen der evolutorischen Ökonomik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66065