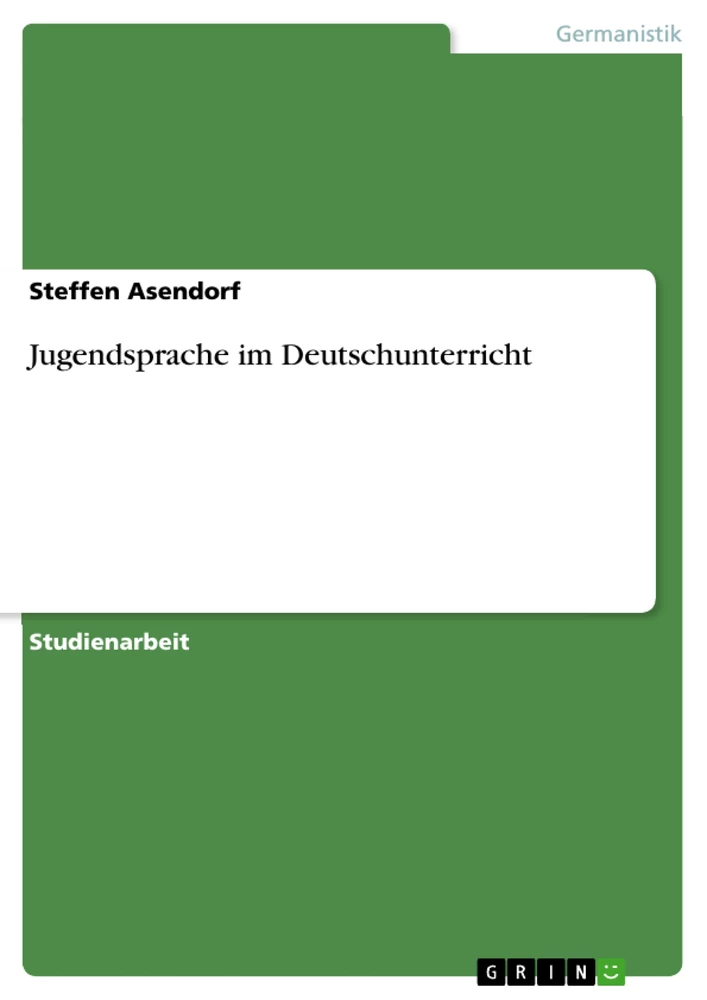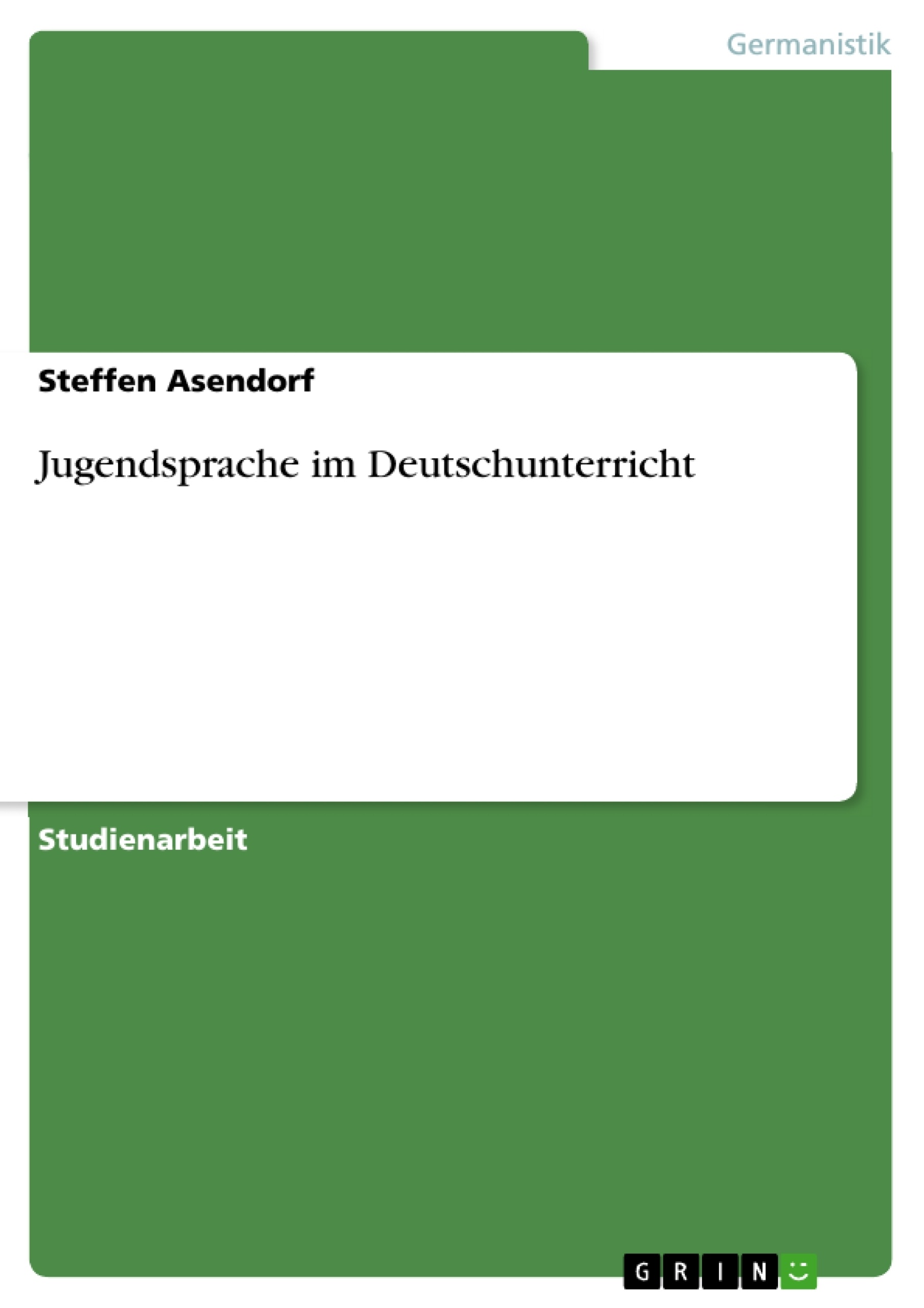Immer wieder versuchen Erwachsene, das Geheimnis der für sie meist unverständlichen Sprache von Jugendlichen und Kindern zu ergründen. Damit einher geht oftmals parallel eine Klage über einen Verfall und Verarmung der Sprache und die Verflachung der Inhalte. Teilweise wird sie sogar mit einem Sittenverfall gleichgesetzt. Der Forschungsgegenstand der Jugendsprache unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ist aber keinesfalls ein Phänomen der heutigen Zeit.
In einem Literaturbericht zur Jugendsprache unterscheidet Edgar Lapp mehrere historische Phasen der Jugendsprachforschung:
Bereits seit Anfang der 50er Jahre wird gezielt die Sprache der Jugendlichen betrachtet und untersucht, auch wenn dies zunächst unter anderen Bezeichnungen geschieht. So wird diese damals noch als „Sprache der Halbstarken“ (Halbstarken-Chinesisch) bezeichnet. Vorher gab es bereits Untersuchungen, die sich mit Studenten- bzw. Schülersprache („Pennälersprache“) beschäftigten.
In den 60er Jahren machte sich der steigende anglo-amerikanische Einfluss auch in diesem Bereich bemerkbar, jetzt rückte die „Teenagersprache“ in den Fokus des Interesses. In den folgenden Jahrzehnten wurden eher spezielle Untergruppen der Jugendsprache genauer untersucht, wie beispielsweise die APO- oder Szenesprache der 70er Jahre, in den 80er Jahren die Sprache der Punks oder Ökos und in den 90er Jahren die Sprachen verschiedener Jugendgruppen, welche sich vor allem durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Musikrichtungen unterschieden (z.B. Techno, HipHop, Rap usw.).
Auch heute versuchen eine Vielzahl von unterschiedlichen Werken uns die Sprache der Jugend verständlich zu machen. Beispielsweise gibt es ein spezielles Wörterbücher der Jugendsprache von Pons oder die diversen Lexika von Hermann Ehmann zum Thema Jugendsprache, deren Titel von „Affengeil“, über „Oberaffengeil“ und „Voll Konkret“, bis hin zu „Endgeil“ reichen.
Alle diese Sachbücher aber haben eins gemein. Sie suggerieren den verzweifelten Eltern pubertierender Kinder und Jugendlicher, dass sie durch die Lektüre endlich die eigenen Kinder wieder verstehen könnten. Ist es aber überhaupt möglich die Sprache „der Jugend“ zu erfassen und auf bestimmte Begrifflichkeiten und Ausdrucksformen zu reduzieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Definition Jugend
- Begriff der Jugendsprache
- Funktionen sprachlicher Merkmale
- Jugendsprache im Deutschunterricht
- Mögliche Probleme bei der Integration von Jugendsprache in die schulische Praxis
- Thematische Vielfalt von Jugendsprache im Unterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Verwendung von Jugendsprache im Deutschunterricht. Ziel ist es, mögliche Integrationsansätze aufzuzeigen und Herausforderungen zu diskutieren. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Jugendsprachforschung und analysiert die linguistischen Besonderheiten der Jugendsprache.
- Definition und historische Entwicklung der Jugendsprache
- Linguistische Einordnung und Funktionen von Jugendsprache
- Möglichkeiten und Herausforderungen der Integration von Jugendsprache in den Unterricht
- Didaktische Ansätze für den Umgang mit Jugendsprache im Unterricht
- Thematische Vielfalt und Relevanz von Jugendsprache für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den langjährigen Forschungsfokus auf Jugendsprache, beginnend mit frühen Studien zur „Sprache der Halbstarken“ und der „Pennälersprache“, über die „Teenagersprache“ der 60er Jahre bis hin zu den spezifischen Jugendsprachen verschiedener Subkulturen in den folgenden Jahrzehnten. Sie stellt die Frage nach der Möglichkeit, Jugendsprache umfassend zu erfassen und kündigt die folgenden Kapitel an, die sich mit Definitionen, Funktionen und pädagogischen Aspekten befassen.
Begriffsklärungen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von „Jugend“ und „Jugendsprache“. Es zeigt die Schwierigkeiten auf, eine eindeutige Altersgrenze für die Jugendphase zu definieren und präsentiert verschiedene wissenschaftliche Ansätze. Der Begriff der Jugendsprache wird ebenfalls diskutiert, wobei die Vielfalt an Ausdrucksformen und die Herausforderung, sie eindeutig zu kategorisieren, hervorgehoben werden. Die Kapitel verdeutlicht die Komplexität der beiden Begriffe und bereitet den Boden für die folgende Auseinandersetzung mit der Jugendsprache im Unterricht.
Funktionen sprachlicher Merkmale: (Fehlt im gegebenen Text, kann nicht zusammengefasst werden)
Jugendsprache im Deutschunterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Integration von Jugendsprache in den Deutschunterricht. Es diskutiert potentielle Probleme im schulischen Kontext und präsentiert ideale thematische Ansätze zur Einbeziehung von Jugendsprache. Der Fokus liegt auf der didaktischen Umsetzung und den potentiellen Lernwirkungen. Die Kapitel zeigt auf, wie Jugendsprache als wertvolles Ressource im Unterricht genutzt werden kann, wenn die Herausforderungen angemessen angegangen werden.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Deutschunterricht, Didaktik, Sprachwandel, Jugendkultur, Linguistik, Interkulturelle Kommunikation, Soziolinguistik, Identität, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Jugendsprache im Deutschunterricht
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Verwendung von Jugendsprache im Deutschunterricht. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Jugendsprachforschung, analysiert linguistische Besonderheiten der Jugendsprache und zeigt mögliche Integrationsansätze im Unterricht auf, während sie gleichzeitig Herausforderungen diskutiert. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Begriffsklärungen zu „Jugend“ und „Jugendsprache“, einen (im vorliegenden Auszug fehlenden) Abschnitt zu den Funktionen sprachlicher Merkmale, einen Abschnitt zur Integration von Jugendsprache in den Deutschunterricht mit didaktischen Ansätzen, und ein Fazit (welches im Auszug nicht enthalten ist).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und historische Entwicklung der Jugendsprache, deren linguistische Einordnung und Funktionen, die Möglichkeiten und Herausforderungen ihrer Integration in den Unterricht, didaktische Ansätze für den Umgang mit Jugendsprache und die thematische Vielfalt und Relevanz von Jugendsprache für den Unterricht.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst mindestens fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsklärungen (Definition von Jugend und Jugendsprache), Funktionen sprachlicher Merkmale (leider unvollständig im Auszug), Jugendsprache im Deutschunterricht (mit Fokus auf Integration und didaktischen Ansätzen) und ein Fazit (nicht im Auszug enthalten).
Wie wird Jugendsprache in der Hausarbeit definiert?
Die Hausarbeit geht auf die Schwierigkeit ein, Jugendsprache eindeutig zu definieren, da sie eine große Vielfalt an Ausdrucksformen aufweist. Sie präsentiert verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Definition und betont die Herausforderungen bei der eindeutigen Kategorisierung.
Welche Herausforderungen bei der Integration von Jugendsprache in den Unterricht werden diskutiert?
Die Hausarbeit thematisiert mögliche Probleme bei der Integration von Jugendsprache in die schulische Praxis. Es wird auf die didaktische Umsetzung und potentielle Lernwirkungen eingegangen, um aufzuzeigen, wie Jugendsprache als wertvolle Ressource im Unterricht genutzt werden kann, wenn die Herausforderungen angemessen angegangen werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Deutschunterricht, Didaktik, Sprachwandel, Jugendkultur, Linguistik, Interkulturelle Kommunikation, Soziolinguistik, Identität, Kommunikation.
Welche historischen Aspekte der Jugendsprachforschung werden angesprochen?
Die Einleitung beleuchtet den langjährigen Forschungsfokus auf Jugendsprache, beginnend mit frühen Studien zur „Sprache der Halbstarken“ und der „Pennälersprache“, über die „Teenagersprache“ der 60er Jahre bis hin zu den spezifischen Jugendsprachen verschiedener Subkulturen in den folgenden Jahrzehnten.
- Quote paper
- Dipl.-Hdl. Steffen Asendorf (Author), 2006, Jugendsprache im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66117