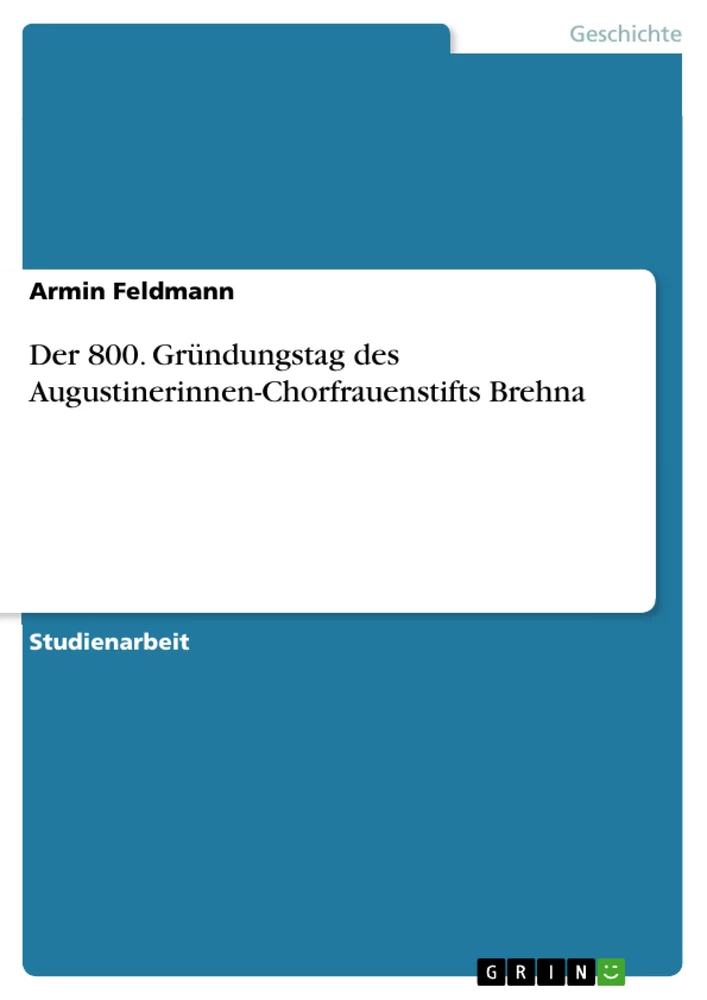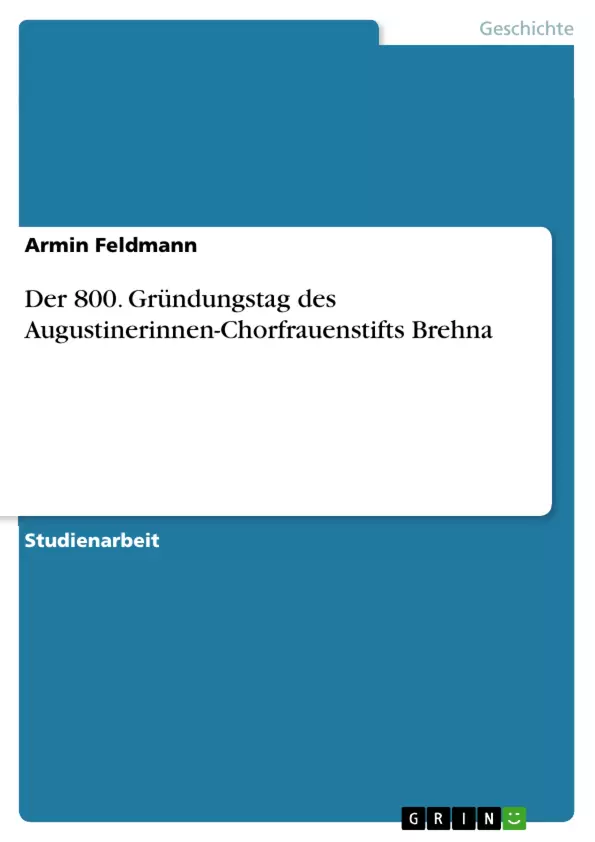Herr Vorsitzender des Kreistages, Herr Landrat, meine Herren Bürgermeister
der Kreisstadt Bitterfeld und der Stadt Brehna! Sehr verehrte Damen und Herren! Vor allem aber: Liebe Brehnaerinnen und Brehnaer! Es ist für mich ein besonderes Ereignis, hier an dieser Stelle sprechen zu dürfen, wo mich
1933 Oberpfarrer Rudolph getauft, 1947 Pastor Möhring mit meinem Schuljahrgang
konfirmiert und 1955 Prediger Fehlauer meine Frau und mich getraut hat, bevor ich dann meinen Geburtsort aus beruflichen Gründen verlassen habe.
Aber nicht meine Geschichte gilt es darzulegen, sondern des 800. Jahrestages der Gründung des Klosters in Brehna ist zu gedenken. Wie war es dazu gekommen?
1053 treten erstmals zwei Grafen von Brehna, nämlich Gero und Thimo, in einer Urkunde in Erscheinung – Herr Bürgermeister Biedermann, am 29. September des übernächsten Jahres steht Ihrem Ort also das 950. Jubiläum seiner Ersterwähnung ins Haus! – Diese Grafen von Brehna gehörten zum Adelsgeschlecht der Wettiner. Ein ganz Wichtiger von diesen Wettinern, Markgraf Konrad der Große von Meißen, der gleichzeitig auch Graf von Brehna war, trat gegen Ende seines Lebens 1156 in das Augustinerkloster auf dem Petersberg ein, der zu dieser Zeit noch Lauterberg genannt
wurde, und bestimmte dieses Kloster als Grablege für seine Familie. Einer seiner Söhne wurde damals als Friedrich I. sein Nachfolger in der Grafschaft Brehna. Und wie es der Vater bestimmt hatte, wurde auch dieser Friedrich bei seinem Tode neben dem Vater auf dem Petersberg beigesetzt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Wie war es dazu gekommen?
- Wovon wurde ein solches Kloster unterhalten?
- An Gebäuden gehörten zum Kloster die Klosterkirche, genannt das Oratorium. Das Refektorium oder der Speisesaal, der auch Remter hieß, schloss sich daran an, und schließlich gehörte das Dormitorium, der Schlafsaal, dazu, wo die Nonnen ihre Klosterzellen hatten. Von weiteren Gebäuden oder Räumen ist nichts bekannt.
- Was die Regeln betrifft, nach denen das Brehnaer Kloster lebte, so waren es die des heiligen Augustinus. Es war ein Augustinerinnenkloster, ein Augustiner-Chorfrauenstift. Geweiht war es dem heiligen Clemens, so dass wir zu der genauen Bezeichnung kommen: „Augustinerinnenkloster St. Clemens zu Brehna“.
- Bei den vielen Schenkungen an das Kloster, die uns überliefert sind, können wir davon ausgehen, dass es ein reiches Stift gewesen ist. Ganze Dörfer wurden ihm übereignet: Kitzendorf, Sandersdorf mit Kolpin, Torna und Heideloh wurden Klostereigentum allein in der kurzen Zeit von 1360 bis 1385. Dem Kloster stand in diesen Dörfern auch die Gerichtsbarkeit zu bis hin zur Verhängung der Todesstrafe. Noch 1525 ließ der Klostervogt in Sandersdorf einen Mann hinrichten. Darüber allerdings kam es zum Streit mit dem Bitterfelder Amtmann und dem neuen sächsischen Kurfürsten Johann dem Beständigen. Das Kloster musste schriftlich versprechen, den Blutbann, wie diese Gerichtsbarkeit auch genannt wurde, nicht wieder auszuüben.
- Dieses Jahr war auch das letzte, in dem das Kloster noch ungestört existieren konnte. Denn sein Ende wurde mit der Reformation eingeleitet. In Brehna wurde 1526 erstmals ein evangelischer oder lutherischer Prediger eingesetzt.
- Noch scheint das Kloster nur wenige Einschränkungen erlebt zu haben. Aber Kurfürst Johann hatte, auch auf Anregung Martin Luthers - Sie wissen ja, dass Katharina von Bora, Luthers spätere Ehefrau, als Kind 4 - 5 Jahre hier in diesem Kloster erzogen worden war, natürlich war sie damals noch keine Nonne -, Kurfürst Johann also hatte eine allgemeine Visitation, eine Überprüfung aller geistlichen Einrichtungen seines Landes, angeordnet.
- Um das ganz deutlich zu sagen: Sowohl nach der Einsetzung des ersten evangelischen Pastors als auch nach dieser Kirchenvisitation von 1531 bestand das Kloster in Brehna nach wie vor. Ausscheidende Nonnen erhielten, wie schon erwähnt, eine Abfindung, so beispielsweise Margarethe Löser 1532 eine jährliche Rente von 30 Gulden und 18 Scheffel Korn. Für Margarethe von der Lochau empfahl ein Mitarbeiter Martin Luthers dem Kurfürsten, ihr 100 Gulden und einen jungen Gesellen zur Ehe zu schenken, aber diese wollte weder Geld noch Mann, sondern wollte Hofdame bei der Kurfürstin werden.
- In den folgenden Jahrzehnten fanden weitere Visitationen statt, bei der von 1555 können wir lesen: „Das Städtlein Brehna hat an die 84 Hauswirte oder Einwohner [Einwohner waren die männlichen Familienvorstände], ohne die Personen, die im Kloster Brehna ihre Unterhaltung haben.“ Wenn man bei den Familien von etwa 8 Personen ausgeht, ergibt das hochgerechnet eine Einwohnerzahl von 600 bis 800. [Ergänzung 2004: laut Blaschke ist das zu hoch angesetzt, er geht von einer Behausungszahl 5 aus, das ergibt 420-450 Einwohner plus der Personen im Kloster.]
- Schließlich gibt es bei dieser Visitation doch einen Hinweis darauf, dass das Kloster als Frauenstift nicht mehr existierte. Bei der Beschreibung des sehr dürftigen Pfarrhauses rät der Pfarrer nämlich davon ab, viel Geld für dessen Modernisierung auszugeben, sondern dass [ich zitiere] „ein wüstes Haus, das dem Kloster gehört und dicht bei der Kirche liegt, das alte Schlafhaus genannt, welches zu nichts gebraucht wird und mit der Zeit baufällig werden könnte, wenn es nicht bewohnt wird, für den Pfarrer, den Kaplan und den Schulmeister als Wohnung hergerichtet werden sollte, was mit geringen Kosten geschehen könnte.“ Dieses alte Schlafhaus ist das frühere Dormitorium der Nonnen, und da es bereits seit geraumer Zeit ungenutzt war, gab es also keine Nonnen mehr in Brehna und damit auch kein Jungfrauenstift mehr, sondern nur das Klostergut mit seinen Gebäuden und weiteren landwirtschaftlichen Besitzungen.
- Was also geblieben war, das war dieses Klostergut unter einem Verwalter. Um 1600 verkaufte es der Kurfürst an den Rat der Stadt Brehna, womit es zu einem Ratsgut wurde. Das Ratsgut war zunächst einem Hofmeister unterstellt und wurde dann ab 1753 für 400 Gulden jährlich verpachtet. Später wurde es sogar in Erbpacht gegeben, bis es der Erbpächter nach 25 Jahren schließlich verkaufte.
- Das ist die letzte Information über das Brehnaer Kloster. Doch halt, eine gibt es noch: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Klosterstraße ihr Name genommen, sie wurde in Pestalozzistraße umbenannt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ansprache gedenkt des 800. Jahrestages der Gründung des Klosters in Brehna und beleuchtet die Geschichte des Klosters von seiner Gründung bis zu seiner Auflösung durch die Reformation. Der Text beschreibt die Geschichte des Klosters, die Lebensbedingungen der Nonnen, die wirtschaftliche Bedeutung des Klosters und die Gründe für seine Auflösung.
- Gründung und Entwicklung des Klosters in Brehna
- Lebensweise und Regeln der Augustinerinnen
- Wirtschaftliche Bedeutung und Besitzungen des Klosters
- Einfluss der Reformation auf das Kloster
- Schließung des Klosters und seine Nachnutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Ansprache beginnt mit einem Rückblick auf die Gründung des Klosters durch Gräfin Hedwig von Brehna im Jahr 1201. Der Text beleuchtet die Geschichte des Klosters, seine Regeln und sein wirtschaftliches Fundament. Es werden die Lebensbedingungen der Nonnen beschrieben, die sich von den Regeln des heiligen Augustinus leiten ließen.
Die Ansprache setzt die Geschichte des Klosters bis zur Reformation fort, die im Jahr 1526 auch in Brehna einsetzte. Der Text erläutert die Auswirkungen der Reformation auf das Kloster, die allmähliche Auflösung des Klosters und die Verwendung des Klosterguts nach der Säkularisation.
Schlüsselwörter
Augustinerinnenkloster, Kloster Brehna, Gräfin Hedwig, Reformation, Säkularisation, Klostergeschichte, Klosterleben, Wirtschaftsgeschichte, Brehna
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde das Kloster Brehna gegründet?
Das Augustinerinnen-Chorfrauenstift wurde im Jahr 1201 durch Gräfin Hedwig von Brehna gegründet.
Nach welchen Regeln lebten die Nonnen im Kloster Brehna?
Das Kloster lebte nach den Regeln des heiligen Augustinus und war dem heiligen Clemens geweiht.
Wie finanzierte sich das Kloster?
Das Kloster war ein reiches Stift, das durch Schenkungen ganzer Dörfer (z.B. Sandersdorf, Heideloh) sowie durch Landwirtschaft und Gerichtsbarkeit unterhalten wurde.
Welche Rolle spielte Katharina von Bora für Brehna?
Katharina von Bora, die spätere Ehefrau Martin Luthers, wurde als Kind etwa vier bis fünf Jahre lang im Kloster Brehna erzogen.
Wie kam es zum Ende des Klosters?
Mit der Einführung der Reformation (ab 1526) und anschließenden Visitationen wurde das Kloster schrittweise aufgelöst und in ein landwirtschaftliches Klostergut umgewandelt.
- Quote paper
- Dipl.-Lehrer Armin Feldmann (Author), 2001, Der 800. Gründungstag des Augustinerinnen-Chorfrauenstifts Brehna, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66140