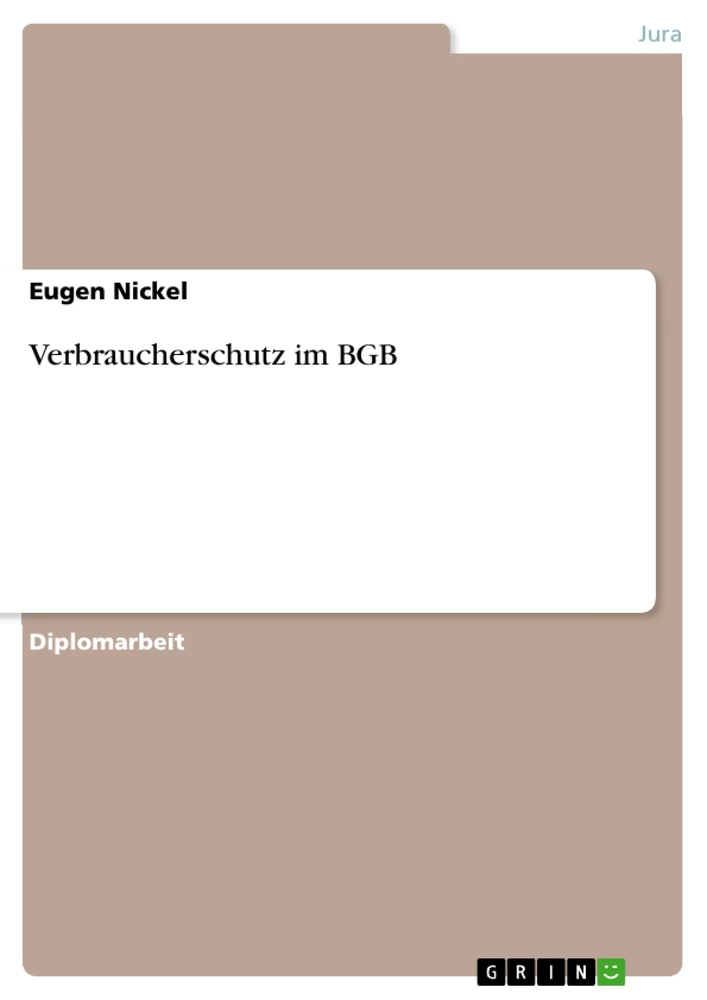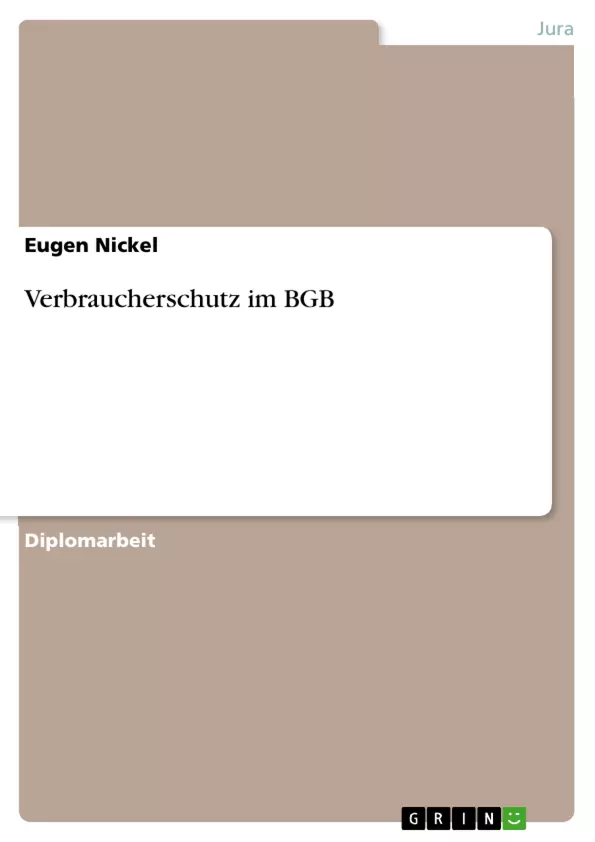Wird zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ein Vertrag geschlossen, so besteht für den Verbraucher bei bestimmten Vertragstypen bzw. bei Verträgen, die unter bestimmten Umständen zustande kommen, insbesondere aufgrund des Informationsdefizits und infolge unsachlicher Beeinflussung die Gefahr, dass er vom Unternehmer übervorteilt wird. Die Gefahr besteht u. a. darin, dass der Verbraucher einen Vertrag abschließt, den er eigentlich gar nicht abschließen will, oder auch darin, dass er einen Vertrag mit solchen Vertragsbedingungen abschließt, die ihn unangemessen benachteiligen. Deshalb wird der Verbraucher in solchen Fällen durch zahlreiche gesetzliche Vorschriften besonders geschützt.
Im deutschen Recht gibt es kein gesondertes Gesetz, das alle Fragen des Verbraucherschutzrechts regeln würde. Verbraucherschutzrecht ist vielmehr auf eine Vielzahl von Gesetzen verstreut. Die zentralen Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers vor einer Übervorteilung bei Vertragsschluss mit einem Unternehmer finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Sie werden durch Vorschriften im Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), im Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) sowie in der BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV) ergänzt. Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Weitere Vorschriften finden sich etwa im Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG).
Ferner wird der Verbraucher im Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) vor fehlerhaften Produkten außerhalb vom vertraglichen Schuldverhältnis besonders geschützt. Kommt es bei einem Verbraucher durch den Fehler eines Produkts zu Schäden, so ist der Hersteller des Produkts dazu verpflichtet, dem Verbraucher den entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Verbraucher wird im ProdHaftG insoweit besonders geschützt, dass es dort eine verschuldensunabhängige Haftung des Herstellers begründet wird, während in solchen Fällen grundsätzlich nur derjenige zum Schadensersatz verpflichtet ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig handelt (§ 823 Abs. 1 BGB). U. a. wird der Verbraucher auch im Wettbewerbsrecht, vor allem im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geschützt. Das UWG enthält Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers vor unlauteren Wettbewerbshandlungen, insbesondere vor irreführender Werbung sowie unzumutbarer Belästigung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 EG-Einfluss und Schuldrechtsmodernisierung
- 3 Verbraucher in Abgrenzung zum Unternehmer
- 3.1 Der Verbraucherbegriff
- 3.2 Der Unternehmerbegriff
- 3.2.1 Unternehmer i. S. d. § 14 Abs. 1 BGB
- 3.2.2 Rechtsfähige Personengesellschaft i. S. d. § 14 Abs. 2 BGB
- 4 Verbraucherleitbild
- 5 Instrumente des privatrechtlichen Verbraucherschutzes
- 5.1 Informationspflichten
- 5.2 Widerrufs- und Rückgaberecht
- 5.2.1 Voraussetzungen des Widerrufsrechts
- 5.2.2 Widerrufserklärung
- 5.2.3 Beginn der Widerrufsfrist
- 5.2.4 Länge der Widerrufsfrist, Erlöschen des Widerrufsrechts
- 5.2.5 Ersetzung des Widerrufsrechts durch ein Rückgaberecht
- 5.2.6 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe
- 5.3 Besondere Vertragsgestaltung, Inhaltskontrolle von AGB
- 5.4 Einschränkung der Rechtswahlfreiheit
- 5.4.1 Verbraucherverträge
- 5.4.2 Verbraucherschutz in EU- und EWR-Staaten
- 5.5 Unterlassungsanspruch der Verbraucherschutzverbände
- 6 Verbraucherschutz bei Vertragsschluss
- 6.1 Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch AGB
- 6.1.1 Einbeziehung von AGB in den Vertrag
- 6.1.2 Inhaltskontrolle
- 6.1.3 Besonderheiten bei Verbraucherverträgen
- 6.1.4 Sonstige Besonderheiten
- 6.1.5 Umgehungsverbot
- 6.2 Besondere Vertriebsformen
- 6.2.1 Haustürgeschäfte
- 6.2.1.1 Begriff des Haustürgeschäfts
- 6.2.1.2 Widerrufsrecht
- 6.2.2 Fernabsatzverträge
- 6.2.2.1 Begriff des Fernabsatzvertrags
- 6.2.2.2 Informationspflichten
- 6.2.2.3 Widerrufsrecht
- 6.2.3 E-Commerce-Verträge
- 6.2.3.1 Begriff des E-Commerce-Vertrags
- 6.2.3.2 Informationspflichten und sonstige Pflichten
- 6.2.4 Unabdingbarkeit
- 6.2.1 Haustürgeschäfte
- 6.3 Verbrauchsgüterkauf
- 6.3.1 Begriff des Verbrauchsgüterkaufs
- 6.3.2 Besondere Vertragsgestaltung
- 6.3.3 Rückgriff des Unternehmers
- 6.4 Teilzeit-Wohnrechteverträge
- 6.4.1 Begriff des Teilzeit-Wohnrechtevertrags
- 6.4.2 Informationspflichten, Prospektpflicht
- 6.4.3 Schriftform, Vertragsinhalt
- 6.4.4 Widerrufsrecht, Anzahlungsverbot
- 6.4.5 Unabdingbarkeit
- 6.5 Verbraucherdarlehensvertrag; Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
- 6.5.1 Verbraucherdarlehensvertrag
- 6.5.1.1 Begriff des Verbraucherdarlehensvertrags
- 6.5.1.2 Schriftform, Vertragsinhalt
- 6.5.1.3 Widerrufsrecht
- 6.5.1.4 Besondere Vertragsgestaltung
- 6.5.2 Finanzierungshilfen
- 6.5.3 Ratenlieferungsverträge
- 6.5.4 Unabdingbarkeit
- 6.5.1 Verbraucherdarlehensvertrag
- 6.6 Darlehensvermittlungsvertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
- 6.6.1 Begriff des Darlehensvermittlungsvertrags
- 6.6.2 Schriftform, Vertragsinhalt
- 6.6.3 Besondere Vertragsgestaltung
- 6.6.4 Unabdingbarkeit
- 6.7 Verbundene Verträge
- 6.7.1 Begriff des verbundenen Vertrags
- 6.7.2 Widerrufsdurchgriff
- 6.7.3 Einwendungsdurchgriff
- 6.1 Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch AGB
- 7 Schutz des Verbrauchers vor wettbewerbswidrigen Vertriebspraktiken
- 7.1 Unbestellte Leistungen
- 7.2 Gewinnzusagen
- 8 Schutz des Verbrauchers vor fehlerhaften Produkten
- 8.1 Haftung
- 8.2 Inhalt des Schadensersatzanspruchs
- 8.3 Verjährung, Erlöschen von Ansprüchen
- 8.4 Unabdingbarkeit
- 9 Verbraucherschutz aus der Sicht des Unternehmers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Verbraucherschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Ziel ist es, die zentralen Regelungen und Instrumente des Verbraucherschutzes im BGB zu analysieren und deren Bedeutung für den Schutz der Verbraucherrechte darzulegen. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der EU-Rechtsetzung auf die Schuldrechtsmodernisierung und geht auf verschiedene Vertragsarten und Vertriebsformen ein.
- Verbraucherbegriff und Abgrenzung zum Unternehmer
- Instrumente des privatrechtlichen Verbraucherschutzes (Informationspflichten, Widerrufsrecht)
- Verbraucherschutz bei spezifischen Vertragsabschlüssen (AGB, Fernabsatz, Haustürgeschäft)
- Schutz vor wettbewerbswidrigen Praktiken und fehlerhaften Produkten
- Verbraucherschutz aus Unternehmersicht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Verbraucherschutzes im BGB ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Es liefert einen Überblick über die Bedeutung des Verbraucherschutzes im modernen Wirtschaftsleben und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Der Leser wird auf die zentralen Fragestellungen der Arbeit vorbereitet und mit der notwendigen Terminologie vertraut gemacht.
2 EG-Einfluss und Schuldrechtsmodernisierung: Dieses Kapitel beleuchtet den erheblichen Einfluss der Europäischen Gemeinschaft (EG) auf die Modernisierung des deutschen Schuldrechts, insbesondere im Bereich des Verbraucherschutzes. Es analysiert, wie EU-Richtlinien und -Verordnungen die nationalen Regelungen beeinflusst und zu einer Harmonisierung des Verbraucherschutzes in Europa geführt haben. Konkrete Beispiele für die Anpassung des deutschen Rechts an europäische Vorgaben werden dargestellt, um die Reichweite und Bedeutung dieses Einflusses zu veranschaulichen. Die Diskussion um die Notwendigkeit und die Auswirkungen der Modernisierung wird ebenfalls thematisiert.
3 Verbraucher in Abgrenzung zum Unternehmer: Dieses Kapitel befasst sich mit der präzisen Definition der Begriffe "Verbraucher" und "Unternehmer" im Sinne des BGB. Es untersucht die Kriterien, die zur Unterscheidung zwischen Verbrauchern und Unternehmern herangezogen werden, und beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen dieser Unterscheidung für den anwendbaren Verbraucherschutz. Die Diskussion umfasst die Abgrenzung von juristischen Personen und die besonderen Regelungen für Personengesellschaften. Die Bedeutung der korrekten Einstufung für die Anwendung der Verbraucherschutzbestimmungen wird hervorgehoben.
4 Verbraucherleitbild: Kapitel 4 untersucht das in der Rechtsprechung und Gesetzgebung implizite oder explizite Verbraucherleitbild. Es analysiert, welches Bild vom Verbraucher der Gesetzgeber zugrunde legt und wie dieses Bild die Gestaltung des Verbraucherschutzes beeinflusst. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zum Verbraucherleitbild diskutiert und deren praktische Relevanz im Kontext der Verbraucherschutzbestimmungen des BGB untersucht. Dabei wird die Frage beleuchtet, inwieweit das Verbraucherleitbild den tatsächlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Verbraucher entspricht und ob es einer Anpassung bedarf.
5 Instrumente des privatrechtlichen Verbraucherschutzes: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Instrumente des privatrechtlichen Verbraucherschutzes im BGB detailliert dargestellt und analysiert. Es konzentriert sich auf Informationspflichten, Widerrufs- und Rückgaberechte und die Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die Kapitel erläutert die Voraussetzungen und Rechtsfolgen dieser Instrumente und geht auf die verschiedenen Ausnahmen und Einschränkungen ein. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung dieser Instrumente und ihrer Bedeutung für den Schutz der Verbraucher.
6 Verbraucherschutz bei Vertragsschluss: Dieses Kapitel analysiert den Verbraucherschutz im Zusammenhang mit verschiedenen Vertragsabschlüssen. Es untersucht die spezifischen Regelungen für Haustürgeschäfte, Fernabsatzverträge, E-Commerce-Verträge, den Verbrauchsgüterkauf, Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verbraucherdarlehensverträge und verbundene Verträge. Für jede Vertragsart werden die besonderen Vorschriften im Hinblick auf Informationspflichten, Widerrufsrechte, Inhaltskontrolle und weitere Regelungen im Detail erläutert und verglichen. Die Bedeutung dieser Regelungen für den effektiven Verbraucherschutz wird hervorgehoben.
7 Schutz des Verbrauchers vor wettbewerbswidrigen Vertriebspraktiken: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Schutz der Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken, die gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Es untersucht den rechtlichen Rahmen und die Sanktionsmöglichkeiten im Falle von unzulässigen Vertriebsmethoden. Konkrete Beispiele für wettbewerbswidrige Praktiken, wie z.B. unbestellte Leistungen oder irreführende Gewinnzusagen, werden analysiert. Die Bedeutung einer effektiven Durchsetzung des Wettbewerbsrechts für den Verbraucherschutz wird hervorgehoben.
8 Schutz des Verbrauchers vor fehlerhaften Produkten: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Schutz der Verbraucher vor Schäden, die durch fehlerhafte Produkte entstehen. Es untersucht die Haftung des Herstellers, des Verkäufers und anderer Beteiligter und die Rechtsfolgen für den Verbraucher. Die verschiedenen Arten von Ansprüchen (Schadensersatz, Minderung, Rücktritt) werden erläutert und die Verjährungsfristen diskutiert. Die Bedeutung von Produkthaftungsregelungen für den effektiven Verbraucherschutz wird betont.
9 Verbraucherschutz aus der Sicht des Unternehmers: Dieses Kapitel betrachtet den Verbraucherschutz aus der Perspektive des Unternehmers. Es analysiert die rechtlichen Anforderungen und Herausforderungen, die sich aus den Verbraucherschutzbestimmungen für Unternehmen ergeben. Die Bedeutung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für den Unternehmenserfolg wird diskutiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und der Schaffung von Vertrauen beim Verbraucher.
Schlüsselwörter
Verbraucherschutz, BGB, Schuldrechtsmodernisierung, EG-Einfluss, Verbraucherbegriff, Unternehmerbegriff, Informationspflichten, Widerrufsrecht, AGB, Haustürgeschäfte, Fernabsatzverträge, E-Commerce, Verbrauchsgüterkauf, Verbraucherdarlehensvertrag, Wettbewerbsrecht, Produkthaftung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Verbraucherschutz im BGB
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Verbraucherschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), untersucht zentrale Regelungen und Instrumente, und beleuchtet deren Bedeutung für den Schutz von Verbraucherrechten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der EU-Rechtsetzung und der Betrachtung verschiedener Vertragsarten und Vertriebsformen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Verbraucherbegriff und seine Abgrenzung zum Unternehmer, die Instrumente des privatrechtlichen Verbraucherschutzes (wie Informationspflichten und Widerrufsrechte), den Verbraucherschutz bei spezifischen Vertragsabschlüssen (AGB, Fernabsatz, Haustürgeschäfte etc.), den Schutz vor wettbewerbswidrigen Praktiken und fehlerhaften Produkten sowie den Verbraucherschutz aus Unternehmersicht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung und der Darstellung des Einflusses der EU-Rechtsetzung. Es folgen Kapitel zur Abgrenzung von Verbrauchern und Unternehmern, zum Verbraucherleitbild, zu den Instrumenten des Verbraucherschutzes und zum Verbraucherschutz bei verschiedenen Vertragsschlussarten (z.B. Haustürgeschäfte, Fernabsatzverträge, E-Commerce, Verbrauchsgüterkauf, Verbraucherdarlehensverträge). Abschließende Kapitel behandeln den Schutz vor wettbewerbswidrigen Praktiken und fehlerhaften Produkten sowie den Verbraucherschutz aus der Perspektive des Unternehmers.
Welche Vertragsarten werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert den Verbraucherschutz bei Haustürgeschäften, Fernabsatzverträgen, E-Commerce-Verträgen, Verbrauchsgüterkauf, Teilzeit-Wohnrechteverträgen, Verbraucherdarlehensverträgen, Darlehensvermittlungsverträgen und verbundenen Verträgen. Für jede Vertragsart werden die spezifischen Vorschriften zu Informationspflichten, Widerrufsrechten, Inhaltskontrolle und weiteren Regelungen erläutert und verglichen.
Welche Rolle spielt die EU-Rechtsetzung?
Die Arbeit beleuchtet den erheblichen Einfluss der Europäischen Gemeinschaft (EG) auf die Modernisierung des deutschen Schuldrechts im Bereich des Verbraucherschutzes. Es wird analysiert, wie EU-Richtlinien und -Verordnungen die nationalen Regelungen beeinflusst und zu einer Harmonisierung des Verbraucherschutzes in Europa geführt haben.
Was sind die wichtigsten Instrumente des privatrechtlichen Verbraucherschutzes?
Zu den wichtigsten Instrumenten gehören Informationspflichten, Widerrufs- und Rückgaberechte sowie die Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die Arbeit erläutert die Voraussetzungen und Rechtsfolgen dieser Instrumente und geht auf Ausnahmen und Einschränkungen ein.
Wie wird der Verbraucher vor wettbewerbswidrigen Praktiken geschützt?
Die Arbeit untersucht den rechtlichen Rahmen und die Sanktionsmöglichkeiten bei unzulässigen Vertriebsmethoden, wie z.B. unbestellte Leistungen oder irreführende Gewinnzusagen. Die Bedeutung einer effektiven Durchsetzung des Wettbewerbsrechts für den Verbraucherschutz wird hervorgehoben.
Wie ist der Verbraucher vor fehlerhaften Produkten geschützt?
Die Arbeit behandelt den Schutz vor Schäden durch fehlerhafte Produkte, die Haftung des Herstellers, Verkäufers und anderer Beteiligter, verschiedene Arten von Ansprüchen (Schadensersatz, Minderung, Rücktritt) und die Verjährungsfristen. Die Bedeutung von Produkthaftungsregelungen wird betont.
Welche Perspektive auf den Verbraucherschutz wird eingenommen?
Die Arbeit betrachtet den Verbraucherschutz sowohl aus der Sicht des Verbrauchers als auch aus der Sicht des Unternehmers. Es werden die rechtlichen Anforderungen und Herausforderungen für Unternehmen beleuchtet, und die Bedeutung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für den Unternehmenserfolg wird diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Verbraucherschutz, BGB, Schuldrechtsmodernisierung, EG-Einfluss, Verbraucherbegriff, Unternehmerbegriff, Informationspflichten, Widerrufsrecht, AGB, Haustürgeschäfte, Fernabsatzverträge, E-Commerce, Verbrauchsgüterkauf, Verbraucherdarlehensvertrag, Wettbewerbsrecht, Produkthaftung.
- Arbeit zitieren
- Eugen Nickel (Autor:in), 2006, Verbraucherschutz im BGB, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66188