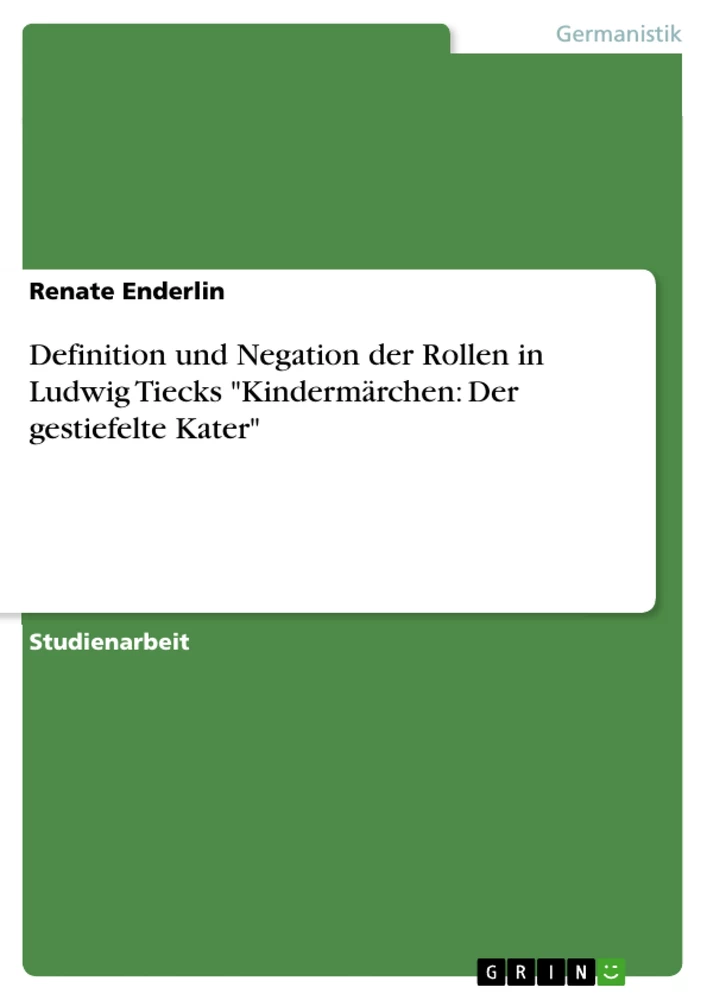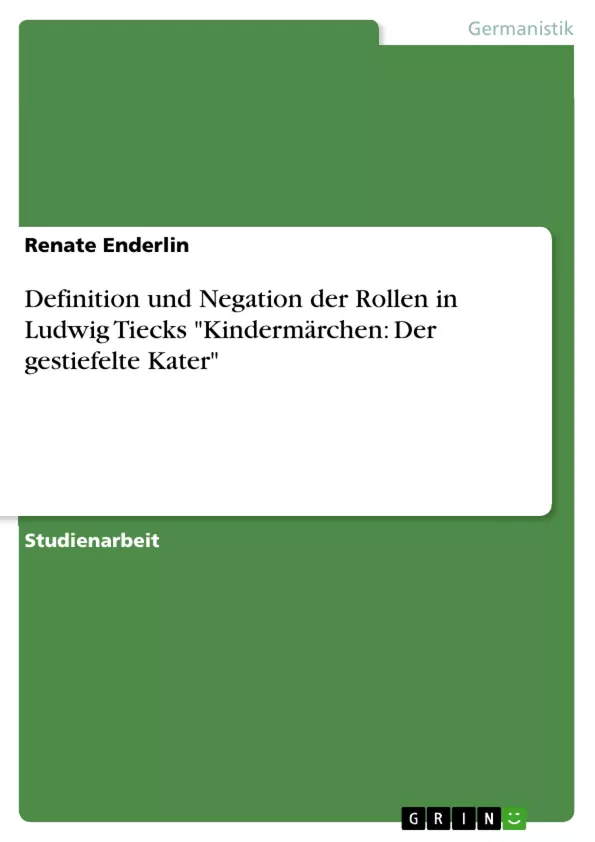Ludwig Tieck hat in "Der gestiefelte Kater", seinem "Kindermärchen in drei Akten" nicht nur eine Menge Rollen entworfen, sondern seine Figuren auch aus ihren Rollen geworfen. Die Analyse des Aus-der-Rolle-Fallens auf der Tieckschen Bühne ist spannend, weil es einerseits Ähnlichkeiten mit dem Aus-seiner-Rolle-Fallen im wirklichen, sozialen Leben und andererseits ganz unterschiedliche Ursachen und Konsequenzen des Aus-der-Rolle-Fallens gibt, die in dieser Arbeit dargestellt werden sollen; wobei ich nicht bloß theoretisch über Begriff, Form und Funktion des Aus-der-Rolle-Fallens sprechen, sondern vor allem seine Praxis im Text "Der gestiefelte Kater" aufzeigen möchte.
Theater auf dem Theater und Spiel im Spiel erzeugen Fiktion und Illusionsstörung zugleich und nebenbei auch jede Menge Komik. Es werden Rollen gezeigt, die sich über ihren Kontext, ihre Konstanz, Maske und Funktion definieren, um diese auch gleich wieder zu vergessen. Daher erzeugt das aus der Rolle Fallen durch Kontextwechsel und unbeständige Charaktere, Auftritt ohne Maske oder mit alter Maske und neuer Aufgabe, sowohl Fiktion als auch Illusionsstörung und Komik. Im gesamten Stück kommen zahlreiche Formen der Illusionsstörung vor – Widersprüche, Tabubrüche, Intertextualität, Kontraste, und Rollenverlust. Sowohl Autor und Schauspieler, als auch Publikum und Kritiker werden zum komischen Gegenstand gemacht. Die Bühne treibt mit sich selber Scherz; bei Tieck – so scheint es – bis zum Exzess.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ausrollen der Thematik
- 2. Identität und Negation der Rolle
- 2.1 Rolle und Kontext
- 2.2 Rolle und Konstanz
- 2.3 Rolle und Maske
- 2.4 Rolle und Aufgabe
- 3. Konsequenz und Funktion des aus-der-Rolle-Fallens
- 3.1 Fiktionsbruch oder Fiktionsstörung
- 3.2 Das aus-der-Rolle-Fallen als Eigenleistung
- 3.3 Komik
- 4. Identität und Negation einiger Rollen im Tieckschen Stück
- 4.1 Der Kater
- 4.1.1 Rolle und Kontext
- 4.1.2 Rolle und Konstanz
- 4.1.3 Rolle und Maske
- 4.1.4 Rolle und Aufgabe
- 4.2 Gottlieb
- 4.2.1 Rolle und Kontext
- 4.2.2 Rolle und Konstanz
- 4.2.3 Rolle und Maske
- 4.2.4 Rolle und Aufgabe
- 4.3 Der König
- 4.3.1 Rolle und Kontext
- 4.3.2 Rolle und Konstanz
- 4.3.3 Rolle und Maske
- 4.3.4 Rolle und Aufgabe
- 4.4 Hanswurst
- 4.5 Der Besänftiger
- 4.6 Die Rolle des Dichters
- 4.7 Die Rolle der Zuschauer
- 4.1 Der Kater
- 5. Die Rolle der Bühne
- 6. Einrollen des Themas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Phänomen des Aus-der-Rolle-Fallens in Ludwig Tiecks „Der gestiefelte Kater“. Ziel ist es, die verschiedenen Ursachen und Konsequenzen dieses Phänomens zu untersuchen und die Rolle selbst differenziert zu betrachten. Die Arbeit konzentriert sich auf die praktische Anwendung dieser Thematik im Text, anstatt sich auf rein theoretische Überlegungen zu beschränken.
- Identität und Negation von Rollen im Stück
- Konsequenzen und Funktionen des Aus-der-Rolle-Fallens
- Der Einfluss von Kontext und Rahmen auf die Rollen
- Komik und Ironie als Ergebnis des Rollenspiels
- Die besondere Rolle des Publikums und des Dichters
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ausrollen der Thematik: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Analyse des Aus-der-Rolle-Fallens in Tiecks „Der gestiefelte Kater“. Es wird betont, dass das Phänomen des Aus-der-Rolle-Fallens vielfältige Ursachen und Konsequenzen hat und dass die Arbeit sowohl theoretische als auch praktische Aspekte beleuchten wird. Die ungewöhnliche Gestaltung des Personenverzeichnisses wird als ein frühes Beispiel für die Brechung von Konventionen und die Erzeugung von Komik und Ironie im Stück hervorgehoben. Der Text wird als Lesedrama betrachtet und die fiktive Natur des Stücks wird betont. Der Fokus liegt auf der Analyse der Figuren und deren Rollen im fiktiven Kontext des Stücks.
2. Identität und Negation der Rolle: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Aus-der-Rolle-Fallens. Es wird die Rolle im Kontext des gesamten Stücks betrachtet und die Wechselbeziehung zwischen Situation und Rolle betont. Die Bedeutung des Kontextes und der Gesamtkonstellation des Rollenregisters für das Verständnis des Aus-der-Rolle-Fallens wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Rolle, Identität und deren Entwicklung im Kontext der fiktiven Theaterwelt Tiecks.
3. Konsequenz und Funktion des aus-der-Rolle-Fallens: In diesem Kapitel werden die Konsequenzen des Aus-der-Rolle-Fallens, insbesondere Fiktionsbruch, Komik und Ironie, untersucht. Es wird analysiert, wie das Aus-der-Rolle-Fallen im Kontext des Stücks funktioniert und ob es die Illusion des Lesers stört. Die besondere Struktur des Stücks mit der fiktiven Bühne innerhalb der Bühne und dem fiktiven Publikum wird als Erklärung dafür herangezogen, warum das Aus-der-Rolle-Fallen nicht zwingend illusionsstörend wirkt. Die Rolle des Autors und des Dichters innerhalb dieses Rahmens wird ebenso beleuchtet.
4. Identität und Negation einiger Rollen im Tieckschen Stück: Dieses Kapitel analysiert spezifische Rollen im Stück ("Der Kater", "Gottlieb", "Der König", "Hanswurst", "Der Besänftiger", "Die Rolle des Dichters", "Die Rolle der Zuschauer"), und untersucht deren Identität und wie sie mit dem Konzept des Aus-der-Rolle-Fallens interagieren. Es wird sich detailliert mit dem Kontext, der Konstanz, der Maske und der Aufgabe jeder Rolle auseinandergesetzt. Durch die Einzelanalysen wird ein umfassendes Verständnis der Rollenstruktur und ihrer Funktion im Gesamtwerk erlangt.
5. Die Rolle der Bühne: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung und Funktion der Bühne als Raum und als strukturierendes Element im Stück. Die Zweiteilung der Bühne (Zuschauerraum und Bühne auf der Bühne) und deren Einfluss auf die Wahrnehmung der fiktiven Handlungsebenen werden erörtert. Der besondere Umgang Tiecks mit der Bühnenillusion und der Frage nach dem Fiktionsbruch im Kontext des doppelten Bühnenraums steht im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Rollenspiel, Aus-der-Rolle-Fallen, Ludwig Tieck, Der gestiefelte Kater, Komik, Ironie, Fiktion, Kontext, Identität, Maske, Bühne, Theater, Lesedrama, Personenverzeichnis, Konventionen.
Häufig gestellte Fragen zu Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das Phänomen des Aus-der-Rolle-Fallens in Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater". Sie untersucht die Ursachen und Konsequenzen dieses Phänomens und betrachtet die Rolle selbst differenziert, sowohl theoretisch als auch in der praktischen Anwendung im Text.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Identität und Negation von Rollen, die Konsequenzen und Funktionen des Aus-der-Rolle-Fallens, den Einfluss von Kontext und Rahmen auf die Rollen, Komik und Ironie als Ergebnis des Rollenspiels sowie die besondere Rolle des Publikums und des Dichters.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 ("Ausrollen der Thematik") führt in die Fragestellung ein. Kapitel 2 ("Identität und Negation der Rolle") legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 3 ("Konsequenz und Funktion des aus-der-Rolle-Fallens") untersucht die Konsequenzen wie Fiktionsbruch und Komik. Kapitel 4 ("Identität und Negation einiger Rollen im Tieckschen Stück") analysiert spezifische Rollen im Detail. Kapitel 5 ("Die Rolle der Bühne") analysiert die Bedeutung der Bühne. Kapitel 6 ("Einrollen des Themas") ist vermutlich der Schluss.
Wie werden die Rollen im Stück analysiert?
Die Analyse der Rollen (Kater, Gottlieb, König, Hanswurst, Besänftiger, Dichter, Zuschauer) untersucht deren Identität, Kontext, Konstanz, Maske und Aufgabe im Hinblick auf das Aus-der-Rolle-Fallen. Die Einzelanalysen tragen zu einem umfassenden Verständnis der Rollenstruktur bei.
Welche Rolle spielt die Bühne in der Analyse?
Die Bedeutung und Funktion der Bühne als Raum und strukturierendes Element wird untersucht, insbesondere die Zweiteilung der Bühne (Zuschauerraum und Bühne auf der Bühne) und deren Einfluss auf die Wahrnehmung der fiktiven Handlungsebenen und den Umgang mit der Bühnenillusion.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Rollenspiel, Aus-der-Rolle-Fallen, Ludwig Tieck, Der gestiefelte Kater, Komik, Ironie, Fiktion, Kontext, Identität, Maske, Bühne, Theater, Lesedrama, Personenverzeichnis und Konventionen.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist hierarchisch aufgebaut und gliedert die Arbeit in Haupt- und Unterkapitel, die verschiedene Aspekte des Aus-der-Rolle-Fallens und die jeweiligen Rollen im Stück detailliert untersuchen.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die Inhalte jedes Kapitels und zeigt die Argumentationslinie der Seminararbeit auf.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel ist es, das Phänomen des Aus-der-Rolle-Fallens in Tiecks "Der gestiefelte Kater" zu analysieren und die verschiedenen Ursachen und Konsequenzen zu untersuchen, wobei die Rolle selbst differenziert betrachtet wird. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Thematik im Text.
- Quote paper
- Renate Enderlin (Author), 2004, Definition und Negation der Rollen in Ludwig Tiecks "Kindermärchen: Der gestiefelte Kater", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66205