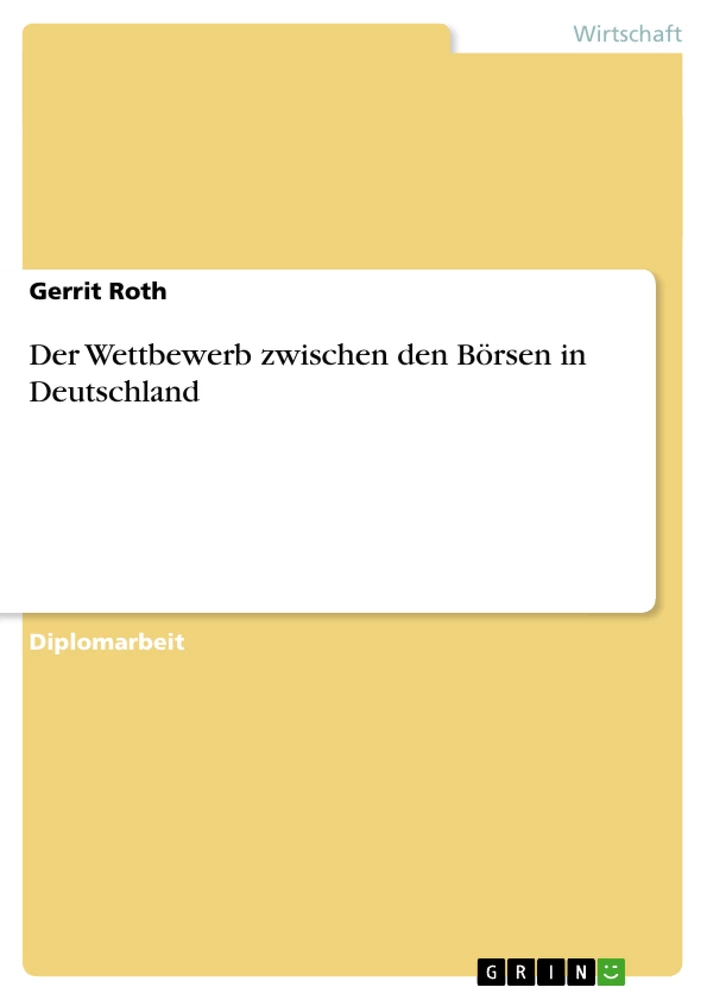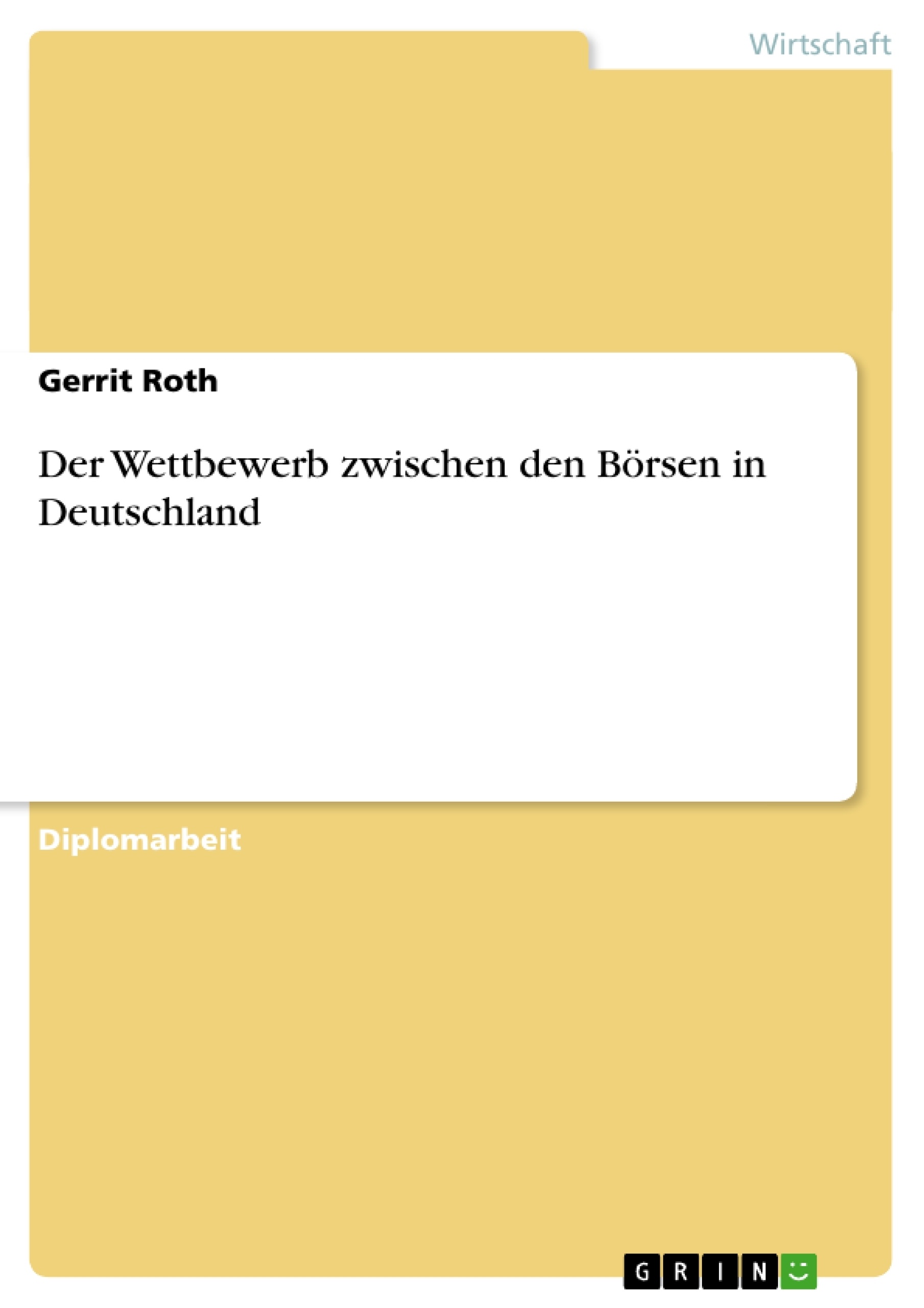Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, in dem es noch immer mehrere verschiedene Börsenplätze gibt: Neben der elektronischen Handelsplattform Xetra und der Frankfurter Wertpapierbörse die Regionalbörsen in Stuttgart, Düsseldorf, München, Hannover, Bremen, Hamburg und Berlin. Auf europäischer Ebene hingegen schreitet die Konzentration im Börsenwesen weiter voran: Im September 2000 schlossen sich die Börsen Brüssel, Amsterdam und Paris zu Euronext zusammen. Die Fusion zwischen Frankfurt und London zum Börsenplatz iX scheiterte zwar, ist aber anscheinend noch immer nicht völlig vom Tisch.
Ist die Börsenvielfalt innerhalb Deutschlands also nur ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, als jeder an der geographisch nächstliegenden Börse handelte? Mit der elektronischen Handelsplattform Xetra hat die Deutsche Börse AG, Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse, ein inzwischen sehr liquides Börsensystem geschaffen, das für alle Anleger zugänglich ist. Den Regionalbörsen bleiben da nur noch geringe Umsätze, die mit Frankfurt und erst recht Xetra kaum noch verglichen werden können. Bei vielen Aktien wird an den Regionalbörsen noch nicht einmal an jedem Handelstag eine Transaktion abgeschlossen.
Wie kann es sein, dass bei so geringer Liquidität trotzdem die Regionalbörsen als Handelsplattformen weiterbestehen? Denn ein Prinzip des Börsenwesens ist: Ein Markt braucht genügend Liquidität, um bestehen zu können. Durch größere Liquidität wiederum wird ein Markt attraktiver und zieht mehr Liquidität an. In Deutschland jedoch dominiert die Frankfurter Börse schon seit langem. Trotzdem hat noch keine der Regionalbörsen ihren Betrieb eingestellt, sondern alle erwirtschaften ohne Subventionen Gewinne. Nach Rekordgewinnen im Jahr 2000 sind diese inzwischen allerdings rückläufig.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Beschreibung des deutschen Börsenwesens
- A. Unterscheidung der Marktsysteme
- 1. Dealer-Markt (quote driven)
- 2. Auktionsmarkt (order driven)
- B. Einordnung der deutschen Börsen
- C. Empirische Studien
- A. Unterscheidung der Marktsysteme
- III. Theorien
- A. Börsen als Firmen
- B. Börsen als Broker-Dealer
- C. Börsen als Märkte
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Wettbewerb zwischen den deutschen Börsenplätzen. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Marktsysteme, die Rolle der elektronischen Handelsplattform Xetra und den Fortbestand der Regionalbörsen trotz geringer Liquidität. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Faktoren zu verstehen, die den Wettbewerb und das Überleben der einzelnen Börsen prägen.
- Untersuchung verschiedener Börsenmodelle
- Analyse des Wettbewerbs zwischen Xetra und den Regionalbörsen
- Bewertung der Bedeutung von Liquidität für den Börsenhandel
- Einfluss von Marktsystemen (Dealer- vs. Auktionsmarkt) auf den Wettbewerb
- Wirtschaftliche Faktoren des Überlebens der Regionalbörsen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den deutschen Börsenmarkt mit seiner Vielfalt an Börsenplätzen (Xetra und Regionalbörsen) vor und hebt den Kontrast zur zunehmenden Konzentration auf europäischer Ebene hervor. Sie wirft die Frage auf, warum die Regionalbörsen trotz geringer Liquidität und der Dominanz der Frankfurter Börse weiterhin bestehen und Gewinne erwirtschaften, obwohl ein Prinzip des Börsenwesens genügend Liquidität für das Bestehen erfordert. Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Welche Faktoren ermöglichen das Überleben der Regionalbörsen im Wettbewerb mit Xetra?
II. Beschreibung des deutschen Börsenwesens: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die verschiedenen Systeme des Börsenhandels, insbesondere den Dealer-Markt (quote driven) und den Auktionsmarkt (order driven). Es ordnet die deutschen Börsen in diese Systematik ein und analysiert die Marktanteile der verschiedenen Börsenplätze. Dabei werden die Eigenschaften der einzelnen Börsen (z.B. Xetra, Regionalbörsen) sowie empirische Daten zu Spreads und Transaktionsgrößen untersucht. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Funktionsweise des deutschen Börsenmarktes und seiner verschiedenen Akteure.
III. Theorien: Dieser Abschnitt befasst sich mit verschiedenen theoretischen Modellen, um den Wettbewerb zwischen den Börsen zu erklären. Es werden Börsen als Firmen, Broker-Dealer und Märkte betrachtet. Die Modelle des inkompatiblen und kompatiblen Netzwerks werden analysiert, um das Verhalten der verschiedenen Akteure im Börsenwettbewerb zu verstehen. Weiterhin wird die Rolle des Eigenhandels und die Verarbeitung öffentlicher Informationen untersucht, um das Marktgeschehen besser zu erklären und die verschiedenen Strategien der Börsen im Wettbewerb zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Börsenwettbewerb, Xetra, Regionalbörsen, Dealer-Markt, Auktionsmarkt, Liquidität, Marktanteile, Spreads, Transaktionskosten, Börsenmodelle, Netzwerktheorie.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Wettbewerb der deutschen Börsenplätze
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Wettbewerb zwischen deutschen Börsenplätzen, insbesondere zwischen Xetra und den Regionalbösen. Sie analysiert die verschiedenen Marktsysteme, die Rolle von Xetra und den Fortbestand der Regionalbörsen trotz geringer Liquidität. Das zentrale Thema ist die Identifizierung der wirtschaftlichen Faktoren, welche den Wettbewerb und das Überleben der einzelnen Börsen prägen.
Welche Marktsysteme werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Dealer-Märkten (quote driven) und Auktionsmärkten (order driven). Sie ordnet die deutschen Börsen diesen Systemen zu und analysiert deren Auswirkungen auf den Wettbewerb.
Welche Rolle spielt Xetra?
Die Arbeit analysiert die Rolle der elektronischen Handelsplattform Xetra im Wettbewerb mit den Regionalbörsen und untersucht deren Auswirkungen auf den Marktanteil und die Liquidität.
Warum bestehen Regionalbörsen trotz geringer Liquidität?
Dies ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Sie untersucht die wirtschaftlichen Faktoren, die das Überleben der Regionalbörsen trotz der Dominanz von Xetra und des Liquiditätsprinzips ermöglichen.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene theoretische Modelle, um den Börsenwettbewerb zu erklären. Sie betrachtet Börsen als Firmen, Broker-Dealer und Märkte. Die Modelle inkompatibler und kompatibler Netzwerke werden analysiert, um das Verhalten der Akteure zu verstehen. Die Rolle des Eigenhandels und die Verarbeitung öffentlicher Informationen werden ebenfalls untersucht.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit nutzt empirische Daten zu Spreads, Transaktionsgrößen und Marktanteilen der verschiedenen Börsenplätze, um die Funktionsweise des deutschen Börsenmarktes und die Strategien der einzelnen Börsen im Wettbewerb zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Börsenwettbewerb, Xetra, Regionalbörsen, Dealer-Markt, Auktionsmarkt, Liquidität, Marktanteile, Spreads, Transaktionskosten, Börsenmodelle, Netzwerktheorie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Beschreibung des deutschen Börsenwesens, ein Kapitel zu den relevanten Theorien und ein Fazit. Die Einleitung stellt den deutschen Börsenmarkt vor und führt in die Forschungsfrage ein. Das zweite Kapitel beschreibt die verschiedenen Marktsysteme und die deutschen Börsen. Das dritte Kapitel behandelt die theoretischen Modelle. Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist in der bereitgestellten Vorschau nicht im Detail enthalten und müsste aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.)
- Quote paper
- Gerrit Roth (Author), 2002, Der Wettbewerb zwischen den Börsen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6625