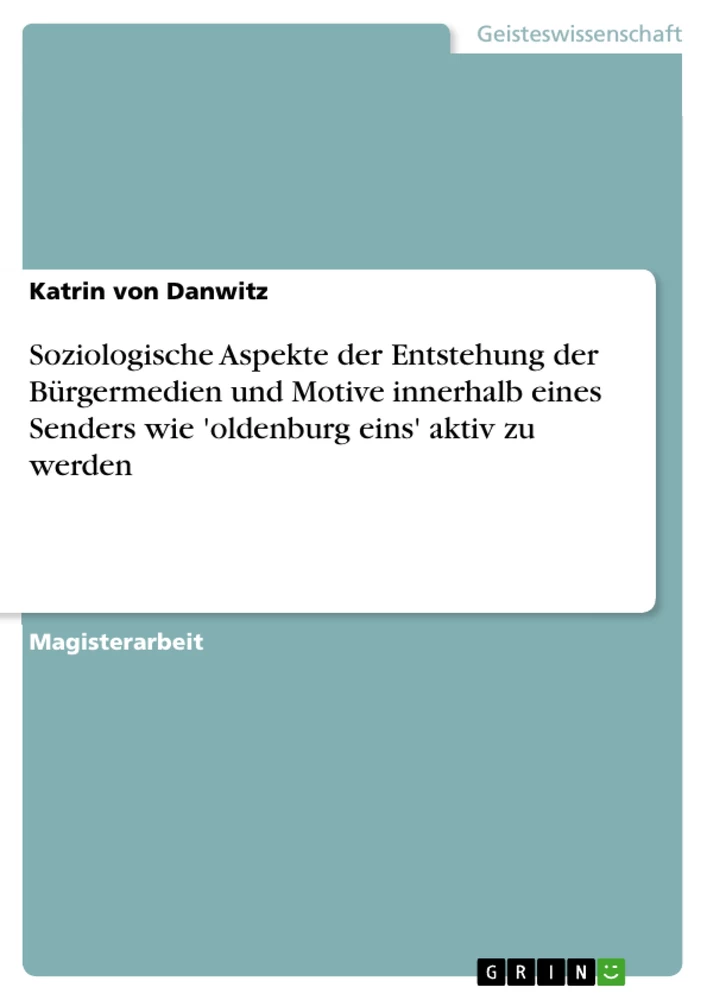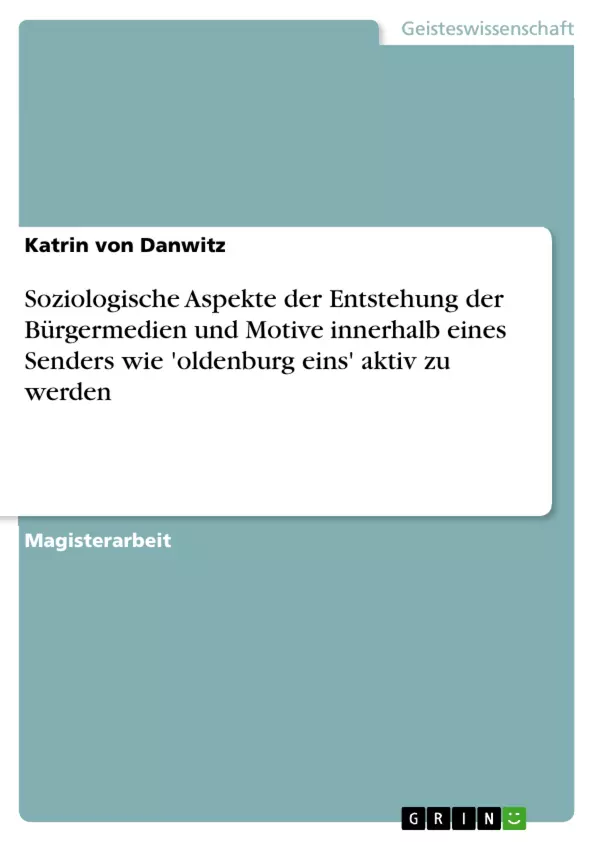In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, was die Gründe dafür sind, warum sich Menschen in Bürgermedien wie "oldenburg eins" engagieren. Es soll also in erster Linie um die Motivation, also die persönlichen Beweggründe für das Engagement der oeins-Akiven gehen.
Zunächst sollen jedoch die Motive derjenigen, die an der Gründung von Bürgermedien beteiligt waren, in den Blick genommen werden.
Um nachvollziehen zu können, auf welchem ideengeschichtlichen Fundament die Anliegen der deutschen Medienpolitik gründeten, widmet sich das zweite Kapitel den soziologischen Vordenkern einer stärkeren Beteiligung der Bürger an den Medien.
Danach sollen die Gründungsgeschichte und die Aufgaben des Senders „oldenburg eins“ betrachtet werden.
Anschließend folgt die Vorstellung der in diesem Sender durchgeführten empirischen Erhebung. Die unentgeltlich im Sender aktiven Personen wurden per Fragebogen und in Leitfadeninterviews unter anderem danach gefragt, warum sie sich – ohne eine finanzielle Anerkennung dafür zu erhalten – bei „oldenburg eins“ engagieren. Das Anliegen dieser Arbeit, die Motive der oeins-Aktiven aufzuzeigen, ist unter anderem durch die Notwendigkeit begründet, bestimmte Bevölkerungsgruppen noch stärker und gezielter zu einer Mitarbeit bei oeins zu motivieren. So könnte der Sender noch stärker seiner Aufgabe der Förderung von Medienkompetenz für alle Bevölkerungsschichten nachkommen. Welche Bevölkerungsgruppen zurzeit noch besonders unterrepräsentiert bei „oldenburg eins“ sind, wird die im vierten Kapitel folgende Auswertung der Untersuchung zeigen. Darüber hinaus sollen auf der Basis der Erkenntnisse, die durch die Untersuchung gewonnen wurden, auch Empfehlungen gegeben werden, wie „oldenburg eins“ die Arbeit für die im Sender aktiven Personen angenehmer gestalten könnte, also, wie die Aktiven langfristig an oeins gebunden werden können.
Als einer der letzten Punkte schließt sich ein vergleichender Rückblick auf die soziologischen Vordenker mit den heutigen Motiven der oeins-Aktiven an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziologische Vordenker einer stärkeren Beteiligung der Bürger an den Medien
- Kant und Hegel: Gegenüberstellung dieser frühen Vordenker durch Habermas
- Berthold Brecht: das Radio als Kommunikationsapparat
- Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
- Paul Felix Lazarsfeld und Robert King Merton: die Funktionsweisen der Massenmedien
- Hans Magnus Enzensberger: Plädoyer für einen emanzipatorischen Mediengebrauch
- Oskar Negt und Alexander Kluge: Aufforderung zur Schaffung von Gegenprodukten
- Pierre Bourdieu: Über das Fernsehen
- Carmen Thomas: Fernsehen sollte ein demokratisches Dienstleistungsgewerbe sein
- Peter-Jürgen Schneider: Bürgerbeteiligung in der modernen Gesellschaft
- Der Sender „oldenburg eins“
- Die Gründungsgeschichte
- Die Leitziele und Aufgaben von Bürgermedien wie oeins und Einordnung in die niedersächsische Medienlandschaft
- Befragung der oeins-Aktiven
- Vorstellung der Befragungsinstrumente
- Ergebnisse der quantitativen Untersuchung
- Geschlecht, Alter und Bildungsstand
- Exkurs: Einordnung der oeins-Aktiven in Schulzes Milieumodell
- Wochenstunden bei oeins
- Hauptarbeitsbereich
- Wie sind die Befragten auf oeins aufmerksam geworden
- Rückschlüsse auf die Wirkung unterschiedlicher Rekrutierungsinstrumente
- Motive zur Mitarbeit bei oeins
- Vorerfahrungen im Medienbereich
- Annahmen über die Motive der Gründer von oeins
- Geschlecht, Alter und Bildungsstand
- Auswertung der einzelnen Leitfadeninterviews
- Auswertung des Interviews mit Paul
- Auswertung des Interviews mit Pia
- Auswertung des Interviews mit Peter
- Auswertung des Interviews mit Frauke
- Auswertung des Interviews mit Fabian
- Auswertung des Interviews mit Fritz
- Auswertung des Interviews mit Nina
- Auswertung des Interviews mit Nick
- Auswertung des Interviews mit Niels
- Querschnittsanalyse der Interviews und Vergleich mit den Ergebnissen der quantitativen Untersuchung
- Vergleichender Rückblick auf die soziologischen Vordenker unter Einbeziehung der Clusteranalyse von Rager und Rinsdorf
- Motivation der oeins-Aktiven
- Motive der Gründer von „oldenburg eins“
- Soziologische Theorien zur Bürgerbeteiligung in den Medien
- Empirische Untersuchung der oeins-Aktiven
- Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit soziologischen Theorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Motive der Aktiven im Bürgermediensender „oldenburg eins". Dabei werden sowohl die persönlichen Beweggründe für das Engagement der Aktiven als auch die Motive der Gründer des Senders analysiert. Darüber hinaus werden die soziologischen Vordenker einer stärkeren Bürgerbeteiligung in den Medien beleuchtet und die Erkenntnisse der Untersuchung mit diesen Theorien in Beziehung gesetzt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und stellt die Forschungsfrage nach den Motiven der Aktiven im Bürgermediensender „oldenburg eins" dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die soziologischen Vordenker einer stärkeren Bürgerbeteiligung in den Medien und setzt diese im Kontext der Entstehung von Bürgermedien in Deutschland in Beziehung. Das dritte Kapitel betrachtet die Gründungsgeschichte und die Aufgaben des Senders „oldenburg eins". Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung der oeins-Aktiven vorgestellt, welche durch Fragebögen und Leitfadeninterviews gewonnen wurden. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und stellt die Ergebnisse in einen Vergleich mit den soziologischen Theorien des zweiten Kapitels.
Schlüsselwörter
Bürgermedien, „oldenburg eins", Motivation, Bürgerbeteiligung, Medienlandschaft, Soziologie, Empirische Untersuchung, Leitfadeninterviews, Fragebögen, Theorien, Vordenker, Kant, Hegel, Brecht, Benjamin, Lazarsfeld, Merton, Enzensberger, Negt, Kluge, Bourdieu, Thomas, Schneider, Medienkompetenz, Clusteranalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was motiviert Menschen, bei Bürgermedien wie "oldenburg eins" mitzuarbeiten?
Motive sind unter anderem der Erwerb von Medienkompetenz, die Freude am kreativen Gestalten und das Interesse an lokaler Berichterstattung ohne Bezahlung.
Welche soziologischen Theorien stützen die Bürgerbeteiligung an Medien?
Vordenker wie Bertolt Brecht (Radio als Kommunikationsapparat) oder Hans Magnus Enzensberger plädierten für einen emanzipatorischen Mediengebrauch durch Bürger.
Was ist das Ziel von Sendern wie "oldenburg eins"?
Hauptziele sind die Förderung der Medienkompetenz, die Bereitstellung eines offenen Zugangs für alle Bürger und die Schaffung von lokalen Gegenprodukten zum Massenfernsehen.
Wie sieht die typische Nutzerschaft von Bürgermedien aus?
Die Arbeit untersucht mittels quantitativer Erhebung Faktoren wie Alter, Geschlecht und Bildungsstand und ordnet diese in Milieumodelle ein.
Welche Bevölkerungsgruppen sind in Bürgermedien unterrepräsentiert?
Die Studie zeigt auf, welche Schichten noch gezielter motiviert werden müssten, um eine breitere demokratische Teilhabe zu gewährleisten.
- Quote paper
- Katrin von Danwitz (Author), 2006, Soziologische Aspekte der Entstehung der Bürgermedien und Motive innerhalb eines Senders wie 'oldenburg eins' aktiv zu werden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66279