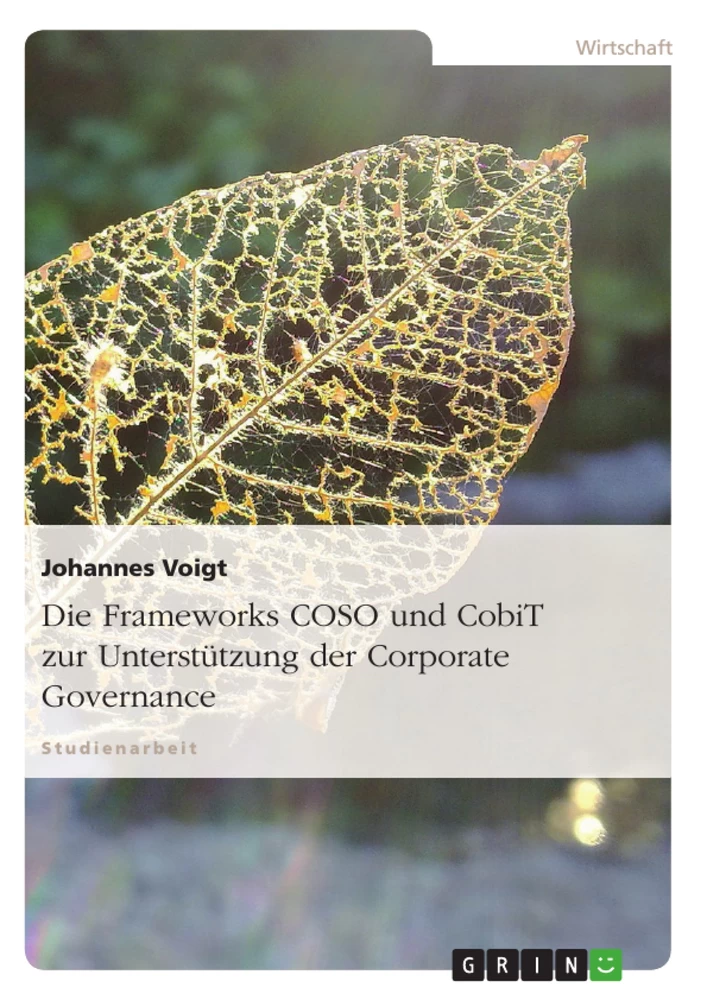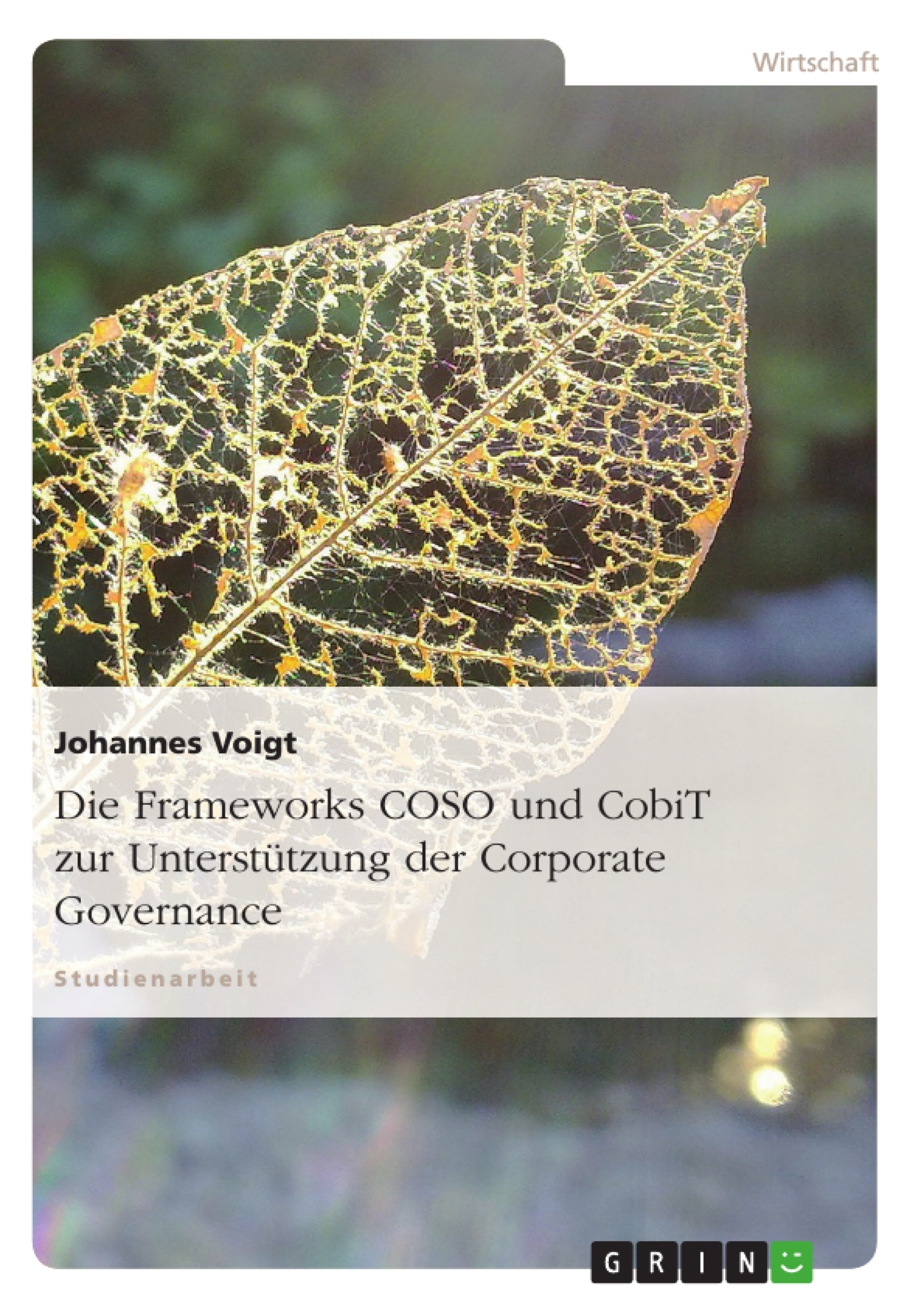Geeignete Corporate Governance Strukturen in Unternehmen einführen und neuartigen gesetzlichen Anforderungen genügen. Diese beiden Aspekte stellen für Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaftswelt zwei zentrale Herausforderungen dar.
Zur Umsetzung bedient sich das strategische Management häufig generischer Frameworks. Insbesondere, wenn die Notwendigkeit der Anwendung aus legalen Anforderungen resultieren. In diesem Zusammenhang werden im vorliegenden Text insbesondere die Frameworks COSO und CobiT detailliert betrachtet und zielgerichtete Lösungsmöglichkeiten zur Realisierung der legalen Anforderungen an Management und Unternehmens-IT aufgezeigt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 2. Sarbanes-Oxley Act
- 2.1 Internes Kontrollsystem
- 3. COSO
- 3.1 COSO Internal Control - Integrated Framework
- 3.1.1 Control Environment (Kontrollumfeld)
- 3.1.2 Risk Assessment (Risikobeurteilungen)
- 3.1.3 Control Activities (Kontrollaktivitäten)
- 3.1.4 Information and Communication (Information und Kommunikation)
- 3.1.5 Monitoring (Überwachung)
- 3.2 COSO ERM - Enterprise Risk Management
- 3.2.1 Internal Environment (Internes Umfeld)
- 3.2.2 Objective Settings (Zielbestimmung)
- 3.2.3 Event Identification (Identifizierung von Ereignissen)
- 3.2.4 Risk Assessment (Risikobewertung)
- 3.2.5 Risk Response (Risikosteuerung)
- 3.2.6 Control Activities (Kontrollaktivitäten)
- 3.2.7 Information and Communication (Information und Kommunikation)
- 3.2.8 Monitoring (Überwachung)
- 3.3 Zwischenergebnis COSO
- 4. CobiT 4.0
- 4.1 Vorstellung des Berufsverbands ISACA
- 4.2 CobiT Framework
- 4.3 Detailbetrachtung der 34 kritischen IT-Prozesse
- 4.3.1 High-Level Control Objectives und Detailed Control Objectives
- 4.3.2 Management Guidelines
- 4.3.3 CobiT Maturity Model
- 4.4 Zusammenfassung CobiT
- 5. Gemeinsame Anwendung von COSO und CobiT
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Rahmenwerken COSO und CobiT und untersucht deren Einsatzmöglichkeiten zur Unterstützung der Corporate Governance. Das Ziel ist es, die beiden Frameworks im Kontext der Unternehmenssteuerung zu analysieren und deren Vorteile für die Verbesserung der internen Kontrolle und des Risikomanagements aufzuzeigen.
- Die Entwicklung und Bedeutung von Corporate Governance im modernen Unternehmensumfeld
- Die Anwendung des Sarbanes-Oxley Act und dessen Einfluss auf die interne Kontrolle
- Die Konzepte und Komponenten des COSO Frameworks (Internal Control - Integrated Framework und Enterprise Risk Management)
- Die Struktur und Anwendung des CobiT Frameworks für das IT-Governance und -Risikomanagement
- Die Möglichkeiten zur gemeinsamen Anwendung von COSO und CobiT zur Optimierung der Unternehmenssteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Seminararbeit vor und skizziert den Hintergrund und die Relevanz der Thematik. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der Corporate Governance beleuchtet, insbesondere die Entstehung und Relevanz des Sarbanes-Oxley Act. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem COSO Framework, wobei sowohl das Internal Control - Integrated Framework als auch das Enterprise Risk Management Framework ausführlich behandelt werden. Kapitel vier führt das CobiT Framework vor, inklusive einer Darstellung des Berufsverbands ISACA und der Kernkomponenten des Frameworks. Die Anwendung der beiden Frameworks im Kontext der Corporate Governance wird in Kapitel fünf betrachtet, bevor die Seminararbeit in Kapitel sechs mit einem Fazit und einem Ausblick abgeschlossen wird.
Schlüsselwörter
COSO, CobiT, Corporate Governance, Internes Kontrollsystem, Risikomanagement, IT-Governance, Sarbanes-Oxley Act, Unternehmenssteuerung, Compliance, Management
Häufig gestellte Fragen
Was sind COSO und CobiT?
COSO und CobiT sind generische Frameworks, die Unternehmen dabei unterstützen, interne Kontrollsysteme (IKS) und IT-Governance-Strukturen zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu etablieren.
Welche Rolle spielt der Sarbanes-Oxley Act (SOX)?
Der SOX stellt hohe Anforderungen an die Transparenz und Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung, was den Einsatz von Frameworks wie COSO zur internen Kontrolle notwendig macht.
Was sind die Kernkomponenten von COSO ERM?
Dazu gehören das interne Umfeld, Zielbestimmung, Ereignisidentifikation, Risikobewertung, Risikosteuerung, Kontrollaktivitäten, Information/Kommunikation und Überwachung.
Was ist der Fokus von CobiT 4.0?
CobiT konzentriert sich auf die Steuerung und Überwachung der IT durch 34 kritische IT-Prozesse, Management Guidelines und ein Reifegradmodell (Maturity Model).
Können COSO und CobiT gemeinsam angewendet werden?
Ja, die gemeinsame Anwendung ermöglicht eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung, die sowohl die geschäftliche Ebene (COSO) als auch die IT-Ebene (CobiT) abdeckt.
- Arbeit zitieren
- Diplom Betriebswirt (FH) Johannes Voigt (Autor:in), 2006, Die Frameworks COSO und CobiT zur Unterstützung der Corporate Governance, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66299