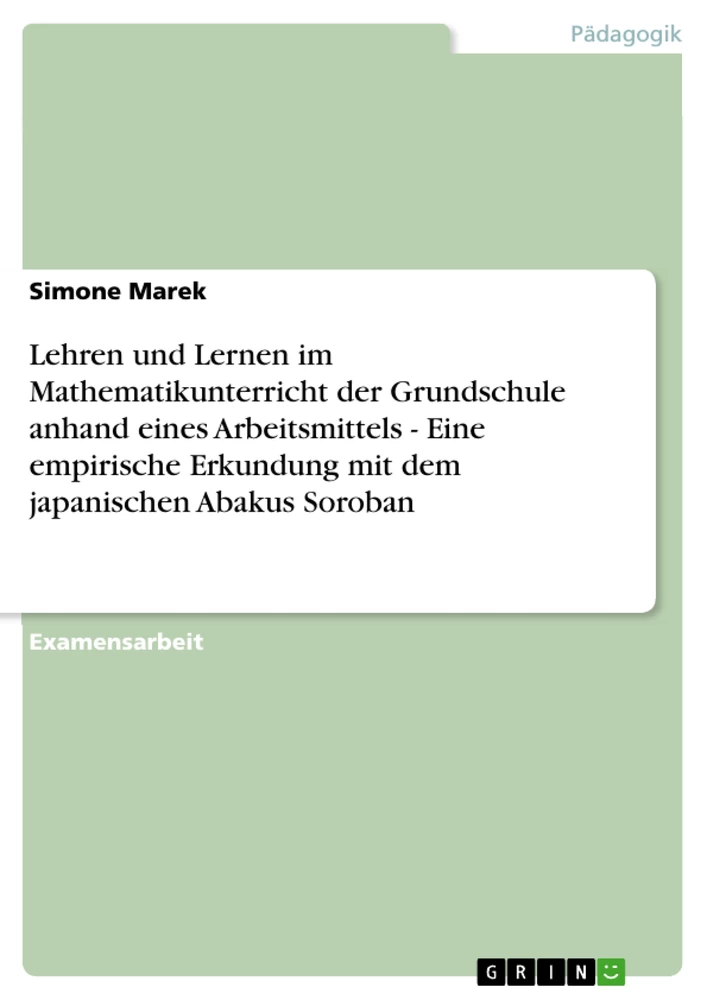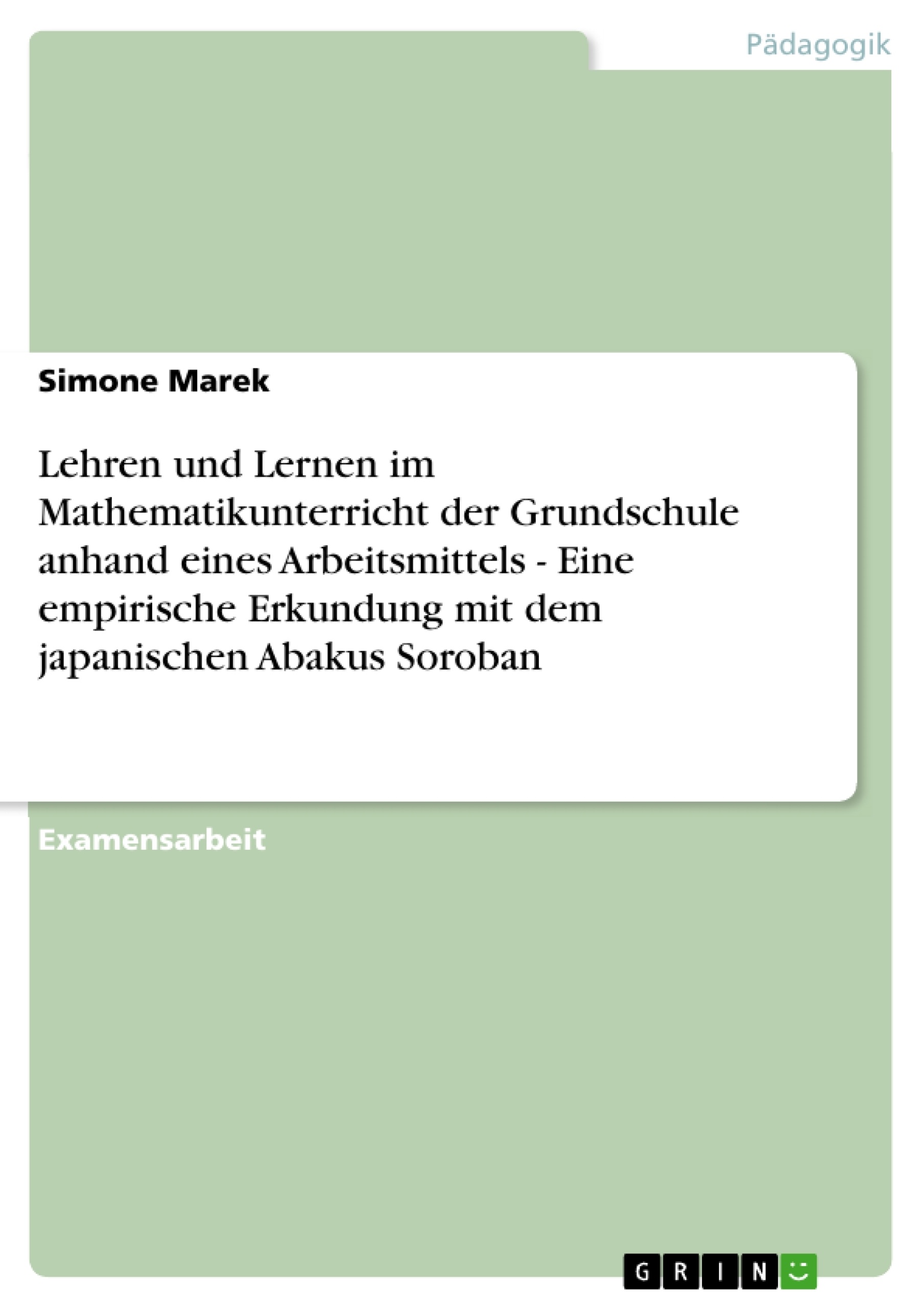Der Abakus gehört zu einer der ältesten Rechenhilfsmittel der Welt und ist trotz heutiger Computertechnologie noch immer in vielen Haushalten und Klassenzimmern als Rechenhilfe für Kinder vertreten. Der Abakus wird häufig im Mathematikunterricht der Grundschule verwendet und ist unter anderem auch unter den Begriffen Rechenschieber, russische Rechenmaschine oder Kugelrechenbrett bekannt. Obwohl der Abakus in der Didaktik der Mathematik als hilfreiches Arbeitsmittel für Kinder anerkannt ist, gibt es sogar noch immer den abwertenden Ausdruck der Idiotenharfe.
Egal unter welchem Begriff uns der Abakus bekannt ist, in den westlichen Kulturen denken wir sofort an einen Rahmen mit zehn Stäben mit je zehn Kugeln, angepasst an das Dezimalsystem. Doch es existieren auch andere Varianten des Abakus, die in asiatischen Ländern vor mehreren hundert Jahren entstanden. Im Folgenden soll einer dieser asiatischen Rechenmaschinen genauer für den Einsatz im Mathematikunterricht der Grundschule betrachtet werden: der japanische Abakus Soroban.
Entstanden ist die Idee bei einem Besuch am 30. Nov. 2006 im Arithmeum in Bonn, einer zentralen Einrichtung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität dieser Stadt. Das Arithmeum stellt verschiedenste Rechenmaschinen aus vergangener und heutiger Zeit aus und sollte mir als Inspiration für ein Arbeitsmittel für die Grundschulmathematik verhelfen.
Diese Inspiration sollte nicht zu einer Ideenfindung für ein komplett neues Arbeitsmittel dienen, da ich kurz zuvor mit Prof. Dr. Dr. E. Ch. Wittmann per E-Mail in Kontakt stand, der mir Folgendes riet: „BeiArbeitsmitteln vertrete ich ganz entschieden die These ‚Weniger ist mehr’. Daher möchte ich Sie ermuntern, lieber mit einem bewährten, schon vorhandenen Material zu arbeiten.“
Als ich im Museum auf den Soroban aufmerksam wurde, prasselten die Ideen regelrecht auf mich nieder: Eine jahrhunderte alte Rechenhilfe aus Japan sollte zu einem grundschulgerechten Arbeitsmittel für den Mathematikunterricht werden. Zum einen faszinierte es mich, dass dieser Rechenrahmen zwar sehr alt ist, aber noch heute vereinzelt in Japan verwendet wird, so dass es sich aufgrund dessen um eine sehr sinnvolle Rechenhilfe handeln muss. Der historische Hintergrund und das Rechnen auf dem Soroban werden in Kapitel 2 behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Soroban – Ein Exkurs
- Historische Entstehung
- Ziffer, Zahl und Abakus
- Die Entstehung des Soroban
- Rechnen mit dem Soroban
- Vielfalt der Soroban-Variationen
- Zahldarstellung natürlicher Zahlen und Dezimalbrüche
- Rechenverfahren
- Fingertechnik
- Didaktische Anforderungen an Arbeitsmittel
- Sinn und Zweck von Arbeitsmittel
- Didaktische Beurteilungskriterien
- Der Soroban als Arbeitsmittel in der Grundschule
- Der Soroban für Grundschulkinder
- Aufbau und Aussehen des Sorobans
- Theoretische Kriterien und Erwartungen an den Soroban
- Lehren und Lernen mit dem Soroban – Eine empirische Erkundung
- Beweggründe für eine Erkundung am Soroban
- Vorbereitungen und die Auswahl der Schulkinder
- Transkripte und Erläuterungen zu den empirischen Untersuchungsergebnissen
- Reflektion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz des japanischen Abakus, des Soroban, als Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule. Ziel ist es, die Eignung des Soroban als didaktisches Hilfsmittel zu evaluieren und seine Anwendung im Unterricht empirisch zu erforschen. Die Arbeit beleuchtet sowohl den historischen Hintergrund des Soroban als auch seine didaktischen Möglichkeiten.
- Der Soroban als historisches Recheninstrument und seine Funktionsweise.
- Didaktische Kriterien für den Einsatz von Arbeitsmitteln im Mathematikunterricht.
- Empirische Untersuchung der Anwendung des Soroban bei Grundschulkindern.
- Bewertung der Vor- und Nachteile des Soroban im Vergleich zu anderen Rechenhilfen.
- Reflexion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen für den Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Abakus im Allgemeinen und den Soroban im Speziellen vor. Sie beschreibt die Motivation der Autorin, das historische Recheninstrument für den Einsatz im Grundschulmathematikunterricht zu untersuchen. Die Arbeit begründet die Wahl des Soroban als Forschungsgegenstand durch seinen historischen Wert und die Möglichkeit einer empirischen Untersuchung mit Kindern ohne Vorerfahrung. Es wird dargelegt, dass die Arbeit in Kapitel 2 den historischen Hintergrund und die Funktionsweise des Soroban erläutert, Kapitel 3 didaktische Kriterien für Arbeitsmittel beleuchtet, Kapitel 4 den speziell für Grundschulkinder entwickelten Soroban beschreibt, Kapitel 5 die empirische Untersuchung dokumentiert und Kapitel 6 die Ergebnisse reflektiert.
Der Soroban – Ein Exkurs: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte und Funktionsweise des Soroban. Es wird die historische Entwicklung des Abakus im Allgemeinen und des Soroban im Besonderen detailliert dargestellt, einschließlich der verschiedenen Varianten. Der Fokus liegt auf der Zahldarstellung und den Rechenverfahren (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) auf dem Soroban, einschließlich der Beschreibung der Fingertechnik. Die Vielseitigkeit des Soroban und seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Rechenaufgaben werden hervorgehoben.
Didaktische Anforderungen an Arbeitsmittel: In diesem Kapitel werden die allgemeinen didaktischen Anforderungen an Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule beleuchtet. Es werden Kriterien für die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln definiert und diskutiert, welche Aspekte zu berücksichtigen sind, um den Lernprozess optimal zu unterstützen. Der Abschnitt legt den Fokus auf den Sinn und Zweck von Arbeitsmitteln und welche Faktoren zur didaktischen Beurteilung herangezogen werden können.
Der Soroban als Arbeitsmittel in der Grundschule: Dieses Kapitel beschreibt den speziell für die Grundschule entwickelten Soroban. Es werden Aufbau, Aussehen und die dahinterstehenden didaktischen Überlegungen detailliert erläutert. Die Autorin beschreibt die theoretischen Kriterien und Erwartungen, die an diesen speziell angefertigten Soroban gestellt wurden, um seine Eignung für den Einsatz im Grundschulkontext zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der kindgerechten Gestaltung und der Variabilität des Sorobans für verschiedene Jahrgangsstufen.
Lehren und Lernen mit dem Soroban – Eine empirische Erkundung: Das Kapitel dokumentiert die empirische Untersuchung mit drei Grundschulkindern der 3. Klasse. Es beschreibt die Beweggründe für die Wahl der Methode, die Vorbereitung und Auswahl der Teilnehmer, sowie die Durchführung der Untersuchung über einen Zeitraum von zehn Übungsstunden. Die transkribierten Interviews und detaillierten Beschreibungen der Untersuchungssituation liefern Einblicke in den Lernprozess der Kinder und ihre Erfahrungen mit dem Soroban. Der Fokus liegt auf der Analyse des Lernfortschritts und den beobachteten Schwierigkeiten und Erfolgen.
Schlüsselwörter
Soroban, japanischer Abakus, Mathematikunterricht, Grundschule, Arbeitsmittel, Rechenhilfe, empirische Untersuchung, Didaktik, Rechenverfahren, Lernprozess, Kinder, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Soroban als Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz des japanischen Abakus, des Soroban, als Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule. Das Ziel ist die Evaluierung der Eignung des Soroban als didaktisches Hilfsmittel und die empirische Erforschung seiner Anwendung im Unterricht.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund des Soroban, seine Funktionsweise, didaktische Kriterien für den Einsatz von Arbeitsmitteln im Mathematikunterricht, eine empirische Untersuchung der Anwendung des Soroban bei Grundschulkindern, die Bewertung von Vor- und Nachteilen im Vergleich zu anderen Rechenhilfen und eine Reflexion der Ergebnisse mit Schlussfolgerungen für den Unterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Soroban – Ein Exkurs (inklusive historischer Entstehung, Rechnen mit dem Soroban und Fingertechnik), Didaktische Anforderungen an Arbeitsmittel, Der Soroban als Arbeitsmittel in der Grundschule, Lehren und Lernen mit dem Soroban – Eine empirische Erkundung und Reflektion und Fazit.
Was wird im Kapitel "Der Soroban – Ein Exkurs" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte und Funktionsweise des Soroban. Es beschreibt detailliert die historische Entwicklung des Abakus und des Soroban, verschiedene Varianten, die Zahldarstellung, Rechenverfahren (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) und die Fingertechnik. Die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit des Soroban werden hervorgehoben.
Welche didaktischen Anforderungen an Arbeitsmittel werden diskutiert?
Das Kapitel "Didaktische Anforderungen an Arbeitsmittel" definiert und diskutiert Kriterien für die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln im Mathematikunterricht der Grundschule. Es werden Aspekte beleuchtet, die den Lernprozess optimal unterstützen, sowie Faktoren zur didaktischen Beurteilung.
Wie wird der Soroban für die Grundschule beschrieben?
Das Kapitel "Der Soroban als Arbeitsmittel in der Grundschule" beschreibt einen speziell für die Grundschule entwickelten Soroban. Es erläutert detailliert Aufbau, Aussehen und die didaktischen Überlegungen dahinter. Die theoretischen Kriterien und Erwartungen an diesen Soroban werden im Hinblick auf seine Eignung für den Grundschulkontext beschrieben.
Wie wird die empirische Untersuchung durchgeführt?
Im Kapitel "Lehren und Lernen mit dem Soroban – Eine empirische Erkundung" wird eine empirische Untersuchung mit drei Grundschulkindern der 3. Klasse dokumentiert. Es werden die Beweggründe, die Vorbereitung, die Auswahl der Teilnehmer, die Durchführung der Untersuchung (zehn Übungsstunden), transkribierte Interviews und detaillierte Beschreibungen der Untersuchungssituation erläutert. Der Fokus liegt auf der Analyse des Lernfortschritts, Schwierigkeiten und Erfolgen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soroban, japanischer Abakus, Mathematikunterricht, Grundschule, Arbeitsmittel, Rechenhilfe, empirische Untersuchung, Didaktik, Rechenverfahren, Lernprozess, Kinder, historische Entwicklung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Eignung des Soroban als didaktisches Hilfsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule zu evaluieren und seine Anwendung empirisch zu erforschen.
- Quote paper
- Simone Marek (Author), 2006, Lehren und Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule anhand eines Arbeitsmittels - Eine empirische Erkundung mit dem japanischen Abakus Soroban, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66302