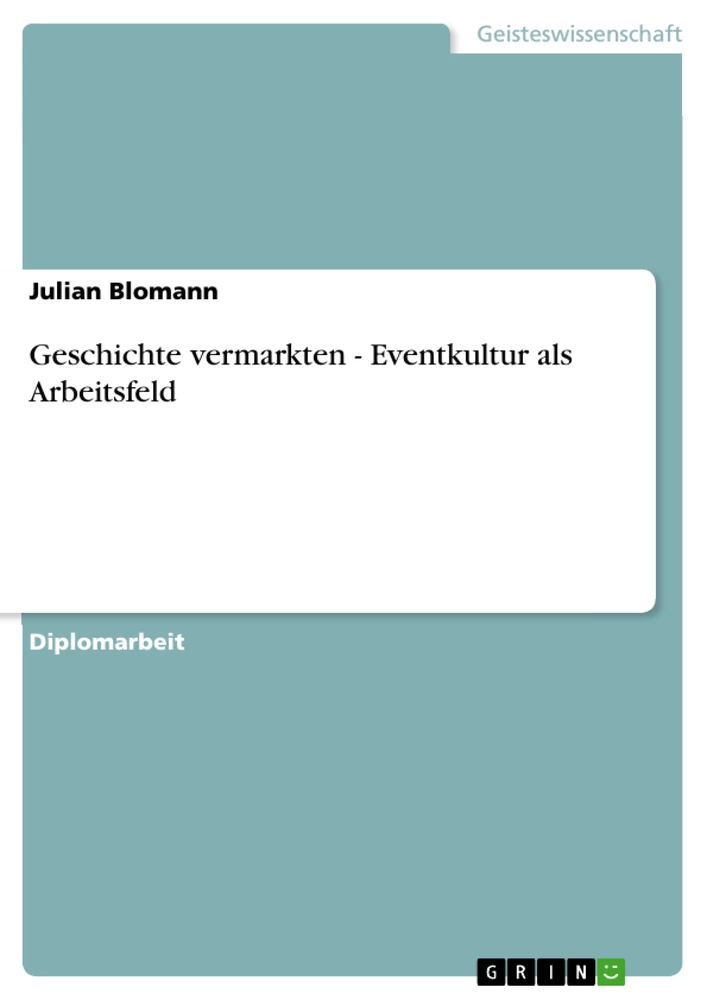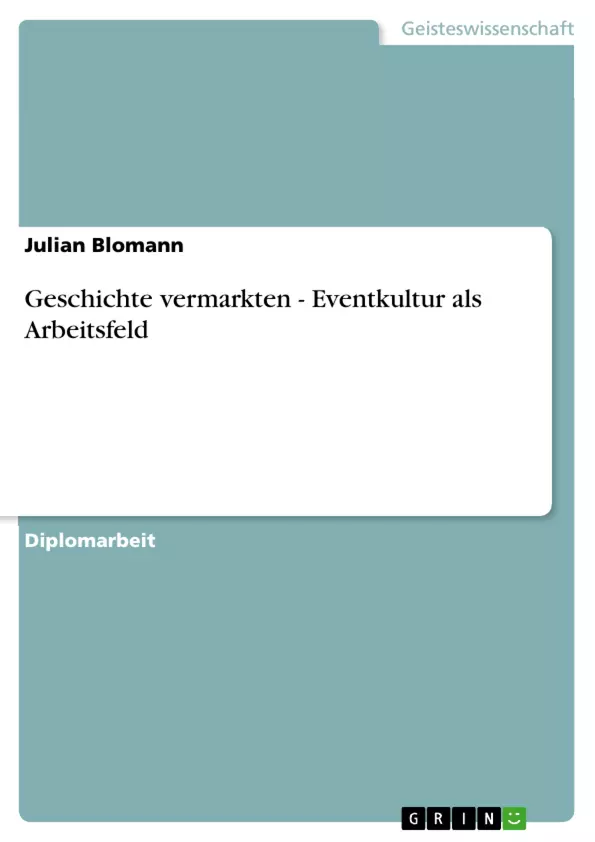Ein zunehmendes Geschichtsinteresse in der Öffentlichkeit hat dazu geführt, dass ein neuer Markt mit zahlreichen historischen und historisierenden Angeboten, wie z.B. Living History Stadtführungen, historischen Märkten und Festen, entsprechender Versandhandel, etc. entstanden ist. Da die Akteure größtenteils privaten oder privat-wirtschaftlichen Initiativen entstammen, blieb diese Entwicklung weitgehend unbeachtet von historischen Instituten. Selbstständige Unternehmer gestalten diesen Markt und damit auch gleichzeitig ein bestimmtes Geschichtsbild, somit wird es höchste Zeit, dass die Geschichtswissenschaft ihr Interesse für diese spezielle Form der Geschichtsvermittlung deutlich ausbaut. Schließlich sind es weniger die wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus denen der Normalbürger sein historisches Wissen bezieht sondern Romane, Filme, Dokumentationen und seit einiger Zeit auch vermehrt historische oder historisierende Veranstaltungen aller Art.
Diese Arbeit konzentriert sich vor allem auf den bisher kaum erforschten und noch relativ jungen Bereich der historischen Veranstaltungen, neudeutsch häufig als Events bezeichnet.
Besonders dieser Marktbereich existiert im Spannungsfeld zwischen eigenem oder vom Kunden erwartetem historischen Anspruch auf der einen Seite, und ökonomischen Zwängen auf der anderen Seite.
Dies führt zu der eher ungewöhnlichen Situation, dass sich eine kulturwissenschaftliche Diplomarbeit mit Themen wie Marktforschung und Qualitätssicherung beschäftigt. Als Grundlage zur Bearbeitung meiner Fragestellung dienen mir nach sozialwissenschaftlichen Umfragetechniken gesammelte Daten. Zu diesem Zweck wurde von mir eine Umfrage erstellt, die ich als Online-Fragebogen an ca. 1.000 Adressen aus dem Bereich der historischen oder historisierenden Veranstaltungen (Händler, Hersteller, Veranstalter, Darsteller, etc.) versendet habe. So wird zunächst der momentan herrschende „Ist-Zustand“ im Bereich der historischen und historisierenden Veranstaltungen aus wissenschaftlicher Sicht dargestellt und unter dem Gesichtspunkt der historischen Qualität betrachtet. Hierauf aufbauend werden existierende Stärken und Schwächen sowie Risiken und Chancen der Veranstaltungen herausgearbeitet, um abschließend aus den so gefundenen Ergebnissen Empfehlungen zur verantwortungsvollen Vermarktung von Geschichte zu erarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsgegenstand
- Definition des Untersuchungsraumes und der Begrifflichkeiten
- Geschichte als Event
- Märkte
- Living-History
- Reenactment
- Liverollenspiel
- Museumsveranstaltungen
- Veranstaltungen für Firmen und Privatleute
- Sinn historisch orientierter Veranstaltungen
- Rahmenbedingungen der Umfrage
- Problem der Repräsentativität
- Aufbau und Fragestellung
- Konstruktion des Fragebogens
- Auswertung
- Demographie und Gruppierung
- Alter und Geschlecht
- Bildung und momentane Tätigkeit
- Beschreibung der Szene
- Einteilung der Szene
- Profis
- Semiprofis
- Szene-Laien
- Hobbyisten/Freizeitnutzer
- Verteilung der Gruppen
- Gruppenvergleich Studium und Studienfächer
- Bildung von Nutzertypen
- Identifizierte Nutzertypen
- Nutzertyp 1: Die „Anspruchsvollen-Nutzer“
- Nutzertyp 2: Die „Spaß-Nutzer“
- Nutzertyp 3: Die „,Nicht-Nutzer“
- Analyse der identifizierten Nutzertypen
- Verteilung der Nutzertypen
- Die Altersverteilung
- Vergleich der Schulbildung und Studienfächer
- Subszenen-Partizipation
- Erwartungen an eine Veranstaltung
- Eventkultur als Arbeitsfeld
- Engagement als Unterscheidungsmerkmal
- Beweggründe des Engagements
- Gruppe der Aktiven
- Tätigkeitsbereiche der Aktiven
- Tätigkeitsbereiche der Nutzertypen
- Eigener Anspruch
- Zwischen-Fazit
- Historische Qualität
- Definition der historischen Qualität
- Bedeutung historischer Qualität
- Qualitätsminderungen
- Beurteilung der Qualität und des Ist-Zustandes
- Das Qualitätsproblem
- Ansprüche von Veranstaltern
- Bildungsstand der Aktiven
- Historisch orientierte Veranstaltungen als Lernort
- Gefahr der Übernahme falscher Geschichtsbilder
- Exkurs: „Gute Living-History“
- Verantwortungsvoller Umgang mit der Geschichte
- Kriterien einer guten Veranstaltung
- Transparenz und klare Label
- Vorlagentreue
- Deutliche Grenzen
- Spaß vs. Qualität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Vermarktung von Geschichte im Bereich der historischen und historisierenden Eventkultur. Das Hauptziel ist es, den „Ist-Zustand“ in diesem Bereich zu analysieren und die Herausforderungen und Chancen der Vermarktung von Geschichte zu beleuchten.
- Analyse der verschiedenen Akteure und Nutzertypen in der Eventkultur
- Untersuchung der Motivations- und Erwartungshaltungen von Veranstaltern und Besuchern
- Bewertung der Qualität historischer Veranstaltungen und der Herausforderungen der historischen Korrektheit
- Entwicklung von Empfehlungen zur verantwortungsvollen Vermarktung von Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Bedeutung des Forschungsfeldes. Kapitel 2 definiert den Forschungsgegenstand und die zentralen Begrifflichkeiten wie "Vermarktung" und "Eventkultur". Kapitel 3 analysiert die verschiedenen Arten historischer Veranstaltungen und deren Bedeutung für die Geschichtsvermittlung. Kapitel 4 widmet sich der Frage nach dem Sinn historisch orientierter Veranstaltungen und den Erwartungen der Nutzer. Kapitel 5 beleuchtet die Herausforderungen der Qualitätssicherung in der Eventkultur und die Gefahr der Übernahme falscher Geschichtsbilder.
Schlüsselwörter
Historische Eventkultur, Geschichtsvermittlung, Vermarktung, Qualitätssicherung, Nutzertypen, Reenactment, Live Action Role Playing (LARP), historische Korrektheit, Bildungsanspruch, Freizeitgestaltung, Verantwortungsvoller Umgang mit Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Warum boomt die historische Eventkultur?
Ein steigendes öffentliches Geschichtsinteresse führt zu einem Markt für Living History, Mittelaltermärkte und Reenactment-Veranstaltungen.
Was ist der Unterschied zwischen Reenactment und LARP?
Reenactment strebt historische Korrektheit an, während Liverollenspiel (LARP) eher den spielerischen Aspekt in einem historischen Setting betont.
Besteht die Gefahr falscher Geschichtsbilder?
Ja, ökonomische Zwänge führen oft dazu, dass Unterhaltung wichtiger als historische Qualität ist, was zu verzerrten Darstellungen führen kann.
Welche Nutzertypen gibt es in der Szene?
Die Arbeit unterscheidet zwischen "Anspruchsvollen-Nutzern", "Spaß-Nutzern" und "Nicht-Nutzern" sowie Profis und Hobbyisten.
Was macht eine "gute" historische Veranstaltung aus?
Kriterien sind Transparenz, klare Kennzeichnung (Label), Vorlagentreue und eine deutliche Trennung zwischen Fakten und Fiktion.
- Quote paper
- Julian Blomann (Author), 2006, Geschichte vermarkten - Eventkultur als Arbeitsfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66345