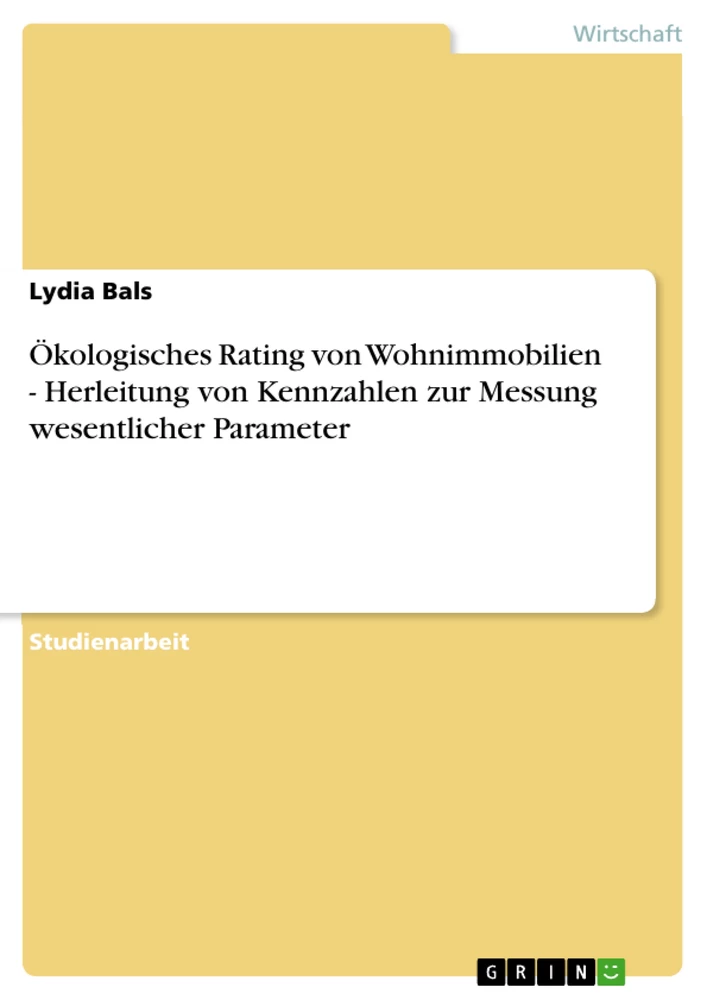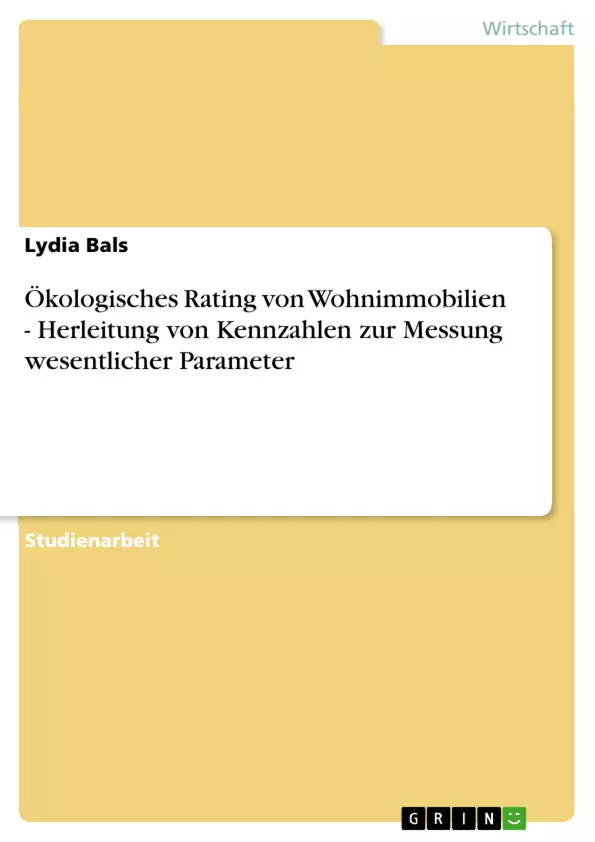1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die Einstellung des Menschen, seine Umwelt als eine unendliche und selbstverständliche Ressourcenquelle zu begreifen, ändert sich. 1 Das wachsende Interesse an umweltbewusstem Wirtschaften schlägt sich in Bewertungen von Unternehmen und Kapitalanlagen in Hinsicht auf ihre ökologischen Folgen in Öko-Ratings, Ökobilanzen sowie in Umweltmanagementsystemen (z.B. Umweltcontrolling) nieder. 2 Es gibt bisher unter den ökologischen Bewertungen von Kapitalanlagen jedoch keine auf Immobilien spezialisierten. Dies ist ökologisch gesehen sehr nachteilig, da gerade die Baubranche mit ihren langlebigen Produkten einen beträchtlichen Teil des Energie(ca. 40% in der Europäischen Union) 3 und Materialverbrauchs, des Ausstoßes an Emissionen und an Abfallströmen verursacht. 4 Zwar zeichnet sich eine beginnende Dynamik in Form von vermehrter Forderung nach ökologischen und schadstoffarmen Baustoffen, häufigeren Untersuchungen von Stoffkreisläufen im Bauwesen und dem Ergreifen von Maßnahmen zur Energieeinsparung ab. 5 Es fehlt jedoch an einem Standard, der insbesondere den Nutzern Transparenz zu der ökologischen Bonität von Wohnimmobilien verschafft und dadurch eine Etablierung umweltverträglicher Immobilien am Markt unterstützt. Bestehende Labels beziehen sich zumeist ausschließlich auf den Faktor Energie (z.B. das deutsche Niedrigenergiehaus-Label). 6 Aus Nutzersicht spielt jedoch nicht nur Energie eine wichtige Rolle, vielmehr „[…] sind heute kostengünstige, dauerhafte und wartungsarme Konstruktionen gefragt, die die Umwelt schonen und für den Menschen verträgliche Lösungen darstellen“. 7 Eine Möglichkeit diese Transparenz zu gewährleisten wird in einem nutzerfokussierten Öko-Rating gesehen, das als eine Art Gütesiegel am Markt fungieren könnte. Ziel dieser Arbeit ist es daher, unter Berücksichtigung der Anforderungen des Nutzers an eine ökologisch-nachhaltige Wohnimmobilie, wesentliche Parameter für ein solches Rating zu identifizieren, die Kriterien zu ihrer Erfüllung abzuleiten und Kennzahlen zu ihrer Messung darzustellen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Ökologisches Rating
- 2.2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- 3 Struktur und wesentliche Parameter des Öko-Rating
- 3.1 Aufbau des Öko-Rating
- 3.2 Ökologische Parameter
- 3.2.1 Wasser, Luft und Boden
- 3.2.2 Materialverbrauch
- 3.2.3 Energie
- 3.2.4 Abfall
- 3.3 Biologische Parameter
- 3.4 Monetär relevante Ressourceneinsparungen
- 4 Kennzahlen und Indikatoren des Öko-Rating
- 4.1 Kennzahlen und Indikatoren ökologischer Parameter
- 4.2 Kennzahlen und Indikatoren biologischer Parameter
- 4.3 Kennzahlen und Indikatoren monetär relevanter Ressourceneinsparungen
- 5 Öko-Rating im Lebenszyklus der Wohnimmobilie
- 5.1 Zusammenführung der Kennzahlen
- 6 Resümee und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Entwicklung eines ökologischen Ratings für Wohnimmobilien. Ziel ist es, wesentliche Parameter für ein solches Rating zu identifizieren, die Kriterien zu ihrer Erfüllung abzuleiten und Kennzahlen zu ihrer Messung darzustellen. Dabei wird ein nutzerfokussierter Ansatz verfolgt, der die Anforderungen an eine ökologisch-nachhaltige Wohnimmobilie berücksichtigt.
- Entwicklung eines Öko-Ratings für Wohnimmobilien
- Identifizierung wesentlicher Parameter für ein ökologisches Rating
- Ableitung von Kriterien zur Erfüllung der Parameter
- Darstellung von Kennzahlen zur Messung der Kriterien
- Nutzerfokussierter Ansatz bei der Bewertung ökologischer Nachhaltigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vorgestellt. Das wachsende Interesse an umweltbewusstem Wirtschaften und die Bedeutung ökologischer Bewertungen werden hervorgehoben. Der Mangel an spezifischen Öko-Ratings für Immobilien wird als Problem erkannt, da die Baubranche einen erheblichen Teil des Energie- und Materialverbrauchs sowie des Ausstoßes an Emissionen und Abfallströmen verursacht. Die Notwendigkeit eines Standards zur Transparenz der ökologischen Bonität von Wohnimmobilien wird betont.
Kapitel 2 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Öko-Ratings. Der Ursprung und die Verwendung des Begriffs "Öko-Rating" werden erklärt, und der Begriff der Nachhaltigkeit mit seinen drei Dimensionen (Ökologie, Ökonomie, Soziales) wird hervorgehoben. Die Schwierigkeit der Bildung von Umweltkennzahlen und -kennzahlensystemen wird beleuchtet.
Im dritten Kapitel wird die Struktur und die wesentlichen Parameter des Öko-Ratings vorgestellt. Der Aufbau des Ratings wird erläutert, und die ökologischen Parameter wie Wasser, Luft, Boden, Materialverbrauch, Energie und Abfall werden im Kontext der Wohnimmobilie betrachtet. Biologische Parameter und monetär relevante Ressourceneinsparungen werden ebenfalls behandelt.
Kapitel 4 befasst sich mit den Kennzahlen, Indikatoren und Schätzwerten, die zur Messung der im vorherigen Kapitel erörterten Parameter eingesetzt werden sollen. Die vollständige Abbildung der komplexen Realität durch die Kennzahlen wird angestrebt, um ein ganzheitliches Verständnis zu ermöglichen.
Im fünften Kapitel werden die Kennzahlen, Indikatoren und Schätzwerte im Verlauf des Lebenszyklus der Immobilie zusammengeführt.
Schlüsselwörter
Ökologisches Rating, Wohnimmobilie, Nachhaltigkeit, Umweltkennzahlen, ökologische Parameter, biologische Parameter, monetär relevante Ressourceneinsparungen, Lebenszyklus, Kennzahlen, Indikatoren, Schätzwerte
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein ökologisches Rating für Wohnimmobilien?
Es handelt sich um ein Bewertungssystem, das die ökologische Bonität einer Immobilie anhand von Parametern wie Energieverbrauch, Materialwahl und Emissionen misst, um Transparenz für Nutzer zu schaffen.
Welche ökologischen Parameter werden bewertet?
Zu den wesentlichen Parametern gehören der Energiebedarf, der Materialverbrauch, der Wasserverbrauch, die Abfallströme sowie Auswirkungen auf Luft und Boden.
Warum reicht ein Energie-Label allein nicht aus?
Nutzer fordern heute ganzheitliche Lösungen, die auch Wohngesundheit (biologische Parameter) und langlebige, wartungsarme Konstruktionen umfassen, nicht nur die reine Energieeffizienz.
Wie werden die Kennzahlen im Lebenszyklus der Immobilie genutzt?
Die Kennzahlen werden über den gesamten Lebenszyklus – von der Errichtung über die Nutzung bis zum Rückbau – zusammengeführt, um eine ganzheitliche ökologische Bewertung zu ermöglichen.
Gibt es monetäre Vorteile durch ein Öko-Rating?
Ja, das Rating berücksichtigt auch monetär relevante Ressourceneinsparungen, die durch effiziente Technik und nachhaltige Materialien die Betriebskosten senken können.
- Quote paper
- Dipl.-Kffr. Lydia Bals (Author), 2004, Ökologisches Rating von Wohnimmobilien - Herleitung von Kennzahlen zur Messung wesentlicher Parameter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66428