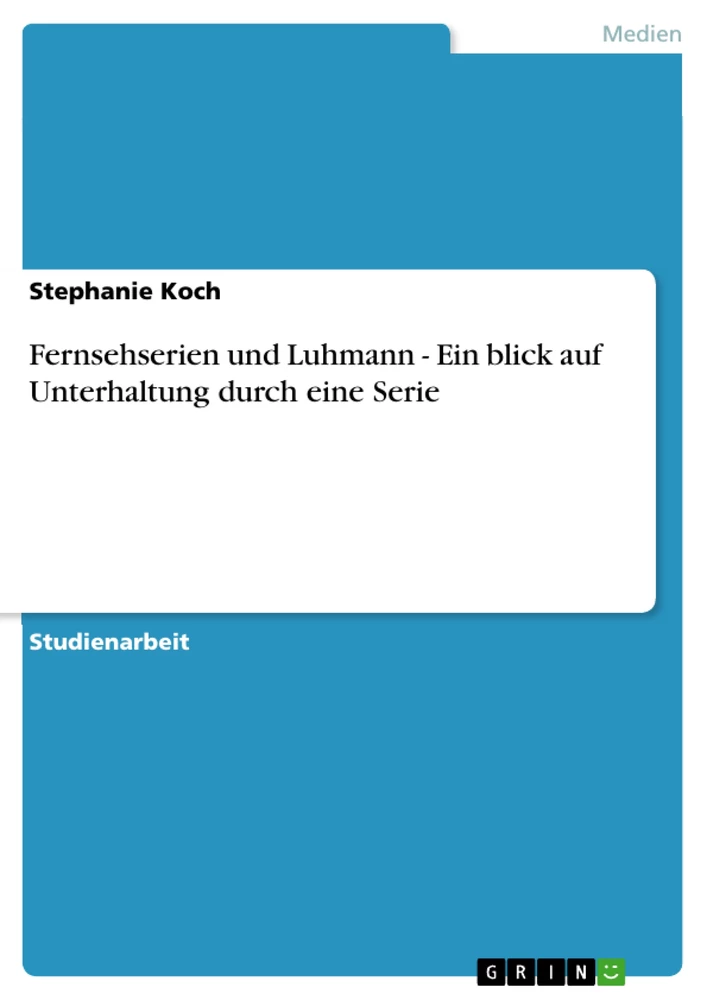1. Einleitung
Um einen Konsens über die kontinuierlich verwendeten systemtheoretischen Begrifflichkeiten herzustellen, wird die Arbeit mit einem kurzen Überblick über Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme eröffnet, welcher quasi als theoretischer Überbau für das Nachfolgende fungieren soll.
Dieser durch mehrere Paradigmenwechsel gekennzeichnete und erkenntnistheoretisch ausgerichtete Ansatz, geht im Kern davon aus, dass die moderne Gesellschaft in soziale Teilsysteme ausdifferenziert ist. Diese bestehen nur aus Kommunikationen und nicht aus Menschen, wobei das Ganze (die Gesellschaft) nicht einfach nur die Summe seiner Teile ist. Individuen werden innerhalb dieser Theorie nur berücksichtigt als psychische Systeme (= Bewusstseine). Das Zustandekommen spezieller Kommunikationen führt zur Genese von darauf spezialisierten Teilsystemen, die wiederum durch diese Kommunikationsabfolgen erhalten werden. Die Systeme sind durch spezifische binäre Codierungen nach innen geschlossen und durch spezifische Programme nach außen offen. Soziale Systeme sind autopoietisch und funktional, weil jedes Einzelne auf einem spezifischen Kommunikationsproblem der Gesellschaft basiert, aufgrund dessen sie sich selbst (= Autopoiesis) erschaffen und innerhalb dessen sie auf sich selbst referieren, d.h. sich selbst beobachten. Im Mittelpunkt der Theorie steht die Distinktion zwischen System (dem Inkludierten) und Umwelt (dem Exkludierten). Systeme sind immer weniger komplex als ihre Umwelt. Die Komplexität reduzieren sie durch Ausdifferenzierung binärer Codierungen, innerhalb derer ihre Kommunikation ablaufen und durch die sie sich von der Umwelt abgrenzen.
Diese sehr abstrakt anmutende Einführung in das begriffliche Instrumentarium Luhmanns soll es dem Leser im späteren Teil der Arbeit erleichtern, zu verstehen, wie auch die Massenmedien als soziales System nur ein funktionaler Teilbereich der Gesellschaft sind. Auf der einen Seite können die Massenmedien die Gesellschaft durch ihre Kommunikationen beobachten, auf der anderen Seite können sie aber auch nur innerhalb ihrer Grenzen kommunizieren. Dies leitet direkt zum grundlegenden Begriff dieser Arbeit weiter: Beobachtung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Stand des Beobachters und der Beobachtungsgegenstand
- Beobachter und Massenmedium
- Unterhaltung durch eine Fernsehserie
- Liebe als besonders geeignetes Thema für Fernsehserien
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der systemtheoretischen Analyse einer Fernsehserie im Kontext der Massenmedien. Sie verwendet Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme als theoretisches Fundament und beleuchtet die Rolle von Unterhaltung in der Gesellschaft und in Fernsehserien.
- Das Funktionieren von Fernsehserien als soziales System
- Die Konstruktion von Realität in Massenmedien und die Rolle von Unterhaltung
- Das Verhältnis von individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen Normen in Fernsehserien
- Die Relevanz von Thematiken wie Liebe für die Unterhaltungsindustrie
- Die Beobachtungsebenen in der Analyse von Fernsehserien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme und stellt die Grundbegriffe vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind. Der zweite Kapitelteil beschäftigt sich mit dem Beobachter und dem Beobachtungsgegenstand und fokussiert auf die Rolle von Massenmedien und Fernsehserien in der Gesellschaft. Hierbei wird die Distinktion zwischen System und Umwelt, sowie das Konzept der Unterhaltung beleuchtet. Das dritte Kapitel behandelt die Thematik der Liebe als besonders geeignetes Thema für Fernsehserien und analysiert die Verbindung zwischen individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen Normen.
Schlüsselwörter
Soziale Systeme, Niklas Luhmann, Massenmedien, Fernsehserien, Unterhaltung, Beobachtung, Distinktion, Liebe, Kommunikation, Autopoiesis, Gesellschaft, System und Umwelt, Semantik, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Niklas Luhmanns Systemtheorie über die Gesellschaft?
Die Gesellschaft besteht laut Luhmann aus funktional differenzierten sozialen Teilsystemen, die nur aus Kommunikation und nicht aus Menschen bestehen.
Wie lassen sich Massenmedien systemtheoretisch einordnen?
Massenmedien sind ein soziales Teilsystem, das die Gesellschaft durch spezifische Kommunikationen beobachtet und dabei eigene Grenzen zwischen System und Umwelt zieht.
Welche Funktion hat Unterhaltung in Fernsehserien?
Unterhaltung dient der Komplexitätsreduktion und ermöglicht es dem Zuschauer, gesellschaftliche Normen und individuelle Erfahrungen in einem fiktionalen Rahmen zu beobachten.
Warum ist Liebe ein so häufiges Thema in Fernsehserien?
Liebe eignet sich besonders gut, da sie individuelle Emotionen mit gesellschaftlichen Semantiken verknüpft und so eine hohe Anschlussfähigkeit für massenmediale Kommunikation bietet.
Was bedeutet Autopoiesis im Kontext sozialer Systeme?
Autopoiesis beschreibt die Eigenschaft von Systemen, sich durch ihre eigenen Operationen (Kommunikationen) selbst zu erschaffen und zu erhalten.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Koch (Autor:in), 2006, Fernsehserien und Luhmann - Ein blick auf Unterhaltung durch eine Serie , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66472