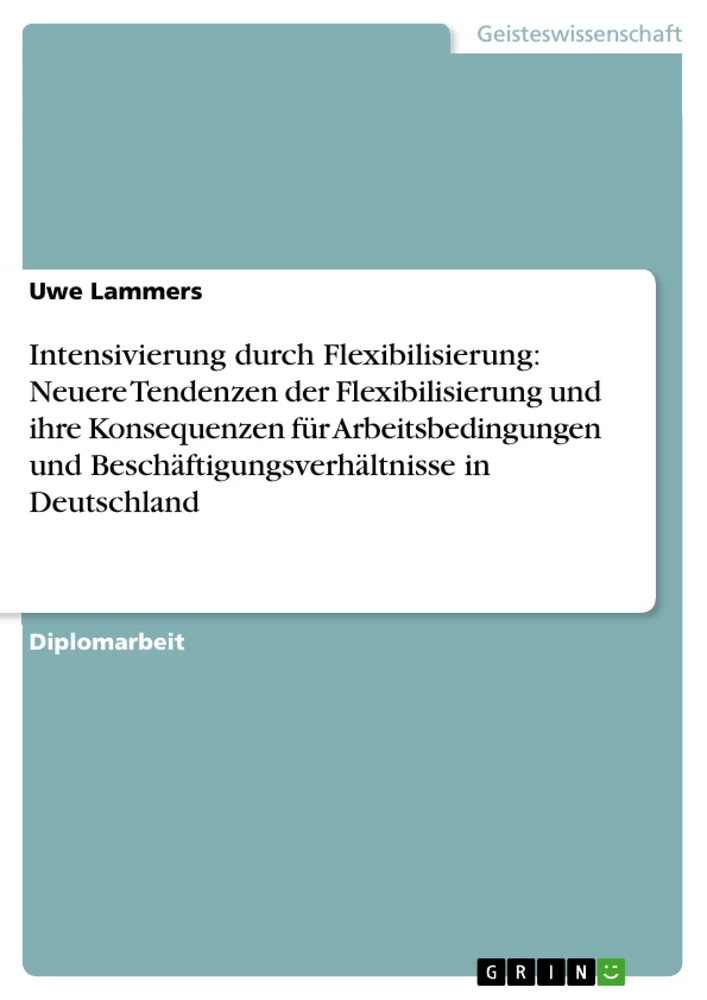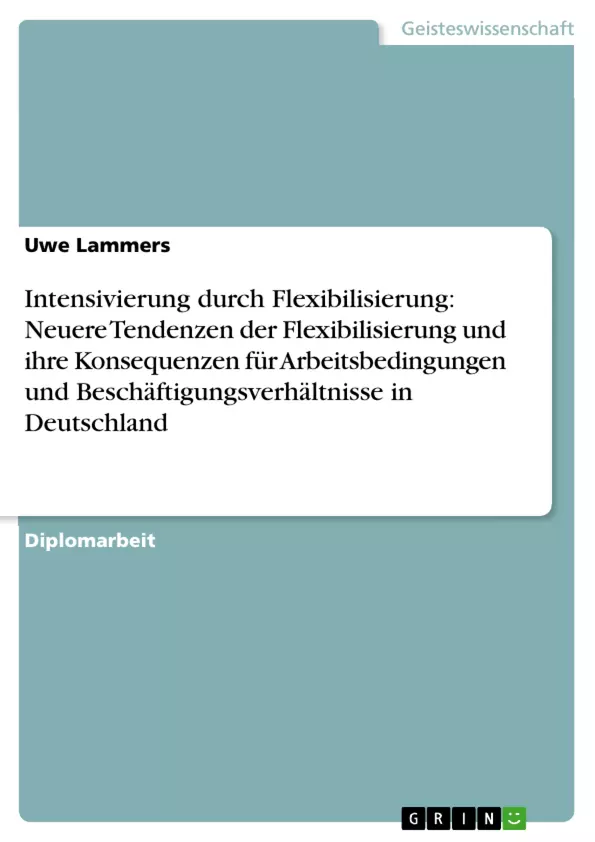In „Lernen sichtbar machen“ stellte Bjørnåvold Ende der 1990er Jahre einen europäischen Vergleich zur Anerkennung nicht-formal erworbener Kompetenzen dar. Treffend beschreibt er, dass diesbezügliche Ansätze insbesondere in Deutschland und Österreich, aufgrund der starken formalen Ausprägung des Berufsbildungssystems, nahezu nicht vorhanden waren. Die bildungspolitische Bedeutung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen gewinnt vor dem Hintergrund der Forderungen nach lebenslangem Lernen, Flexibilisierung und Öffnung der europäischen Bildungslandschaften eine immer größere Bedeutung. Die Normalität sind nicht mehr unbefristete auf Langfristigkeit ausgerichtete Arbeitsplätze sondern befristete und projektorientierte Jobs mit wechselnden Aufgaben bei verschiedenen Arbeitgebern. Arbeitnehmer die ohne eine Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit oder Umschulungs- und Orientierungsphasen das Rentenalter erreichen, werden seltener. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Es wird somit deutlich, dass die Notwendigkeiten einer umfassenderen Evaluation von Kompetenzen bestehen. In dieser Ausarbeitung werden Versuche in Deutschland zur Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen aufgezeigt. Die Evaluationsmethodik auf Seiten der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsgemeinschaften und ihrer Träger wird dabei untersucht und im Vergleich dargestellt. Eine qualitative Untersuchung ergänzt die Evaluation ausgesuchter Ansätze und zeigt deren Charakteristiken in einem direkten Vergleich.
Ein Ergebnis meiner Literaturrecherche im Rahmen dieser Examensarbeit hat gezeigt, dass eine Vielzahl von Veröffentlichungen über nicht-formales und informelles Lernen, insbesondere im europäischem Kontext und durch Ministerien, erschienen sind. Zum Thema Profiling ist in der wissenschaftlichen Diskussion jedoch wenig Material vorhanden. Einerseits ist dies damit zu begründen, dass Profiling ein neuer Ansatz ist und es zum anderen einen Diskurs darüber gibt was darunter zu verstehen ist. Der Schwerpunkt dieser Ausarbeitung liegt aus diesem Grund darin die verschiedenen Ansätze zur Kompetenzevaluation aufzuzeigen und aktuelle Profilingmethoden, vor dem Hintergrund nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Qualifikation und Kompetenz – Eine Spurensuche begrifflicher Grundlagen
- Was ist eine Qualifikation?
- Was sind Kompetenzen?
- Definition der Schlüsselkompetenzen
- Kompetenzentwicklung
- Das Verhältnis von formalen, nicht-formalen und informellem Lernen
- Lebenslanges Lernen
- Formales Lernen als standardisierter Kompetenzerwerb
- Nicht-formales Lernen
- Informelles Lernen
- Formales, nicht-formales und informelles Lernen
- Dokumentation nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen
- Deutschland
- Weiterbildungspässe
- Externenprüfung
- Europäischer Vergleich am Beispiel Großbritannien und Frankreich
- Großbritannien
- Frankreich
- Kriterien der Evaluation und methodische Ansätze der Kompetenzermittlung
- Employability vs. Kompetenzevaluation
- Selbstevaluation vs. Fremdevaluation
- Ansätze zur Evaluation nicht-formal erworbener Kompetenzen
- Kompetenzbilanz
- Kompetenzhandbuch im Jobnavigator
- Qualipass
- Europass
- Landesnachweis NRW
- Hamburger Nachweis über bürgerschaftliches Engagement
- ProfilPASS
- Profilanalyse und Kompetenzevaluation durch „Profiling“
- Was ist Profiling?
- Kompetenzevaluation mit Profiling
- Anforderungen an „Profiler“
- Profiling als Methode der BA zur Vermittlung Arbeitssuchender
- Dokumentenanalyse ausgewählter Kompetenzevaluationen
- Profiling der Bundesagentur für Arbeit
- Kompetenzevaluation bei Trägern der BA am Beispiel der „bequa“
- Profiling und Kompetenzevaluation bei der DAA
- Die Kompetenzbilanz des DJI
- Untersuchung der Employability mit dem Jobnavigator (IG-Metall)
- Überblick der Dokumentenanalyse
- Qualitative Untersuchung zum Profiling
- Expertenebene
- Helmut Rudolph IAB
- Thekla Schlör BA Nürnberg (PP14)
- Frau von der Heide und Frau Hornberger DAA Kiel
- Frau Gerzer-Sass DJI
- Praktikerebene
- Selbsterfahrung des Autors bei einem Träger
- Herr Affeldt,,bequa“ Flensburg
- Herr Gebhardt Arbeitsagentur Flensburg
- Herr Thomsen Arbeitsgemeinschaft Flensburg
- Teilnehmerebene
- Teilnehmer/in A (Klient der „bequa“)
- Teilnehmer/in B (Arge Flensburg)
- Teilnehmer/in C (Arge Flensburg)
- Teilnehmer/in D (DAA Kiel – Ü25)
- Teilnehmer/in E (DAA Kiel – U25)
- Teilnehmer/in F (DAA Kiel – Ü25)
- Teilnehmer/in G (DAA Kiel – Ü25)
- Auswertung der Dokumentenanalyse und qualitativen Untersuchung
- Profiling bei den Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften
- Profiling und Kompetenzevaluation bei Trägern
- Weitere Ansätze zur Evaluation von Kompetenzen
- Zusammenfassung
- Lernprozesse unter dem Blickwinkel des Qualifikations- und Kompetenzerwerbs
- Nicht-formales und informelles Lernen als Alternative zum formalen Lernen
- Evaluationsansätze nicht-formaler und informell erworbener Kompetenzen
- Profiling - Ergebnisse der qualitativen Untersuchung und Reflektion
- Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen
- Ausblick
- Der Blick über den Tellerrand - ein europäischer Vergleich
- Weitergehende Untersuchungen
- Kompetenzevaluierung
- Profiling
- Formale Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen
- Kritische Betrachtung der Ausarbeitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Evaluation der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen und analysiert insbesondere Profilingprozesse in diesem Kontext. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze der Kompetenzermittlung und -evaluation im Bereich der Berufsbildung zu beleuchten und die Rolle von Profiling in diesem Zusammenhang zu untersuchen.
- Begriffliche Grundlagen von Qualifikation und Kompetenz
- Formales, nicht-formales und informelles Lernen
- Dokumentation und Anerkennung von nicht-formal erworbenen Kompetenzen
- Evaluationsansätze und methodische Ansätze der Kompetenzermittlung
- Profiling als Methode der Kompetenzevaluation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Qualifikation und Kompetenz, beleuchtet die verschiedenen Formen des Lernens und geht auf die Dokumentation und Anerkennung nicht-formal erworbener Kompetenzen ein. Im weiteren Verlauf werden verschiedene Evaluationsansätze und methodische Ansätze der Kompetenzermittlung vorgestellt, bevor das Profiling als Methode der Kompetenzevaluation im Fokus steht. Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze der Kompetenzermittlung und -evaluation, inklusive der Nutzung von Profiling. Die Arbeit stellt verschiedene Ansätze zur Evaluation nicht-formal erworbener Kompetenzen vor, darunter die Kompetenzbilanz, das Kompetenzhandbuch im Jobnavigator, Qualipass und Europass. Es wird auch der Landesnachweis NRW und der Hamburger Nachweis über bürgerschaftliches Engagement sowie der ProfilPASS behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Qualifikation, Kompetenz, Lernen, nicht-formales Lernen, informelles Lernen, Evaluation, Kompetenzermittlung, Profiling, Employability und Anerkennung. Die Arbeit untersucht verschiedene Ansätze zur Evaluation nicht-formal erworbener Kompetenzen und analysiert Profilingprozesse als Methode der Kompetenzevaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Flexibilisierung" am Arbeitsmarkt?
Es beschreibt den Trend weg von lebenslangen Jobs hin zu befristeten, projektorientierten Tätigkeiten und wechselnden Aufgaben bei verschiedenen Arbeitgebern.
Was ist der Unterschied zwischen formalem und informellem Lernen?
Formales Lernen findet in Bildungseinrichtungen statt (Abschlüsse), während informelles Lernen im Alltag oder durch Berufserfahrung geschieht.
Was versteht man unter "Profiling" bei der Arbeitsagentur?
Profiling ist eine Methode zur systematischen Erfassung von Kompetenzen und Qualifikationen, um Arbeitssuchende passgenau zu vermitteln.
Was ist der "ProfilPASS"?
Der ProfilPASS ist ein Instrument zur Dokumentation von eigenen Stärken und Kompetenzen, die man im Laufe des Lebens (auch außerhalb der Schule) erworben hat.
Wie hängen Flexibilisierung und Arbeitsbedingungen zusammen?
Flexibilisierung kann zu einer Intensivierung der Arbeit und zu unsicheren Beschäftigungsverhältnissen führen, erfordert aber auch ständiges lebenslanges Lernen.
- Quote paper
- Uwe Lammers (Author), 2006, Intensivierung durch Flexibilisierung: Neuere Tendenzen der Flexibilisierung und ihre Konsequenzen für Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66545