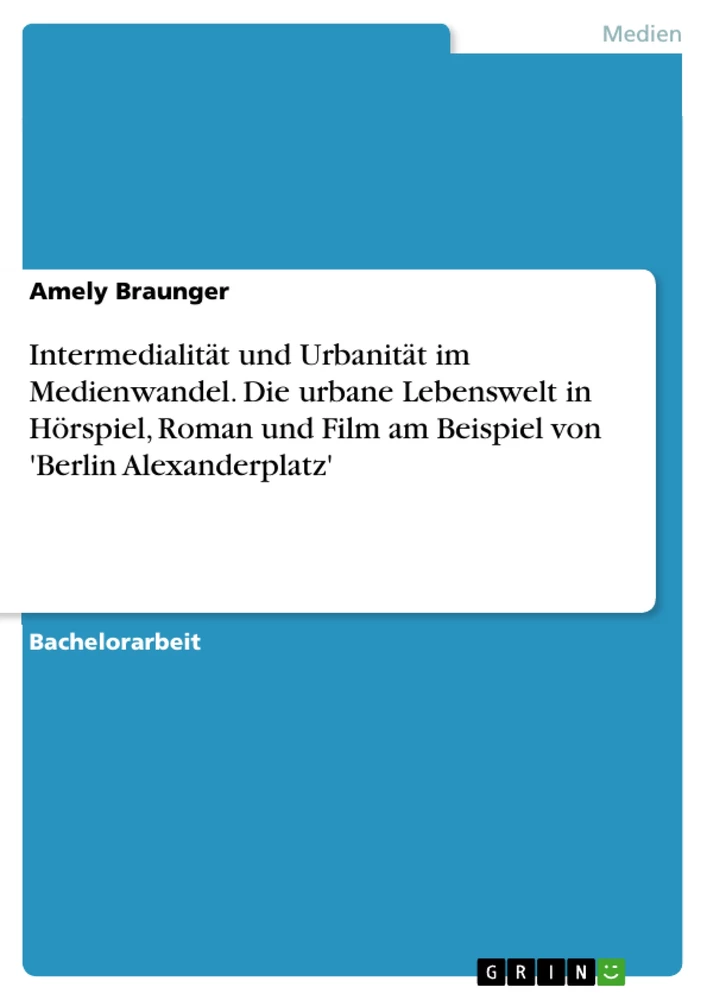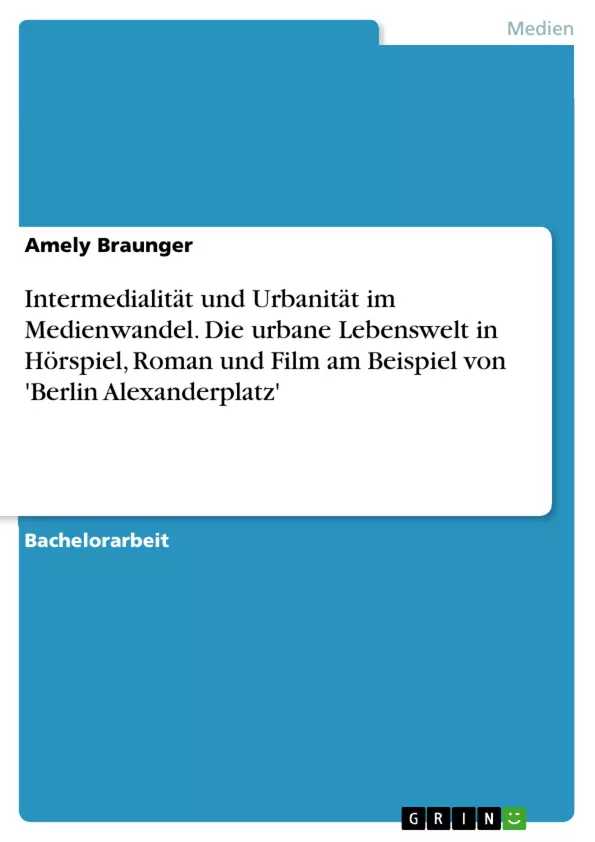Die im 19. Jahrhundert beginnende Industrialisierung in Deutschland, der damit verbundene technische Fortschritt und die gesellschaftspolitischen Umbrüche am Beginn des 20. Jahrhunderts haben innerhalb der letzten 100 Jahre den Lebensstil des modernen Menschen maßgeblich beeinflusst. Mit dem Ausbau der Infrastruktur durch moderne Fortbewegungsmittel wie Omnibus und Straßenbahn, zahlreichen Amüsements und kulturellen Angeboten wie Varieté und Kino sowie der Technisierung und Automatisierung der Alltags- und Arbeitswelt wurden urbane Ballungsgebiete als Lebens- und Schaffensräume immer reizvoller. In Deutschland lässt sich der Prozess der Urbanisierung am deutlichsten in der Großstadt Berlin beobachten: In den 20er Jahren konnte das Arbeits- und Wohnungsangebot mit dem explosionsartigen Anstieg der Einwohnerzahl nicht mehr Schritthalten, viele Menschen lebten am Existenzminimum und sahen sich dennoch mit den Ansprüchen der wachsenden Konsumherrschaft konfrontiert. Für sie entpuppten sich die Erfahrungen der modernen Großstadt als Schockerlebnis. In der expressionistischen Literatur und den Werken der Futuristen wurde diese neu empfundene Stadterfahrung zum künstlerischen Gegenstand. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, den veränderten Wirklichkeitserfahrungen und Wahrnehmungsstrukturen des urbanen Lebens am Beginn des 20. Jahrhunderts ausgehend von Döblins „Berlin Alexanderplatz“ auf den Grund zu gehen. Im Rahmen einer medienhistorischen Untersuchung wird ein medienspezifischer Vergleich der literarischen, auditiven und audio-visuellen Bearbeitungen des „Berlin Alexanderplatz“-Stoffes angestrebt. Ausgehend von Döblins Roman werden in der Reihenfolge ihrer Entstehung die Bearbeitungen des „Berlin Alexanderplatz“ durch Max Bing, Phil Jutzi und Rainer Werner Fassbinder in ihren Grundzügen vorgestellt sowie auf medienspezifische und medienhistorische Differenzen untersucht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die detaillierten Analysen von Roman, Hörspiel, Film und TV-Serial, die darauf abzielen, die Wahrnehmungsstrukturen in der Großstadt zu entschlüsseln, das menschliche Verhalten im Verhältnis zum dynamischen Stadtleben zu betrachten sowie die Beziehung zwischen Stadt, Natur und Mensch kritisch zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die moderne Großstadt: Stadtbild und künstlerisches Abbild in den 20ern
- Arbeitsziele: Absichten und Vorgehensweise
- Medien, Kunstwerke und ihre Vermittlung zwischen den Künsten
- Vom Einzelmedium zur Intermedialität
- Wie die Form den Inhalt bestimmt: Medienspezifische Prozesse in Literatur, Hörspiel, Film und Fernsehen
- Medienwechsel, Adaption und Werktreue
- Das Wechselspiel der Künste: Montage, Collage und Zitat
- Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“
- Struktur und Inhalt – ein Überblick
- Die Großstadt als Mosaik der Sinne
- Erzählstil und Montagetechniken
- Schnitter Tod, Hure Babylon und die Morgenpost
- Der Roman als „geschriebener Film“?
- „Die Geschichte vom Franz Biberkopf“ in der Hörspielfassung
- Wie der Roman zum Hörspiel wurde
- Wer spricht? Das akustische Szenario der urbanen Lebenswelt
- Inhaltliche Differenzen zur Romanvorlage
- Phil Jutzis „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte Franz Biberkopfs“
- Der Autor als Cineast
- Die Verfilmung des „geschriebenen Films“
- Jutzis Berlin: die „filmische“ und die „reale“ Stadt
- Rainer Werner Fassbinders „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“
- Fassbinders Auseinandersetzung mit Döblins Romanvorlage
- Die urbane Lebenswelt im heimischen Wohnzimmer
- „Berlin Alexanderplatz“ als TV-Serial
- Innen- und Außenräume: Die Stadt im Inneren des Menschen
- Vereint im Werk? Fassbinder und Döblin: Versuch einer künstlerischen Annäherung
- Vergleichende Medienanalyse: Das Bild des Ganzen und die Demontage des Einzelnen
- Die Stadt-Mensch-Beziehung
- Die Sprache der Stadt und die Sprachlosigkeit ihrer Menschen
- Der Mensch in der Großstadt
- Die Übermacht der Dinge und der Verlust von Subjektivität
- Stadt und Natur - Chaos und Harmonie – Tod und Leben
- Die Stadt als Organ der Menschheitsgeschichte
- Die Stadt-Mensch-Beziehung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit „Intermedialität und Urbanität im Medienwandel“ analysiert die Darstellung der urbanen Lebenswelt in der Weimarer Republik am Beispiel des Romans „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin sowie dessen Adaptionen im Hörspiel, Film und Fernsehen. Die Arbeit verfolgt dabei das Ziel, die medienspezifischen Prozesse und Besonderheiten der verschiedenen Adaptionen aufzuzeigen und deren Einfluss auf die Darstellung der Stadt und ihrer Bewohner zu untersuchen. Dabei werden die jeweiligen medialen Möglichkeiten und Grenzen, sowie die Herausforderungen bei der Vermittlung von Inhalten über unterschiedliche mediale Formate, betrachtet.
- Intermedialität und medienspezifische Prozesse
- Darstellung der urbanen Lebenswelt in den Medien
- Vergleichende Analyse von Roman, Hörspiel, Film und Fernsehen
- Einfluss der Medien auf die Darstellung der Stadt und ihrer Bewohner
- Herausforderungen der Adaption und Werktreue
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung der modernen Großstadt in der Weimarer Republik. Es werden die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen dieser Zeit sowie deren Einfluss auf die Kunst und Literatur dargestellt. Kapitel 3.1 behandelt die Entstehung der Intermedialität und die Rolle verschiedener Medien in der Kunst. Es werden die spezifischen Merkmale und Möglichkeiten von Literatur, Hörspiel, Film und Fernsehen im Hinblick auf die Darstellung der urbanen Lebenswelt betrachtet. Kapitel 3.2 widmet sich dem Roman „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin, analysiert dessen Struktur und Inhalt und untersucht, wie Döblin die Großstadt als Mosaik der Sinne darstellt. Kapitel 4 befasst sich mit der Hörspieladaption des Romans und untersucht, wie der Roman in ein akustisches Medium übertragen wurde. Es werden die Besonderheiten des Hörspiels, die akustische Gestaltung der urbanen Lebenswelt sowie die inhaltlichen Unterschiede zur Romanvorlage beleuchtet. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der ersten Verfilmung des Romans durch Phil Jutzi und betrachtet die filmischen Mittel, die Jutzi zur Darstellung der Stadt einsetzt. Kapitel 6 stellt die Verfilmung des Romans durch Rainer Werner Fassbinder vor, analysiert dessen Umgang mit Döblins Werk und untersucht, wie Fassbinder die urbane Lebenswelt im Fernsehen darstellt. Kapitel 7 führt eine vergleichende Medienanalyse der verschiedenen Adaptionen durch. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Stadt-Mensch-Beziehung, der Stadt und Natur sowie der Stadt als Organ der Menschheitsgeschichte betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Intermedialität, Urbanität, Medienwandel, Darstellung der urbanen Lebenswelt, Weimarer Republik, „Berlin Alexanderplatz“, Alfred Döblin, Hörspiel, Film, Fernsehen, Adaption, Werktreue, Vergleichende Medienanalyse, Stadt-Mensch-Beziehung, Großstadt, Stadtbild, Kunst, Literatur, Medien, Geschichte, Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser medienhistorischen Untersuchung?
Die Arbeit untersucht die Darstellung der urbanen Lebenswelt in Berlin am Anfang des 20. Jahrhunderts am Beispiel von Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“ und dessen Adaptionen.
Welche Medienformate werden miteinander verglichen?
Verglichen werden der Roman, die Hörspielfassung, Kinofilme und die TV-Serie (u.a. von Fassbinder).
Welche Rolle spielt die Intermedialität in der Arbeit?
Intermedialität beschreibt das Wechselspiel zwischen den Künsten, etwa wie Montagetechniken aus dem Film in die Literatur (Döblin) oder akustische Szenarien ins Hörspiel übertragen werden.
Wer sind die wichtigsten Regisseure der untersuchten Adaptionen?
Untersucht werden die Arbeiten von Max Bing (Hörspiel), Phil Jutzi (Film) und Rainer Werner Fassbinder (TV-Serie).
Wie wird die Beziehung zwischen Mensch und Großstadt dargestellt?
Die Stadt wird oft als übermächtiger Organismus oder „Mosaik der Sinne“ dargestellt, der zum Verlust der Subjektivität des Einzelnen führen kann.
Was bedeutet „Werktreue“ im Kontext dieser Arbeit?
Es geht um die Herausforderung, den Kern der Romanvorlage bei einem Medienwechsel beizubehalten, während die medienspezifischen Möglichkeiten der neuen Form genutzt werden.
- Citar trabajo
- Amely Braunger (Autor), 2006, Intermedialität und Urbanität im Medienwandel. Die urbane Lebenswelt in Hörspiel, Roman und Film am Beispiel von 'Berlin Alexanderplatz', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66554