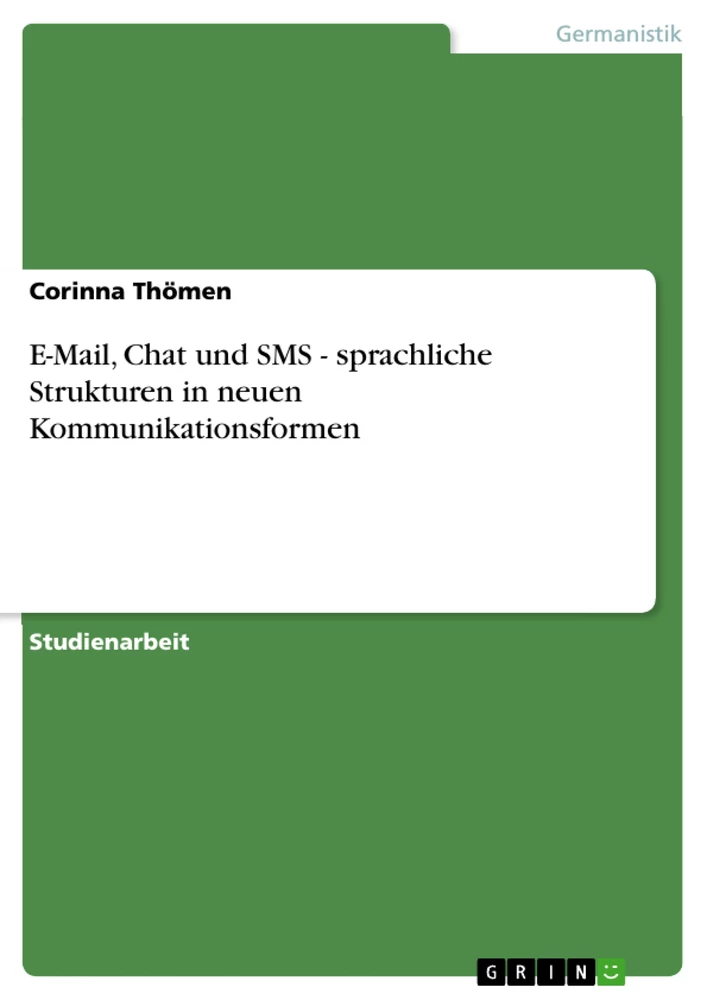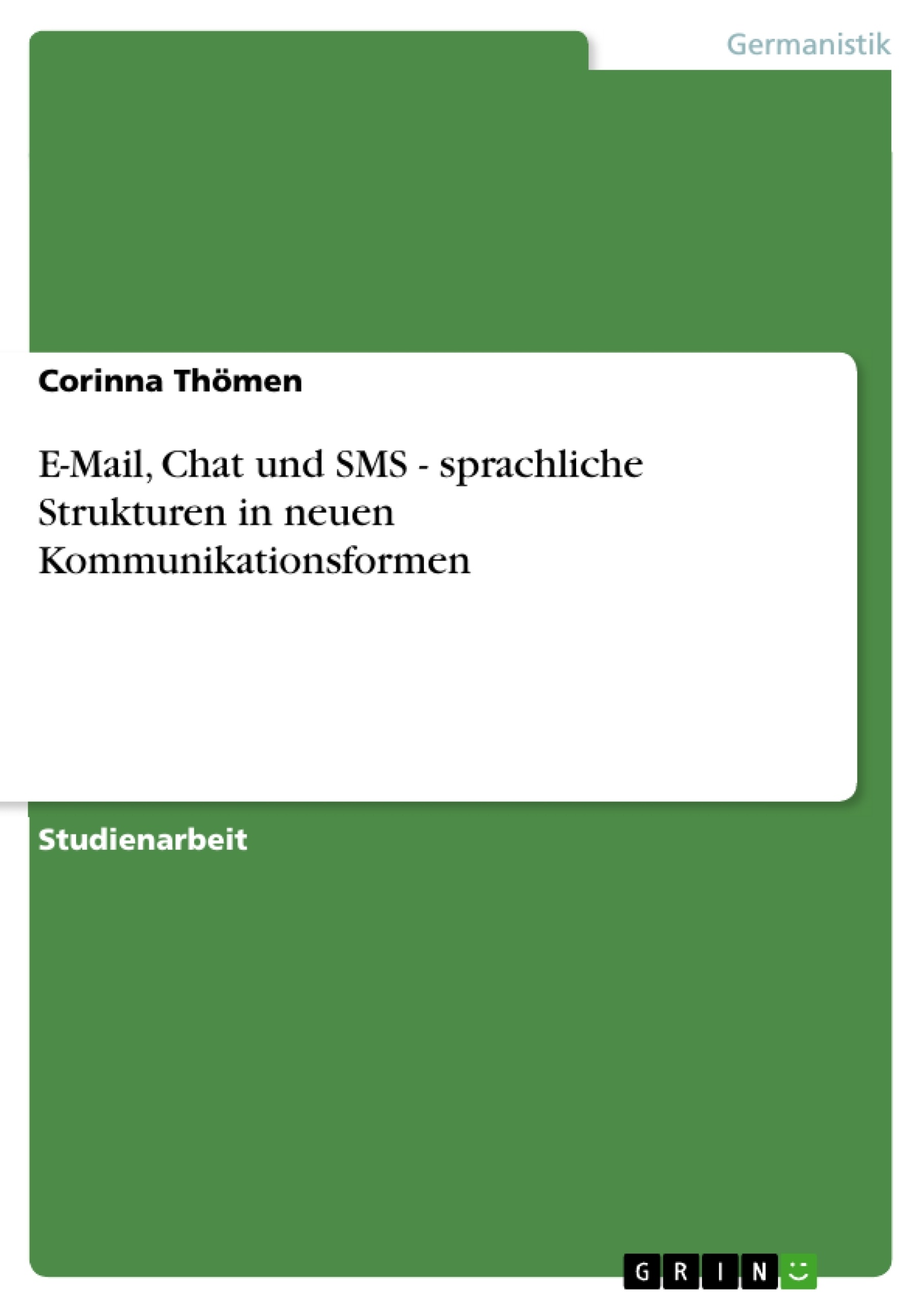Ob E-Mail, Chat oder SMS - die Möglichkeiten zur medialen Kommunikation sind so vielfältig wie noch nie. Neue Bekanntschaften werden im Chat geschlossen, Beziehungen per SMS beendet und der Familie wird aus dem Urlaub statt Karte eine E-Mail geschrieben. Das Leben ohne Computer oder Handy scheint unmöglich geworden zu sein und insbesondere die Jugendlichen haben die neuen Kommunikationsformen in ihren Alltag integriert.
Aus diesem Anlass beschäftigt sich diese Arbeit mit den sprachlichen Strukturen von E-Mail-, Chat- und SMS-Kommunikation. Welche speziellen Merkmale gibt es und wie lassen sie sich sprachwissenschaftlich einordnen? Einer besonderen Betrachtung soll dabei der medienvermittelten Kommunikation unter jugendsprachlichen Aspekten zukommen. Inwiefern spiegeln sich jugendsprachliche Merkmale in E-Mails, Chats oder SMS wider? Handelt es sich bei den sprachlichen Strukturen tatsächlich um ‚Jugendsprache’ oder sind es vielmehr medienspezifische Strukturen?
Zu Beginn der Arbeit steht ein kurzer Überblick über den Bereich der Jugendsprachforschung, in dem es zu klären gilt, was unter Jugend bzw. Jugendsprache zu verstehen ist und wie sich die Jugendsprachforschung in Deutschland bis heute entwickelt hat. Den Hauptteil der Arbeit bildet die linguistische Analyse von E-Mail-, Chat- und SMS-Kommunikation. Vor der eigentlichen sprachlichen Untersuchung wird es jeweils einen kurzen Überblick über die verschiedenen Kommunikationsformen geben sowie eine Einführung in die technischen Grundlagen.
Die Untersuchung stützt sich weitgehend auf Studien, die in den letzten Jahren zur Internet- und Mobilkommunikation gemacht worden sind. Die Analyse der E-Mail-Kommunikation basiert auf Beispielen von Marlies Reinke (2001) und Johannes Bittner (2003). Für die Chat-Kommunikation wurde der Chat der FernsehserieGute Zeiten, Schlechte Zeiten(www.gzsz.de) untersucht und wird ergänzt durch Beispiele von Jennifer Bader (2002) und Johannes Bittner (2003). Die Beispiele für die Analyse zur SMS-Kommunikation setzen sich aus dem SMS-Korpus von Schlobinski (etwa 1500 SMS von Schülern und Studenten aus Osnabrück und Hannover) und persönlichen Kurzmitteilungen der Verfasserin zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Jugendsprachforschung
- 2.1 Begriffserklärung Jugend/Jugendsprache
- 2.2 Entwicklung der Jugendsprachforschung
- 3. Sprachliche Strukturen in neuen Kommunikationsformen
- 3.1 E-Mail-Kommunikation
- 3.1.1 Technische Grundlagen
- 3.1.2 Sprachliche Strukturen von E-Mails
- 3.2 Chat-Kommunikation
- 3.2.1 Technische Grundlagen
- 3.2.2 Sprachliche Strukturen von Chats
- 3.3 SMS-Kommunikation
- 3.3.1 Technische Grundlagen
- 3.3.2 Sprachliche Strukturen von SMS
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachlichen Strukturen von E-Mail-, Chat- und SMS-Kommunikation, insbesondere unter jugendsprachlichen Aspekten. Die Zielsetzung besteht darin, spezifische sprachliche Merkmale dieser Kommunikationsformen zu identifizieren und sprachwissenschaftlich einzuordnen. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich jugendsprachliche Merkmale in diesen Medien spiegeln und ob es sich um "Jugendsprache" oder eher medienspezifische Strukturen handelt.
- Linguistische Analyse von E-Mail-, Chat- und SMS-Kommunikation
- Untersuchung medienvermittelter Kommunikation unter jugendsprachlichen Aspekten
- Identifizierung spezifischer sprachlicher Merkmale in den verschiedenen Kommunikationsformen
- Klärung der Frage nach dem Verhältnis von Jugendsprache und medienspezifischen Strukturen
- Überblick über die Jugendsprachforschung und Begriffsbestimmung von Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Strukturen in neuen Kommunikationsformen wie E-Mail, Chat und SMS ein. Sie betont die zunehmende Bedeutung dieser Medien im Alltag, insbesondere für Jugendliche, und formuliert die Forschungsfrage nach den spezifischen sprachlichen Merkmalen und ihrer Einordnung in den Kontext der Jugendsprachforschung. Die Arbeit kündigt eine linguistische Analyse der drei Kommunikationsformen an, inklusive einer Betrachtung der technischen Grundlagen und des Einflusses jugendsprachlicher Merkmale. Der Bezug zu relevanten Studien und der Aufbau der Arbeit werden ebenfalls skizziert.
2. Jugendsprachforschung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Jugendsprachforschung, beginnend mit einer Auseinandersetzung mit der komplexen Definition von "Jugend" und "Jugendsprache". Es wird deutlich, dass "Jugend" nicht einheitlich definiert werden kann, da sie verschiedene Altersgruppen, Subkulturen und soziale Gruppen umfasst. Der Begriff "Jugendsprache" wird ebenfalls differenziert betrachtet, wobei verschiedene sprachwissenschaftliche Ansätze (Soziolekt, Register, Stil) diskutiert werden. Das Kapitel betont die Rolle von Peer-Groups bei der Ausbildung von Sprachstilen und beschreibt den Prozess der "Bricolage" als kreative Aneignung und Umformung sprachlicher Elemente aus verschiedenen Kontexten. Es werden Merkmale von Jugendsprache erläutert, die als Kriterien für die nachfolgende Analyse dienen.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, E-Mail, Chat, SMS, Medienkommunikation, Sprachvarietäten, Soziolinguistik, Linguistische Analyse, Internetkommunikation, Mobilkommunikation, Anglizismen, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachliche Strukturen in Neuen Kommunikationsformen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sprachlichen Strukturen von E-Mail-, Chat- und SMS-Kommunikation, insbesondere unter jugendsprachlichen Aspekten. Sie analysiert spezifische sprachliche Merkmale dieser Kommunikationsformen und ordnet sie sprachwissenschaftlich ein. Ein zentraler Punkt ist die Frage, inwieweit sich jugendsprachliche Merkmale in diesen Medien spiegeln und ob es sich um "Jugendsprache" oder eher medienspezifische Strukturen handelt.
Welche Kommunikationsformen werden analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei wichtige Kommunikationsformen: E-Mail, Chat und SMS. Für jede Form wird sowohl die technische Grundlage als auch die sprachliche Struktur detailliert betrachtet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Jugendsprachforschung, ein Kapitel zur Analyse der sprachlichen Strukturen in den drei Kommunikationsformen (E-Mail, Chat, SMS) und abschließend eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Beschreibung der untersuchten Aspekte.
Was wird unter "Jugendsprache" verstanden?
Die Arbeit geht der komplexen Definition von "Jugendsprache" nach. Es wird deutlich, dass "Jugend" und "Jugendsprache" nicht einheitlich definiert werden können, da sie verschiedene Altersgruppen, Subkulturen und soziale Gruppen umfassen. Die Arbeit diskutiert verschiedene sprachwissenschaftliche Ansätze (Soziolekt, Register, Stil) und betont die Rolle von Peer-Groups bei der Ausbildung von Sprachstilen.
Welche sprachwissenschaftlichen Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine linguistische Analyse der E-Mail-, Chat- und SMS-Kommunikation. Es werden spezifische sprachliche Merkmale identifiziert und im Kontext der Jugendsprachforschung eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, E-Mail, Chat, SMS, Medienkommunikation, Sprachvarietäten, Soziolinguistik, Linguistische Analyse, Internetkommunikation, Mobilkommunikation, Anglizismen, Sprachwandel.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, spezifische sprachliche Merkmale in den verschiedenen Kommunikationsformen zu identifizieren und zu klassifizieren. Sie möchte das Verhältnis zwischen Jugendsprache und medienspezifischen Strukturen klären und einen Überblick über die aktuelle Jugendsprachforschung geben.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für jedes Kapitel, welche die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse kurz und prägnant beschreiben. Die Einleitung führt in das Thema ein, das Kapitel zur Jugendsprachforschung beleuchtet die Begrifflichkeiten und den Forschungsstand, das Hauptkapitel analysiert die sprachlichen Strukturen der drei Kommunikationsformen und die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
- Citar trabajo
- Corinna Thömen (Autor), 2006, E-Mail, Chat und SMS - sprachliche Strukturen in neuen Kommunikationsformen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66640