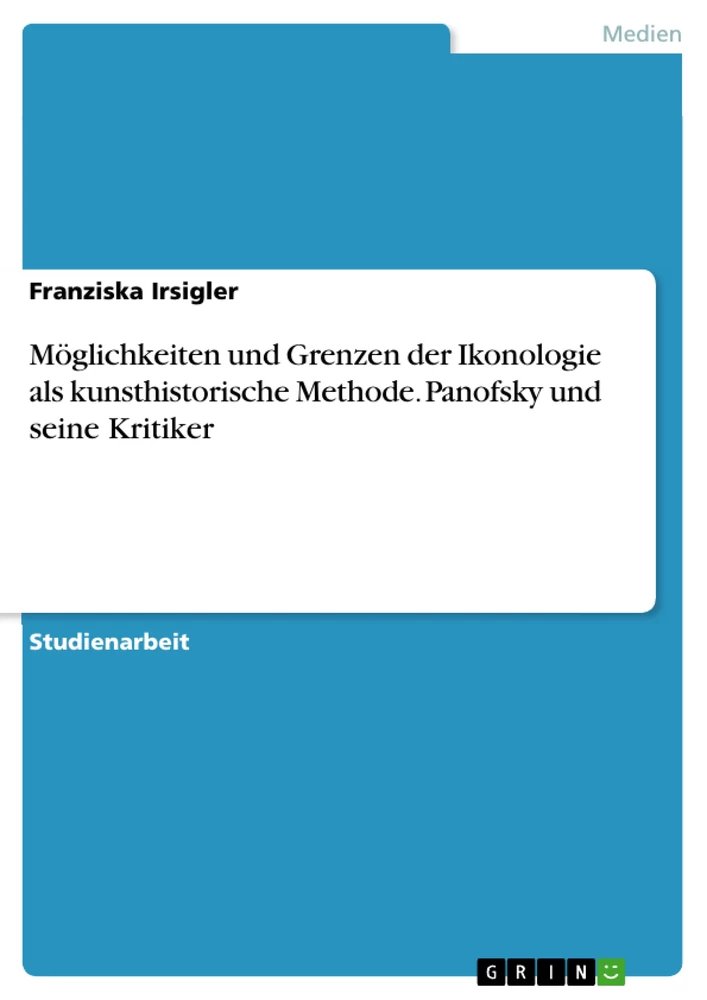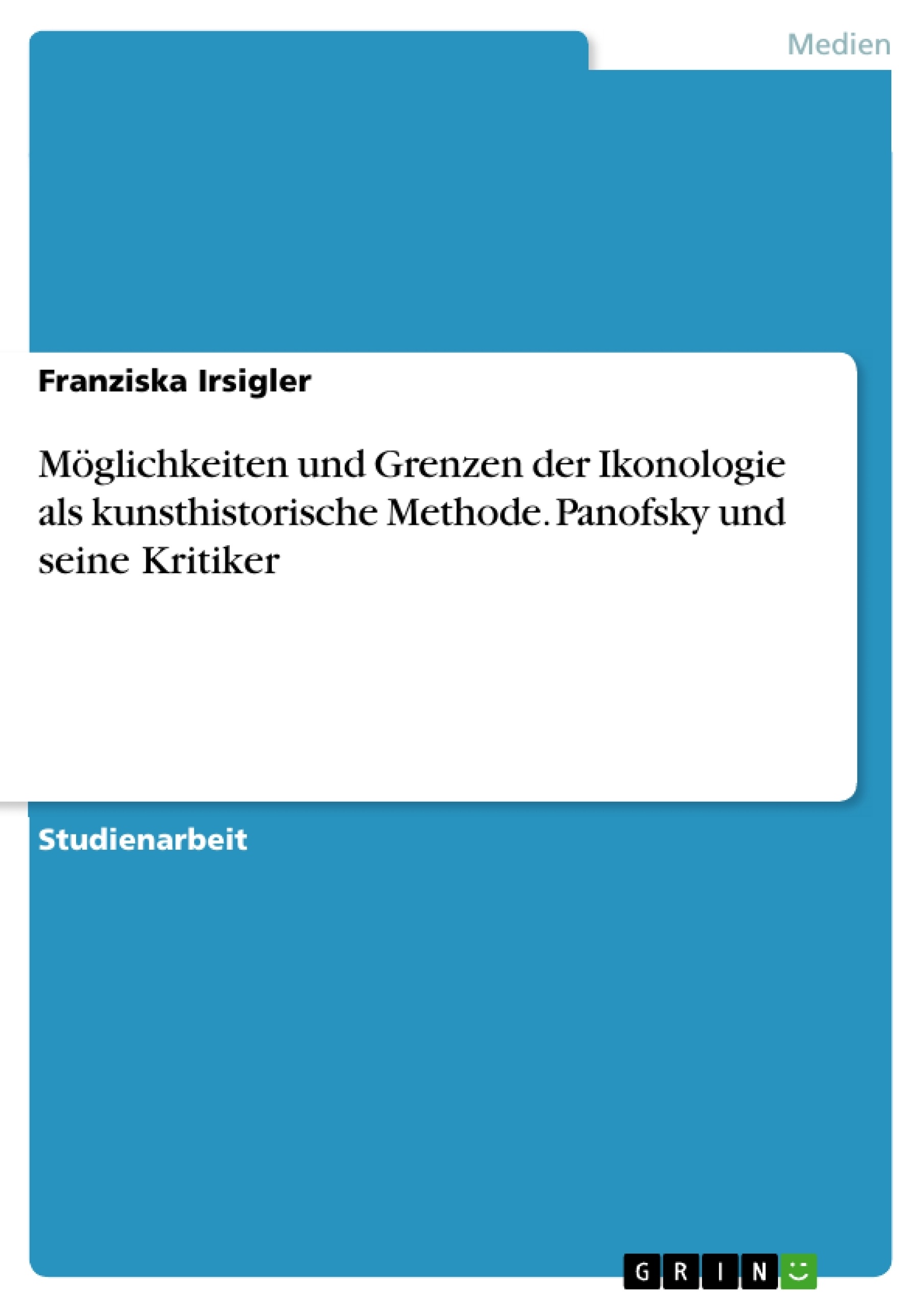Die kunsthistorische Methode der Ikonologie, in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts von Aby Warburg und Erwin Panofsky entwickelt, bereicherte die Forschung ungemein und lieferte neue, um nicht zu sagen bahnbrechende, Erkenntnisse. Doch im Laufe der Jahre wurden immer mehr Fragen aufgeworfen, die nicht nur die Methode an sich, sondern auch ihre Ergebnisse bezweifeln.
Gerade in den Interpretationen Eddy de Jonghs zur holländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts wird man mit Problemen konfrontiert: So kann man feststellen, dass der ikonologische, bzw. emblematische Ansatz zwar interessante und meistens auch in sich schlüssige Ergebnisse lieferte – sich aber komplementär zu anderen Forschungsmeinungen verhält. Der somit auferlegte ‚Zwang zur Entscheidung’ führte zu einer notwendig und nützlich erscheinenden intensiveren Weiterbeschäftigung mit dieser Thematik: Die Validität der Ikonologie als Methode, ihre Verwendbarkeit, Nützlichkeit und vor allem die sich aus ihr ergebenden Probleme stellen daher das Thema dieser Arbeit dar.
Zuerst werden die Begriffe ‚Ikonographie’ und ‚Ikonologie’ erklärt, dann ein kurzer Überblick über die Entwicklung der ikonologischen Methode gegeben. Anschließend wird die Forschungsmethode anhand repräsentativer Kunsthistoriker hinsichtlich ihres Aufbaus, fehlenden Aspekten und Problemen chronologisch vorgestellt.
Vorab konstatiert werden kann, dass im Laufe der Forschungsbeschäftigung immer weniger an der Methode an sich gearbeitet wurde, sondern vielmehr bisher vernachlässigte Aspekte und neue Betätigungsfelder integriert wurden: Die ikonologische Methode entwickelte sich vom Allgemeinen zum Speziellen.
Nach diesem allgemeinen Überblick wurde ein Schwerpunkt gewählt, an welchem sich die Problematik besonders deutlich zeigt: Die Forschungspositionen zur Ikonologie der holländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts gehen (fast) unvereinbar weit auseinander und verdeutlichen daher exemplarisch die Schwierigkeiten ikonologischer Untersuchungsansätze.
Jan van Eycks Gemälde „Die Arnolfini-Hochzeit“ bot sich schließlich für eine praktische Analyse der Methode an, da es zum einen von einem Begründer der Ikonologie, Erwin Panofsky, als auch, über 50 Jahre später, von seinem Kritiker Joannes Bedaux untersucht wurde.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt somit eher auf den Grenzen als den Möglichkeiten der Ikonologie.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Thematische Einführung
- 1. Die Termini ,Ikonographie' und ,Ikonologie'
- 2. Kleine Geschichte der Ikonologie
- III. Die Entwicklung der Ikonologie in Dekaden
- 1. 1930-1940: Erwin Panofsky: Die Grundlagen
- 2. 1950-1960: Rudolf Wittkower: Ergänzung der Stilistik
- 3. 1960-1970: Erik Forssmann: Die Rolle des Kunstrezipienten
- 4. 1970-1980: Ernst H. Gombrich: Problemfelder
- 5. 1980-1990: Eric Sluijter: Zur Bedeutung der Quellenlage
- 6. 1990-2000: Martin Warnke: Politische Ikonologie
- IV. Die ikonologische Revolution: Die holländische Genremalerei
- 1. Emblematische Vorbilder: Eddy de Jongh
- 2. Beschreibende Weltschau: Svetlana Alpers
- V. Die Ikonologie im Beispiel: Die Arnolfini-Hochzeit
- 1. Erwin Panofsky
- 2. Joannes Baptist Bedaux
- VI. Grenzen: Kritik der Ikonologie
- VII. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der kunsthistorischen Methode der Ikonologie und ihren Grenzen. Dabei werden die Entwicklung der Ikonologie und die verschiedenen Forschungsansätze der Ikonologie im 20. Jahrhundert dargestellt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Stärken und Schwächen der Methode aufzuzeigen und eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer Gültigkeit zu fördern.
- Die Definition und Entwicklung des Begriffs „Ikonologie“
- Die Bedeutung der Ikonologie für die Kunstgeschichte
- Die Kritik an der Ikonologie und ihre Grenzen
- Die Anwendung der Ikonologie auf die holländische Genremalerei des 17. Jahrhunderts
- Die Analyse des Gemäldes „Die Arnolfini-Hochzeit“ von Jan van Eyck als Beispiel für ikonologische Interpretation.
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Ikonologie als kunsthistorische Methode vor und erläutert die Motivation für die Hausarbeit.
- II. Thematische Einführung: Dieses Kapitel beleuchtet die Begriffe „Ikonographie“ und „Ikonologie“ und gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung der Ikonologie.
- III. Die Entwicklung der Ikonologie in Dekaden: Hier werden die wichtigsten Vertreter der Ikonologie und ihre Beiträge zur Methode vorgestellt, wobei die Entwicklung der Methode vom Allgemeinen zum Speziellen hervorgehoben wird.
- IV. Die ikonologische Revolution: Die holländische Genremalerei: Dieses Kapitel analysiert die unterschiedlichen Forschungspositionen zur Ikonologie der holländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts und zeigt dabei die Schwierigkeiten ikonologischer Forschungsansätze auf.
- V. Die Ikonologie im Beispiel: Die Arnolfini-Hochzeit: Anhand des Beispiels des Gemäldes „Die Arnolfini-Hochzeit“ werden die unterschiedlichen ikonologischen Interpretationen von Erwin Panofsky und Joannes Bedaux gegenübergestellt.
- VI. Grenzen: Kritik der Ikonologie: In diesem Kapitel werden die Grenzen der Ikonologie diskutiert, einschließlich der Probleme, offenen Fragen und Sackgassen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ikonologie, Ikonographie, Erwin Panofsky, Kunstgeschichte, Bildinterpretation, holländische Genremalerei, "Die Arnolfini-Hochzeit", methodische Grenzen, Kritik, Quellenlage, Embleme.
- Citation du texte
- Franziska Irsigler (Auteur), 2006, Möglichkeiten und Grenzen der Ikonologie als kunsthistorische Methode. Panofsky und seine Kritiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66726