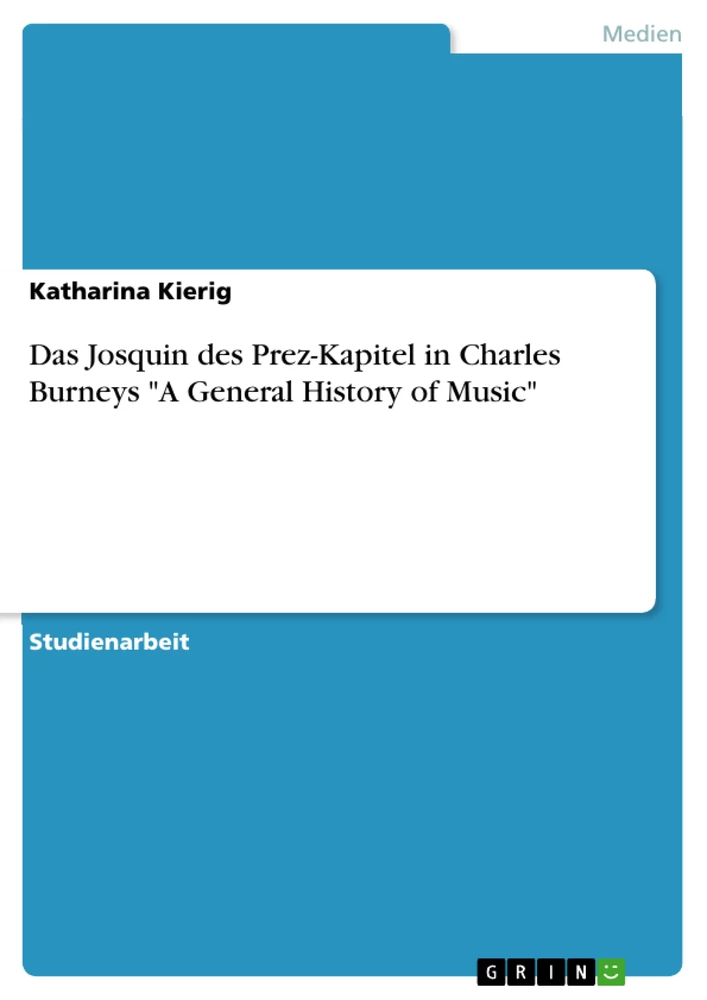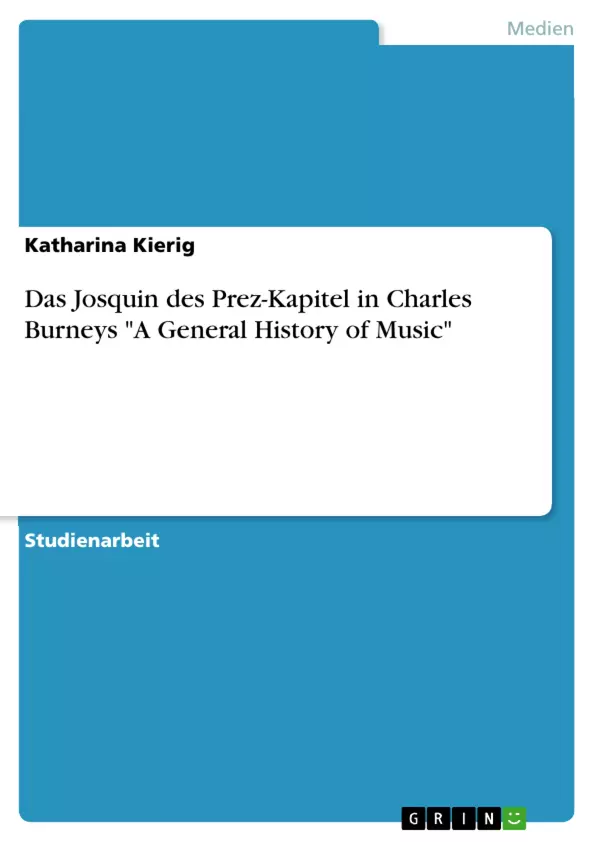Mit seiner »General History of Music«, deren erster Band 1776 erschien, leistete Charles Burney zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Musikgeschichtsschreibung und -forschung. Die kritische Evaluation seiner Arbeit zeigt sowohl das umfangreiche Wissen, über das Burney verfügte, als auch die Lücken desselben, die in den letzten 230 Jahren, wenn auch nicht immer geschlossen, so in mancher Hinsicht jedenfalls verkleinert werden konnten.
Mit Blick auf die Erkenntnisse der Josquin-Forschung des 20. Jahrhunderts galt es, in dieser Arbeit Burneys Vorgehensweise, seinen Umgang mit den ihm verfügbaren Quellen und die Bedeutung des zeitgenössischen Weltbildes für seine Darstellung der Musik des 15./16. Jahrhunderts, insbesondere der Josquins, zu untersuchen. Dabei sollte ein Vergleich der Aussagen zu den Aspekten Biographie, Kompositionsstil, Rezeption, sowie Quellenlage in Burneys »History« und in modernen Schriften zu Josquin des Prez Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Entwicklungen und nach wie vor offene Fragen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Josquin-Bild bei Charles Burney
- Biographie
- Kompositionsstil
- Rezeption
- Josquin das erste musikalische Genie?
- ,,Dunkle Zeiten“
- Verwendete Quellen
- Das heutige Josquin-Bild
- Biographie
- Kompositionsstil
- Rezeption
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Charles Burneys "A General History of Music" für die Musikgeschichtsschreibung und -forschung. Sie analysiert Burneys Darstellung von Josquin des Prez im Kontext der zeitgenössischen Josquin-Forschung des 20. Jahrhunderts. Dabei werden Burneys Vorgehensweise, sein Umgang mit Quellen und der Einfluss des zeitgenössischen Weltbildes auf seine Darstellung der Musik des 15./16. Jahrhunderts beleuchtet.
- Burneys Beitrag zur Musikgeschichtsschreibung
- Bewertung von Burneys "General History of Music" im Kontext der heutigen Musikwissenschaft
- Analyse von Burneys Darstellung von Josquin des Prez
- Vergleich von Burneys Aussagen mit modernen Schriften zu Josquin
- Untersuchung der Bedeutung des Notendrucks für die Rezeption Josquins Musik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach der Relevanz von Burneys "General History of Music" für die heutige Zeit. Sie beleuchtet Burneys Beitrag zur Musikgeschichtsschreibung und stellt die Notwendigkeit einer kritischen Evaluation seiner Arbeit dar.
Das Josquin-Bild bei Charles Burney
Dieser Abschnitt untersucht Burneys Darstellung von Josquin des Prez in seiner "General History of Music". Er analysiert die Biographie, den Kompositionsstil und die Rezeption Josquins aus Burneys Perspektive, wobei ein Vergleich mit der modernen Josquin-Forschung gezogen wird.
Das heutige Josquin-Bild
Dieser Abschnitt stellt das heutige Bild von Josquin des Prez dar. Er befasst sich mit der Biographie, dem Kompositionsstil und der Rezeption Josquins aus der Perspektive der modernen Musikwissenschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen: Josquin des Prez, Charles Burney, Musikgeschichte, Renaissance, Musiktheorie, Notendruck, Rezeption, Biographie, Kompositionsstil, Quellenkritik, "General History of Music", Musikgeschichtsschreibung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Charles Burney?
Charles Burney war ein bedeutender Musikhistoriker des 18. Jahrhunderts, der mit seinem Werk „A General History of Music“ (1776) einen Meilenstein der Musikgeschichtsschreibung schuf.
Wie bewertete Burney den Komponisten Josquin des Prez?
Burney sah in Josquin eine herausragende Figur der Renaissance. Er untersuchte dessen Kompositionsstil und trug maßgeblich zur Rezeption Josquins als eines der ersten „musikalischen Genies“ bei.
Wie unterscheidet sich Burneys Josquin-Bild von der modernen Forschung?
Während Burney auf die ihm damals verfügbaren Quellen angewiesen war, konnte die moderne Forschung des 20. Jahrhunderts viele biographische Lücken schließen und Burneys Ansichten kritisch hinterfragen.
Welche Bedeutung hatte der Notendruck für Josquins Ruhm?
Josquin war einer der ersten Komponisten, dessen Werke in großem Umfang gedruckt wurden (z. B. durch Ottaviano Petrucci), was seine europaweite Bekanntheit und seinen Einfluss massiv steigerte.
Was sind die „Dunklen Zeiten“ in Burneys Geschichtsschreibung?
Burney bezeichnete oft Epochen vor der Renaissance als „dunkel“, da er die Musikentwicklung aus der Perspektive des 18. Jahrhunderts als einen stetigen Fortschritt hin zur Perfektion betrachtete.
- Citar trabajo
- Katharina Kierig (Autor), 2005, Das Josquin des Prez-Kapitel in Charles Burneys "A General History of Music", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66731