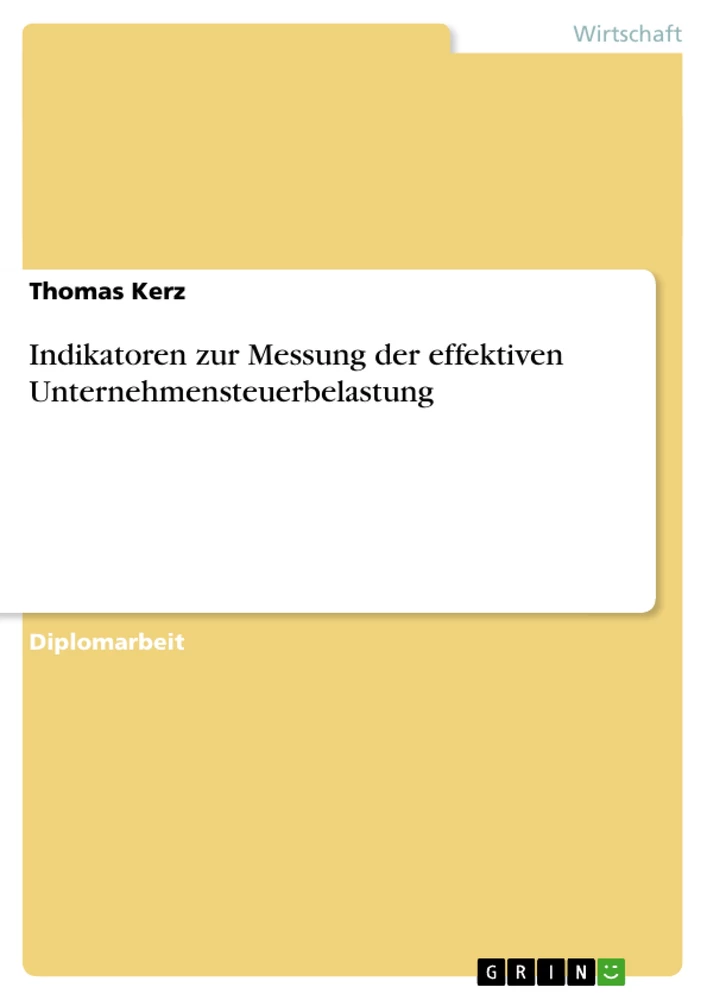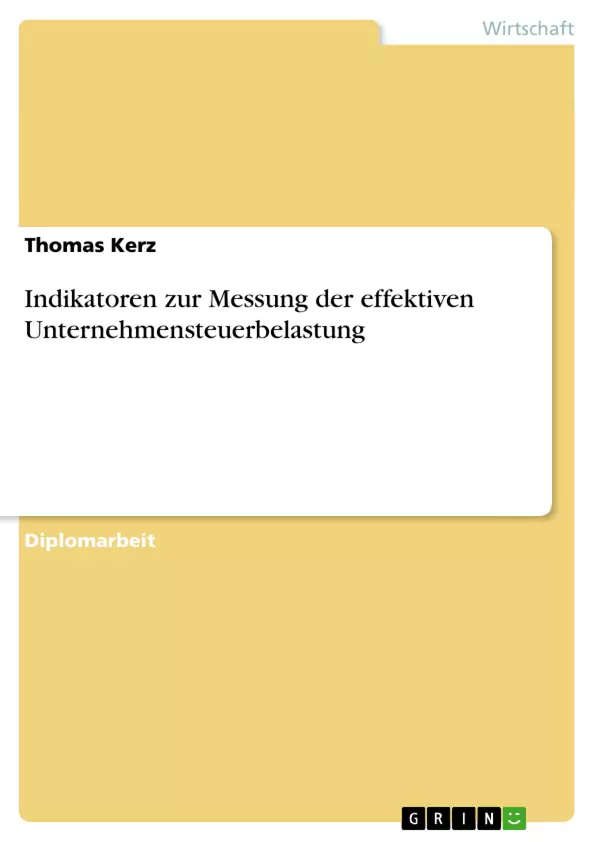Die Besteuerung von Unternehmen als Instrument staatlicher Wirtschaftspolitik kann unternehmerische Dispositionen, insbesondere Investitions- und Standortentscheidungen, beeinflussen. Da Steuern einen wesentlichen Standortfaktor darstellen, rückt die Unternehmensbesteuerung und dabei vor allem die korrekte Messung der Unternehmensteuerbelastung in der gegenwärtigen Phase zunehmender weltwirtschaftlicher Integration verstärkt in den Fokus von politischen Entscheidungsträgern, Interessengruppen, der Öffentlichkeit sowie der Wissenschaft.
In der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion ist die Messung der Steuerbelastung von Unternehmen keinesfalls unumstritten. Vielmehr gibt es konkurrierende methodische Ans¨ atze, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. In Deutschland wurde die akademische Diskussion der Steuerbelastungsmessung durch die Kontroverse zwischen Hettich/Schmidt (2001, 2003) sowie Gutekunst/Hermann/Lammersen verschärft. Die These, die Steuerlast der Unternehmen in Deutschland sei eher im europäischen Mittelfeld zu finden, scheint durch die vergangenheitsorientierte Messung mittels aggregierter Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bestätigt zu werden. Demgegenüber stützen sich Anhänger der These, Deutschland sei im europäischen Vergleich ein Hochsteuerland, auf zukunftsorientierte mikroökonomische Kapitalwert- oder Simulationsmodelle.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist es unbefriedigend, dass die konkurrierenden Messkonzepte zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen, denn es sollte keine Rolle spielen, welcher methodische Ansatz gewählt wird, um die Unternehmensteuerbelastung zu messen. Die vorliegende Arbeit versucht daher aufzuzeigen, welche Problembereiche es bei den im Schrifttum verwendeten Steuerbelastungsindikatoren gibt und warum diese zu Unschärfen in der Messung führen können. Es wird deutlich werden, dass die unterschiedlichen Ergebnisse der einzelnen Ansätze von den getroffenen Annahmen abhängen, die bei der Interpretation der Indikatoren stets zu berücksichtigen sind. Möglicherweise sind die Unterschiede in den methodischen Konzepten jedoch nicht von essentieller Bedeutung, so dass es für Tendenzaussagen hinsichtlich der Höhe der Unternehmensteuerbelastung gar nicht auf die Wahl der Methode ankommt. Es ließe sich dann zwar noch immer über die exakte Höhe streiten, allerdings würde die Schwankungsbreite der Ergebnisse verringert und damit die Kontroverse, ob Deutschland ein Hoch- oder Niedrigsteuerland sei, entschärft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zielsetzung und Untersuchungsablauf
- 2 Grundlagen ökonomischer Steuerbelastungsforschung
- 2.1 Zur Definition der Unternehmensteuer
- 2.2 Notwendigkeit der präzisen Messung der Unternehmensteuerlast
- 2.3 Systematisierung der Konzepte für Steuerbelastungsvergleiche
- 2.3.1 Überblick über methodische Konzepte
- 2.3.2 Ermittlung der Tarifbelastung und Mängel des Tarifvergleichs
- 2.3.3 Erfordernis der Messung der effektiven Steuerbelastung ....
- 3 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Unterneh- mensteuerbelastung
- 3.1 Zukunftsorientierte Messkonzepte auf Basis hypothetischer Investiti- onsprojekte
- 3.1.1 Gegenwartsbetrachtung künftiger Zahlungsströme
- 3.1.2 Effektiver Grenzsteuersatz nach King und Fullerton (1984)
- 3.1.2.1 Modellansatz
- 3.1.2.2 Kapitalkostengleichungen
- 3.1.2.3 Bestimmung des relevanten Diskontierungssatzes
- 3.1.2.4 Bestimmung des Barwertes steuerlicher Abschreibungsabzüge.
- 3.1.3 Effektiver Durchschnittsteuersatz im Modell von Devereux und Griffith (1999) . . .
- 3.1.3.1 Kapitalmarktgleichgewicht
- 3.1.3.2 Diskontfaktoren.
- 3.1.3.3 Definition des effektiven Durchschnittsteuersatzes
- 3.1.3.4 Zusammenhang zwischen effektivem Grenz- und Durchschnittsteuersatz . .
- 3.1.3.5 Berechnung der Belastungsindikatoren
- 3.1.4 Offene Problembereiche
- 3.1.4.1 Steuerplanungsaktivitäten
- 3.1.4.2 Unsicherheit und Irreversibilität.
- 3.1.5 Kritische Würdigung der zukunftsorientierten Belastungsindi- katoren auf Basis hypothetischer Investitionsprojekte
- 3.2 Zukunftsorientierte Messkonzepte auf Basis hypothetischer Unternehmen 30
- 3.2.1 Grundkonzeption des European Tax Analyzers.
- 3.2.2 Kritische Würdigung des European Tax Analyzers.
- 4 Vergangenheitsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Unternehmensteuerbelastung
- 4.1 Theoretischer Rahmen vergangenheitsorientierter Messkonzepte
- 4.2 Vergangenheitsorientierte Messkonzepte auf Basis der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung .
- 4.2.1 Insuffizienz gesamtwirtschaftlicher Steuerquoten als Belastungsindikator.
- 4.2.2 Impliziter Steuersatz auf Kapital im Grundmodell von Mendoza, Razin, Tesar (1994)
- 4.2.3 Modifiziertes Konzept nach Carey und Rabesona (2002)
- 4.2.4 Impliziter Unternehmensteuersatz
- 4.2.5 Offene Problembereiche
- 4.3 Vergangenheitsorientierte Messkonzepte auf Basis von Jahresabschlussdaten
- 4.3.1 Die Grundkonzeption des Bilanzdatenansatzes
- 4.3.2 Offene Problembereiche
- 4.4 Kritische Würdigung der vergangenheitsorientierten Steuerbelastungsindikatoren
- 5 Zusammenhänge zwischen zukunftsorientierten und vergangenheitsorientierten Indikatoren
- 5.1 Empirische Differenzen
- 5.1.1 Stilisierte Fakten
- 5.1.2 Konjunkturabhängigkeit der Indikatoren
- 5.2 Theoretische Differenzen
- 5.2.1 Identität zukunftsbezogener und vergangenheitsbezogener Indikatoren
- 5.2.2 Konstruktionsbedingte Differenzen
- Definition und Messung der Unternehmensteuerbelastung
- Zukunftsorientierte Messkonzepte auf Basis hypothetischer Investitionsprojekte
- Vergangenheitsorientierte Messkonzepte auf Basis der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und von Jahresabschlussdaten
- Empirische Unterschiede und theoretische Differenzen zwischen den verschiedenen Ansätzen
- Kritik und Bewertung der verwendeten Indikatoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Messung der effektiven Unternehmensteuerbelastung und analysiert die verschiedenen methodischen Ansätze, die in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion verwendet werden. Das Ziel ist es, die Stärken und Schwächen der verschiedenen Indikatoren aufzuzeigen und die Ursachen für die divergierenden Ergebnisse der unterschiedlichen Ansätze zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Unternehmensteuerbelastung ein und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext der Globalisierung und der zunehmenden Mobilität von Unternehmen. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Steuerbelastungsforschung und definiert den Begriff der Unternehmensteuer. Es werden die verschiedenen methodischen Ansätze zur Messung der Steuerbelastung systematisiert und die Notwendigkeit einer präzisen Messung der effektiven Steuerbelastung erläutert. Kapitel 3 konzentriert sich auf zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Unternehmensteuerbelastung. Hierbei werden insbesondere die Modelle von King und Fullerton (1984) sowie Devereux und Griffith (1999) vorgestellt und kritisch analysiert. Kapitel 4 befasst sich mit vergangenheitsorientierten Messkonzepten. Es werden sowohl Ansätze auf Basis der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als auch auf Basis von Jahresabschlussdaten betrachtet. Die offenen Problembereiche der jeweiligen Konzepte werden diskutiert. Kapitel 5 beleuchtet die empirischen und theoretischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Indikatoren. Es wird untersucht, ob und inwieweit die Wahl des methodischen Ansatzes die Ergebnisse beeinflusst.
Schlüsselwörter
Effektive Unternehmensteuerbelastung, Steuerbelastungsindikatoren, zukunftsorientierte Konzepte, vergangenheitsorientierte Konzepte, Hypothetische Investitionsprojekte, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Jahresabschlussdaten, King und Fullerton (1984), Devereux und Griffith (1999), Europäischer Steueranalysator, Steuerplanungsaktivitäten, Unsicherheit, Irreversibilität.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Messung der effektiven Steuerbelastung wichtig?
Sie ist ein entscheidender Faktor für Investitions- und Standortentscheidungen von Unternehmen im Zuge der weltwirtschaftlichen Integration.
Was unterscheidet zukunfts- von vergangenheitsorientierten Messkonzepten?
Zukunftsorientierte Modelle basieren auf hypothetischen Investitionsprojekten, während vergangenheitsorientierte Ansätze aggregierte Daten aus Jahresabschlüssen oder Volkswirtschaften nutzen.
Was ist der effektive Grenzsteuersatz nach King und Fullerton?
Es ist ein Modell zur Messung der Steuerbelastung einer Grenzinvestition, also eines Projekts, das gerade noch eine geforderte Mindestrendite erzielt.
Was ist der "European Tax Analyzer"?
Ein computergestütztes Modell, das die Steuerbelastung hypothetischer Unternehmen über einen längeren Zeitraum simuliert und vergleicht.
Ist Deutschland ein Hochsteuerland?
Die Antwort hängt vom gewählten Messkonzept ab: Mikroökonomische Modelle stützen oft die Hochsteuer-These, während makroökonomische Daten Deutschland eher im Mittelfeld sehen.
- Quote paper
- Thomas Kerz (Author), 2005, Indikatoren zur Messung der effektiven Unternehmensteuerbelastung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66812