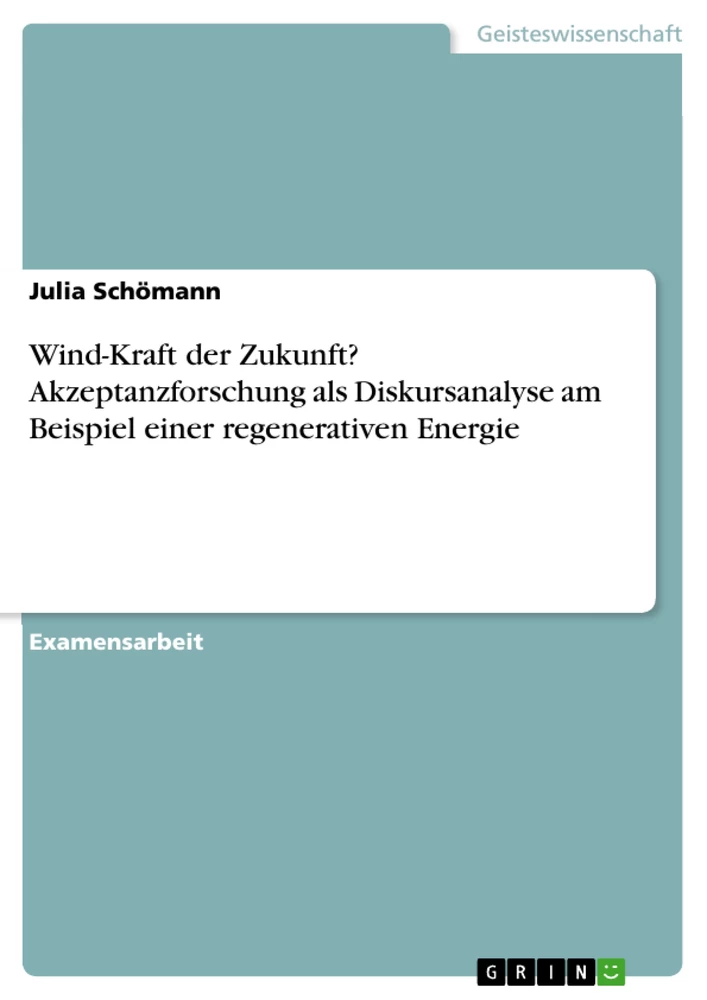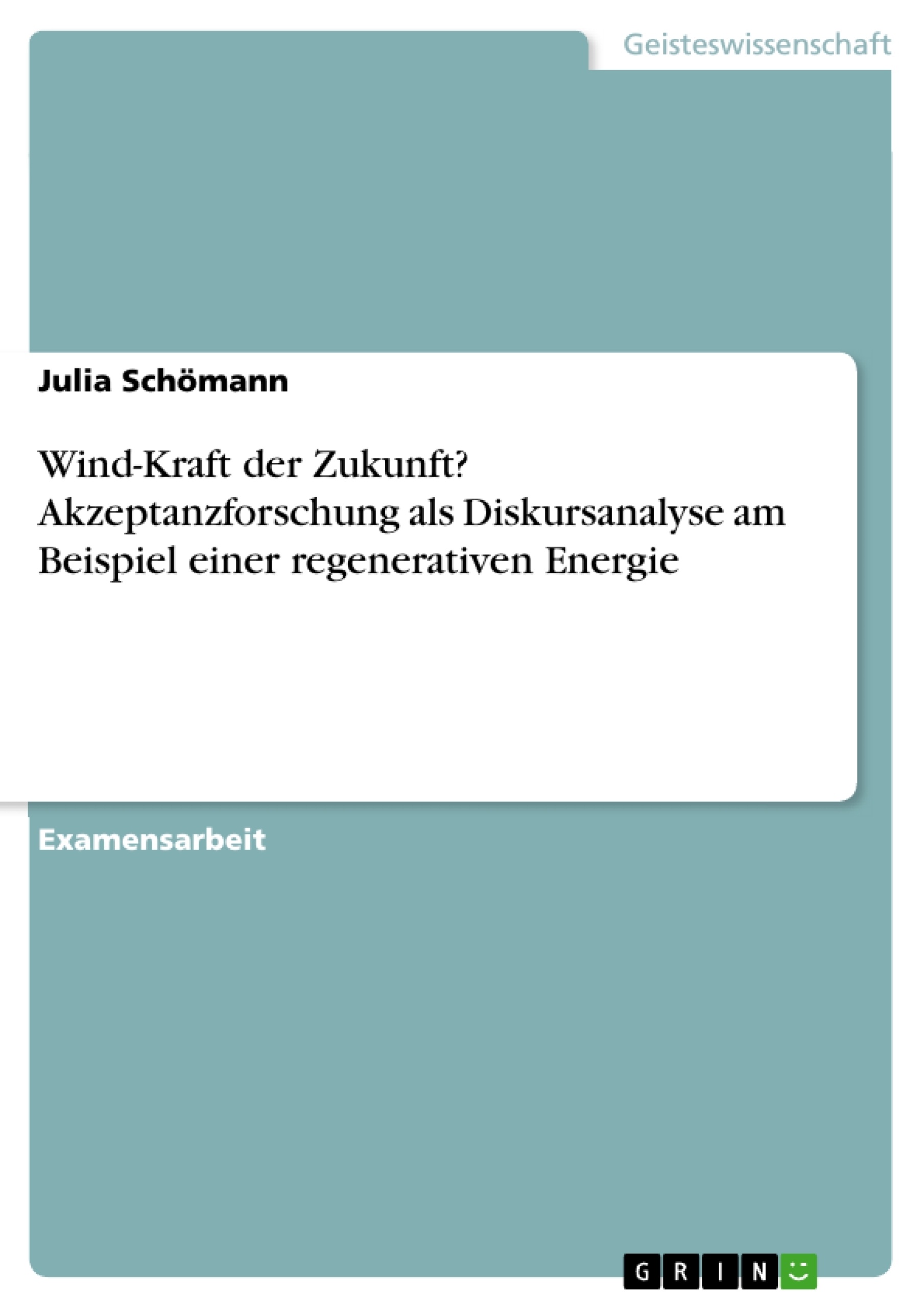1. Einleitung
„Energie ist das treibende Moment aller Naturprozesse und stellt damit eine wesentliche Bedingung für die Entwicklung des Lebens auf der Erde als auch der menschlichen Gesellschaft dar. Wie alle Lebewesen ist der Mensch auf einen permanenten Zustrom an Energie angewiesen, um Nahrung, Wärme, Licht und die für ein angenehmes Leben wichtige Güterproduktion sicherzustellen.“ (Ackermann/ Krämer/ u.a. 2001: 18). 1 Die gesellschaftliche Bedeutung der Energienutzung besitzt eine lange Geschichte. Seit der industriellen Revolution und der Erschließung fossiler Energieträger, später der Entdeckung der Atomenergie, spielt dabei der Einsatz von Technik eine große Rolle. Vor dem Hintergrund der weltweiten Klimaerwärmung und der Endlichkeit fossiler Brennstoffe werden die technischen Errungenschaften jedoch nicht nur als Eingriff in die Natur, sondern auch als deren Ausbeutung und Zerstörung angesehen. 2 Aus diesem Grund gewinnen regenerative Energien immer mehr an Bedeutung. Sonne, Wind, Wasser und Biomasse gelten als die Hoffnungsträger zur ressourcenschonenden und CO 2 -armen Energiegewinnung. Trotzdem liegt die Forschung - obwohl schon viele Fortschritte erzielt wurden - bezüglich der effektiven Nutzung regenerativer Energieträger noch weit zurück, so dass die Stromgewinnung aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse verhältnismäßig teuer ist (Ackermann/ Krämer/ u.a. 2001: 20f). Zur notwendigen finanziellen Unterstützung der erneuerbaren Energieformen trägt seit Anfang der 90er Jahre das Energiewirtschafts- und Stromeinspeisegesetz bei, das von allen Fraktionen im Bundestag unterstützt wurde. 3 Es verpflichtet die Energieversorgungsunternehmen zur Einspeisung und Vergütung des Stroms, der durch regenerative Energien erzeugt wird. Diese staatliche Förderung der erneuerbaren Energieträger ging einher mit der mehrheitlichen Zustimmung in der Bevölkerung, die u.a. durch Ölkrisen und die Katastrophe von Tschernobyl zu einem neuen Umweltbewusstsein gelangt war (Hasse 1999: 14). 4
Die Windkraft, als eine der staatlich geförderten erneuerbaren Energien, erfuhr aufgrund der technischen Errungenschaften in diesem Sektor schon Anfang der 80er Jahre einen regelrechten Boom. Die Windenergieanlagen (WEA) wurden zu seriengefertigten Einheiten weiterentwickelt, deren Leistung sich stetig steigerte.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Akzeptanzkriterien und Akzeptanzforschung
- Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz
- Wissenschaftliche Akzeptanzforschung
- Technikakzeptanz und Technikfeindlichkeit
- Abschließende Bemerkungen
- Diskursanalyse in Anlehnung an Foucault
- Die Beschreibung eines Diskurses
- Das genealogische Prinzip
- Abschließende Bemerkungen
- Anwendungen der foucaultschen 'Werkzeugkiste'
- Der biopolitische Diskurs (Siegfried Jäger)
- Der Abfalldiskurs (Reiner Keller)
- Der Luftreinhaltungsdiskurs (Maarten Hajer)
- Zusammenfassung
- Analyse des Akzeptanzdiskurses der Windkraft
- Die Auswahl des Korpus
- Leitfaden zur Analyse
- Diskursive Formationen im Windkraftstreit
- Die Homepage des Bundesumweltministeriums
- Die Webseiten der Bürgerinitiativen
- Zusammenfassung und Vergleich
- Die Verschränkung der Diskurse
- Risiko- und Umweltwahrnehmung
- Natur- und Technikwahrnehmung
- Abschließende Bemerkungen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Akzeptanzforschung im Kontext der Windkraftnutzung. Sie analysiert den Diskurs um die Windkraft in Deutschland und untersucht die dahinterliegenden Akzeptanzkriterien und -faktoren. Dabei wird die diskursanalytische Methode nach Michel Foucault angewendet.
- Analyse der Akzeptanzkriterien und -faktoren für die Windkraftnutzung
- Anwendung der diskursanalytischen Methode nach Foucault
- Untersuchung der Diskurse im Windkraftstreit
- Herausarbeitung der Verschränkung verschiedener Diskurse
- Bewertung der Akzeptanzsituation der Windkraft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Das Kapitel stellt die Relevanz des Themas Windkraftnutzung vor und beschreibt die Bedeutung der Energieversorgung in der heutigen Zeit. Es werden die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung und der Endlichkeit fossiler Brennstoffe erläutert, welche die Suche nach nachhaltigen Energiequellen, wie der Windkraft, notwendig machen.
Akzeptanzkriterien und Akzeptanzforschung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz und geht auf die wissenschaftliche Akzeptanzforschung ein. Es werden die Konzepte der Technikakzeptanz und Technikfeindlichkeit beleuchtet.
Diskursanalyse in Anlehnung an Foucault: In diesem Kapitel wird die Diskursanalyse nach Foucault vorgestellt. Es werden die Beschreibung eines Diskurses, das genealogische Prinzip und die methodischen Ansätze der Diskursanalyse erläutert.
Anwendungen der foucaultschen 'Werkzeugkiste': Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Anwendungsbeispiele der Diskursanalyse nach Foucault in unterschiedlichen Disziplinen, wie z.B. der Biopolitik, dem Abfalldiskurs und dem Luftreinhaltungsdiskurs. Es werden die jeweiligen Diskursformationen und Machtverhältnisse aufgezeigt.
Analyse des Akzeptanzdiskurses der Windkraft: Hier wird die Diskursanalyse auf den Windkraftstreit angewendet. Die Analyse basiert auf einem Korpus, das aus den Homepages des Bundesumweltministeriums und Bürgerinitiativen besteht. Die Analyse untersucht die diskursiven Formationen und die Verschränkung verschiedener Diskurse, die den Windkraftstreit prägen.
Schlüsselwörter
Akzeptanz, Windkraft, Diskursanalyse, Foucault, Umweltpolitik, Energieversorgung, Klimawandel, Bürgerinitiativen, Technikakzeptanz, Technikfeindlichkeit, Risiko- und Umweltwahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Akzeptanz von Windkraft diskursanalytisch untersucht?
Die Diskursanalyse hilft zu verstehen, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen (z. B. Ministerien vs. Bürgerinitiativen) das Thema Windkraft sprachlich konstruieren und bewerten.
Welche Rolle spielt Michel Foucault in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt Foucaults methodische „Werkzeugkiste“, um Machtverhältnisse und Wissensstrukturen innerhalb des Windkraftstreits aufzudecken.
Was ist der Unterschied zwischen Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz?
Die Forschung unterscheidet zwischen der bloßen Duldung (Akzeptanz) und dem aktiven Widerstand oder der Ablehnung (Nicht-Akzeptanz) von Technikprojekten.
Welche Materialien wurden für die Analyse verwendet?
Untersucht wurden unter anderem die Homepage des Bundesumweltministeriums sowie Webseiten verschiedener Bürgerinitiativen gegen Windkraft.
Welche Faktoren beeinflussen die Risiko- und Umweltwahrnehmung?
Die Arbeit zeigt, dass die Wahrnehmung von Natur und Technik stark davon abhängt, ob Windkraft als Chance für den Klimaschutz oder als Bedrohung für die Landschaft gesehen wird.
Was ist ein „biopolitischer Diskurs“?
Es handelt sich um einen Diskurs, der sich mit der Steuerung und Verwaltung von Lebensprozessen in der Gesellschaft befasst, was auch die Energieversorgung betrifft.
- Quote paper
- Julia Schömann (Author), 2006, Wind-Kraft der Zukunft? Akzeptanzforschung als Diskursanalyse am Beispiel einer regenerativen Energie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66871