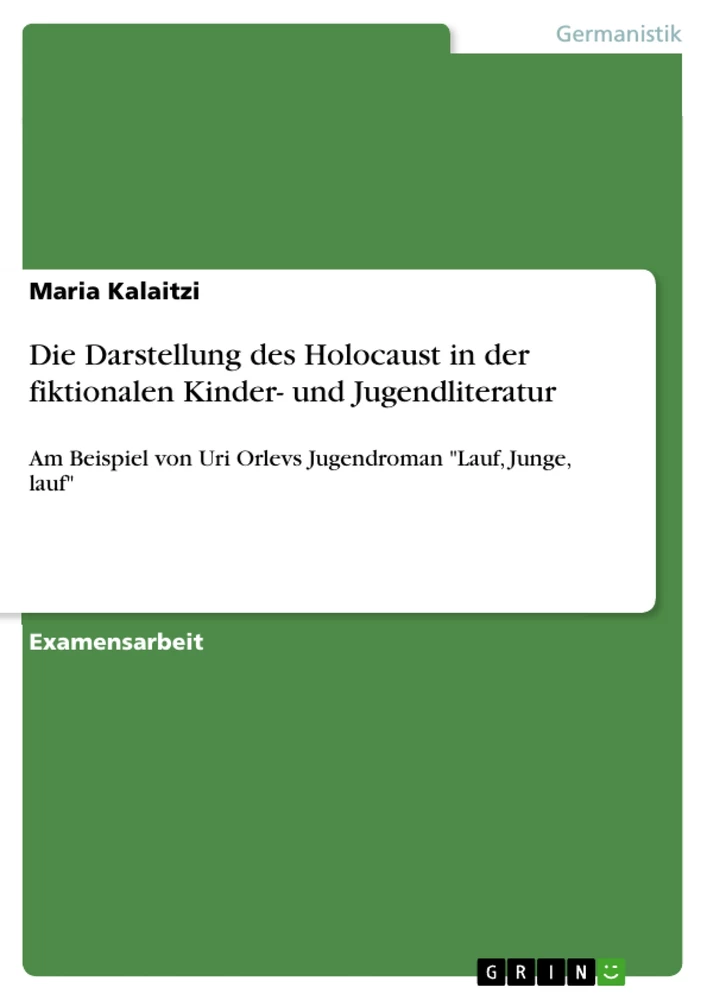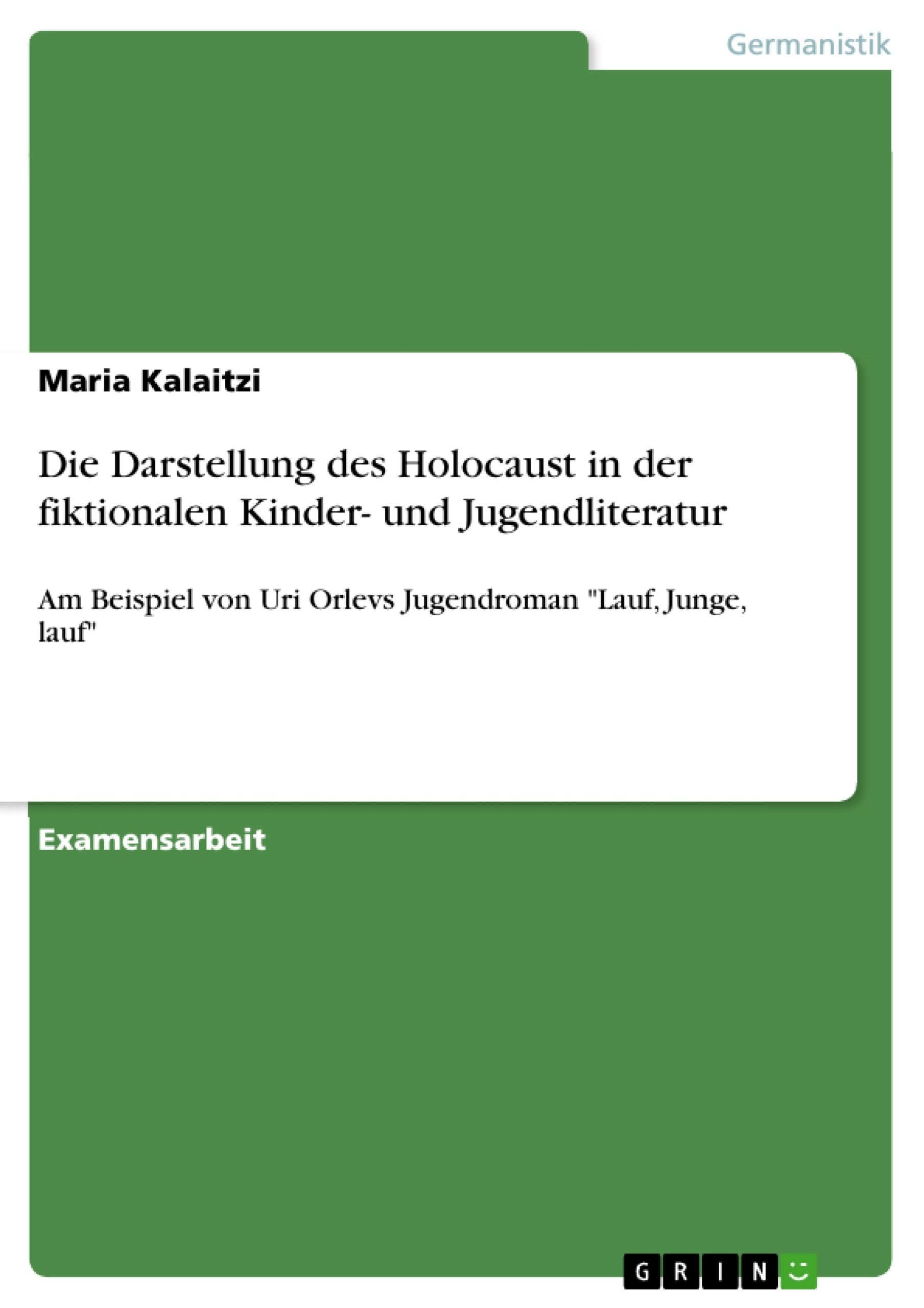Das Thema Holocaust hat nach wie vor Relevanz in der kindlichen Lebenswelt, überall und in jedem Alter, bei gleichzeitig immer noch fehlenden Unterrichtskonzepten in Schulen. Das grausame Kapitel der NS-Herrschaft verknüpft Vergangenes mit der Gegenwart in einer Weise, die jedem Menschen, vor allem dem an der Erziehung beteiligten, eine Thematisierung und Wachsamkeit abverlangt. Im Sinne einer politischen Bildung, aber auch einer ethischen Erziehung,ist die Beschäftigung mit der Thematik Holocaust auch 60 Jahre danach wichtig und nötig. Die zeitliche Distanz zu den Ereignissen des Nationalsozialismus hat Konsequenzen für die politische, aber auch für die literaturwissenschaftliche Perspektive. Als Beispiel für ein aktuelles Werk dient der Jugendroman "Lauf, Junge, lauf" von Uri Orlev. Unter Zuhilfenahme spezieller Kriterien der Holocaustliteratur wird das Werk literaturanalytisch bewertet. Der methodisch-didaktische Teil übersetzt die gewonnenen Erkenntnisse in die Unterrichtspraxis und schlägt Anwendungsmöglichkeiten vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende terminologische und literaturhistorische Aspekte der Thematik
- Terminologische Problematik
- Das historische Ereignis – Formen der literarischen Überlieferung
- Fiktionalität versus Historizität – die narrative Vergegenwärtigung des Holocaust
- Theoretische Überlegungen zur Vermittlung des Themas „Holocaust“
- Psychologische Erinnerungsbarrieren und deren Folgen für die erzieherische Arbeit
- Der Umgang der Kinder mit dem Tod
- Piagets entwicklungstheoretisches Stufenmodell
- Kritik an Piagets Stufenmodell
- Ein Konsens und die Konsequenzen
- Die Rolle der Pädagogik bei der Aufarbeitung des Holocaust
- Zukunft braucht Vergangenheit: „Und was geht mich das an?“
- Gegenwartsbezug: Aktuelle Ereignisse mit neonazistischem Hintergrund in der Öffentlichkeitsdarstellung
- Diskussion über psychische Voraussetzungen von Grundschulkindern für die Thematisierung des Holocaust oder „Ist Überforderung noch ein Argument?“
- Spuren der Vergangenheit: Der Holocaust und die Kultur des Erinnerns
- Im Spannungsfeld zwischen Perspektivlosigkeit und Hoffnung: Angemessene Darstellung historischer Realität und der Schutz der kindlichen Integrität
- Erziehungsideale in der pädagogischen Diskussion: Die Forderung, „dass Auschwitz nicht noch einmal sei...“
- Exkurs: Empathie und Perspektivenübernahme
- Psychologische Erinnerungsbarrieren und deren Folgen für die erzieherische Arbeit
- Didaktisch-methodisches Vorgehen bei der Umsetzung im Unterricht
- Lehrer- und Erzieherrolle bei der Vermittlung des Holocaust
- Selbstreflexion der Lehrperson und die Rolle der Eltern
- Wie sag ich es? Zur Vermeidung von Sprachlosigkeit
- Unterrichtsgestaltung
- Literaturtheoretische Betrachtungen
- Kinder- und Jugendliteratur – Definition und Genese
- Historische und definitorische Aspekte der Kinder- und Jugendliteratur
- Fiktonale Kinder- und Jugendliteratur: eine Merkmalsbestimmung
- Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur
- Narrative Texte als Zugang zum Holocaust und das Dilemma der Ästhetisierung
- Was ist Holocaustliteratur?
- Wozu fiktionale Holocaustliteratur?
- Identifikation durch fiktionale Holocaustliteratur: Möglichkeiten und Grenzen
- Besondere Aspekte des Themas in der Kinder- und Jugendliteratur
- Genese der Kinder- und Jugendliteratur über den Holocaust von der Nachkriegszeit bis heute
- Zur Übersetzungsproblematik
- Deutungen des Faschismus in Kinder- und Jugendbüchern
- Beurteilungskriterien für die literarische Analyse von Kinder- und Jugendbüchern nach Ernst Cloer
- Kinder- und Jugendliteratur – Definition und Genese
- Narratologische Analyse des Jugendromans Lauf, Junge, lauf
- Einleitende Informationen und formaler Aufbau des Buches
- Autorenporträt
- Aufbau und Bewertung nach Cloers Beurteilungsraster
- Inhalt
- Historischer Hintergrund
- Faschismusverständnis
- Literarische Gestaltung
- Zum Titel des Buches
- Erzählinstanz
- Spannungsgestaltung
- Zwischen Abenteuergeschichte und Zeitgeschichtlichem Roman
- Erzählte Zeit – Erzählzeit: zwischen Stunden und Jahren
- Erzählweise
- Sprachprofil
- Exkurs: Humor in der Holocaustliteratur im polaren Spannungsfeld: legitim oder vermessen?
- Verknüpfung von Individual- und Gesellschaftsgeschichte
- Handlungsfiguren
- Entwicklung der Hauptfigur
- Figurenkonstellationen
- Die Frau des Partisanen
- Bei der Gestapo: Soldat und Offizier
- Adressaten
- Kritische Würdigung / Beurteilung
- Medien
- Fachdidaktische Überlegungen und Vorschläge für die Umsetzung der Unterrichtseinheit im Deutschunterricht
- Begründung für den Einsatz des Romans im Deutschunterricht
- Wege eines gelungenen Einstiegs in den Roman
- Textanalytisches Vorgehen
- Produktionsorientierter Unterricht
- Handlungsorientierter Unterricht
- Legitimation der Thematik im Literaturunterricht durch den Lehrplan der Haupt- und Realschule des Hessischen Kultusministeriums
- Der Literaturunterricht im Bildungsgang Realschule
- Lernzielformulierung
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Holocaust in der fiktionalen Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel von Uri Orlevs Jugendroman „Lauf, Junge, lauf“. Sie untersucht, wie das Thema des Holocaust in der Literatur für Kinder und Jugendliche verarbeitet wird und welche Herausforderungen die Vermittlung dieses sensiblen Themas mit sich bringt.
- Die terminologische und literaturhistorische Einordnung des Holocaust
- Die Herausforderungen der Vermittlung des Holocaust an Kinder und Jugendliche
- Die Rolle der Pädagogik bei der Aufarbeitung des Holocaust
- Die narrative Vergegenwärtigung des Holocaust in fiktionalen Texten
- Die Analyse des Romans „Lauf, Junge, lauf“ nach literaturtheoretischen Kriterien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Darstellung des Holocaust in der Kinder- und Jugendliteratur ein und skizziert die Notwendigkeit, dieses Thema in der heutigen Gesellschaft zu thematisieren.
Kapitel 2 befasst sich mit grundlegenden terminologischen und literaturhistorischen Aspekten der Thematik. Es beleuchtet die Problematik der sprachlichen Bezeichnung des Holocaust und untersucht verschiedene Formen der literarischen Überlieferung des historischen Ereignisses.
Kapitel 3 widmet sich den theoretischen Überlegungen zur Vermittlung des Holocaust an Kinder und Jugendliche. Es untersucht die psychologischen Erinnerungsbarrieren, die Kinder im Umgang mit dem Thema Tod haben, und analysiert die Rolle der Pädagogik bei der Aufarbeitung des Holocaust.
Kapitel 4 befasst sich mit dem didaktisch-methodischen Vorgehen bei der Umsetzung des Themas im Unterricht. Es beleuchtet die Rolle der Lehrkraft und der Eltern und gibt praktische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung.
Kapitel 5 analysiert die Kinder- und Jugendliteratur im Allgemeinen und geht auf die Besonderheiten der Holocaustliteratur ein. Es diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der fiktionalen Gestaltung des Holocaust und untersucht verschiedene Beurteilungskriterien für die Analyse von Kinder- und Jugendbüchern.
Kapitel 6 bietet eine narratologische Analyse des Jugendromans „Lauf, Junge, lauf“ von Uri Orlev. Es untersucht die formale Gestaltung des Buches und analysiert die einzelnen Elemente der Erzählung, wie zum Beispiel die Figuren, die Handlung und die Sprache.
Kapitel 7 beinhaltet fachdidaktische Überlegungen und Vorschläge für die Umsetzung der Unterrichtseinheit im Deutschunterricht. Es gibt praktische Hinweise zur Gestaltung des Unterrichts und zeigt, wie der Roman im Rahmen des Lehrplans eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Holocaust, Kinder- und Jugendliteratur, narrative Vergegenwärtigung, Erinnerungskultur, Pädagogik, didaktisch-methodisches Vorgehen, Holocaustliteratur, „Lauf, Junge, lauf“, Uri Orlev
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Thematisierung des Holocaust in der Erziehung heute noch wichtig?
Die Beschäftigung ist im Sinne der politischen Bildung und ethischen Erziehung notwendig, um Wachsamkeit gegenüber aktuellen rechtsextremen Tendenzen zu fördern und die Erinnerungskultur zu bewahren.
Welcher Jugendroman wird in der Arbeit analysiert?
Als zentrales Beispiel dient der Roman "Lauf, Junge, lauf" von Uri Orlev.
Welche psychologischen Herausforderungen gibt es bei der Vermittlung an Kinder?
Kinder haben oft spezifische Erinnerungsbarrieren und gehen anders mit dem Thema Tod um, was bei der pädagogischen Aufarbeitung (z. B. nach Piaget) berücksichtigt werden muss.
Was sind die Beurteilungskriterien für Holocaustliteratur nach Ernst Cloer?
Dazu gehören unter anderem der historische Hintergrund, das vermittelte Faschismusverständnis, die literarische Gestaltung sowie die Figurenentwicklung.
Was ist das "Dilemma der Ästhetisierung" in der Holocaustliteratur?
Es beschreibt den schwierigen Spagat zwischen einer literarisch ansprechenden Erzählweise und der Notwendigkeit, der grausamen historischen Realität gerecht zu werden, ohne sie zu verharmlosen.
Wie kann der Holocaust im Deutschunterricht produktionsorientiert umgesetzt werden?
Durch handlungs- und produktionsorientierte Methoden können Schüler eigene Texte verfassen oder Perspektiven übernehmen, um ein tieferes Verständnis für die historischen Schicksale zu entwickeln.
- Arbeit zitieren
- Maria Kalaitzi (Autor:in), 2006, Die Darstellung des Holocaust in der fiktionalen Kinder- und Jugendliteratur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66902