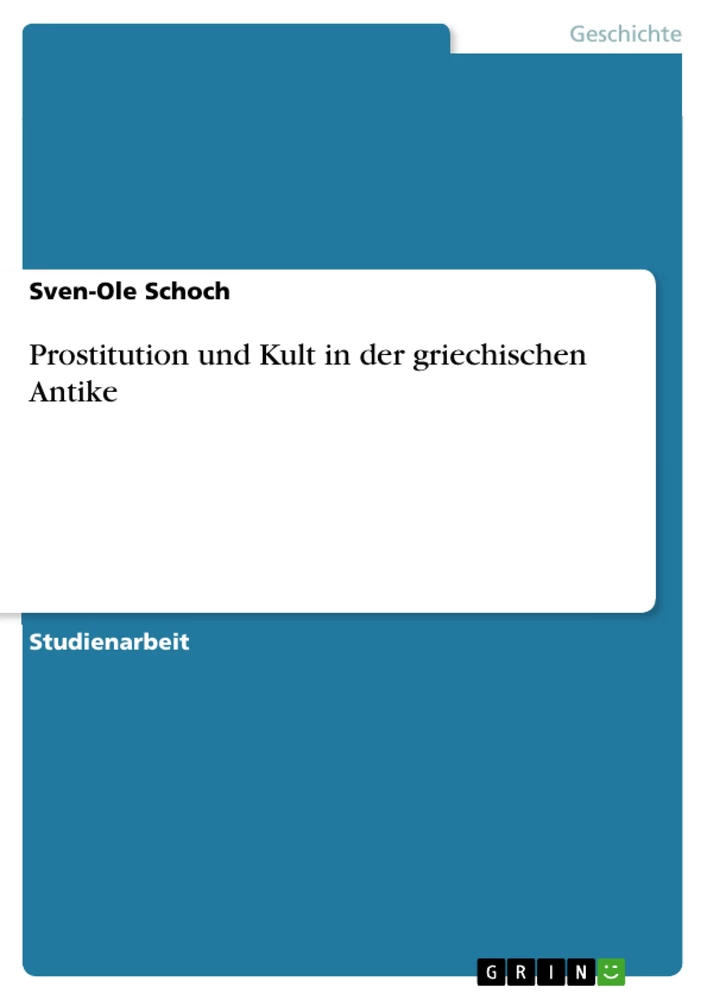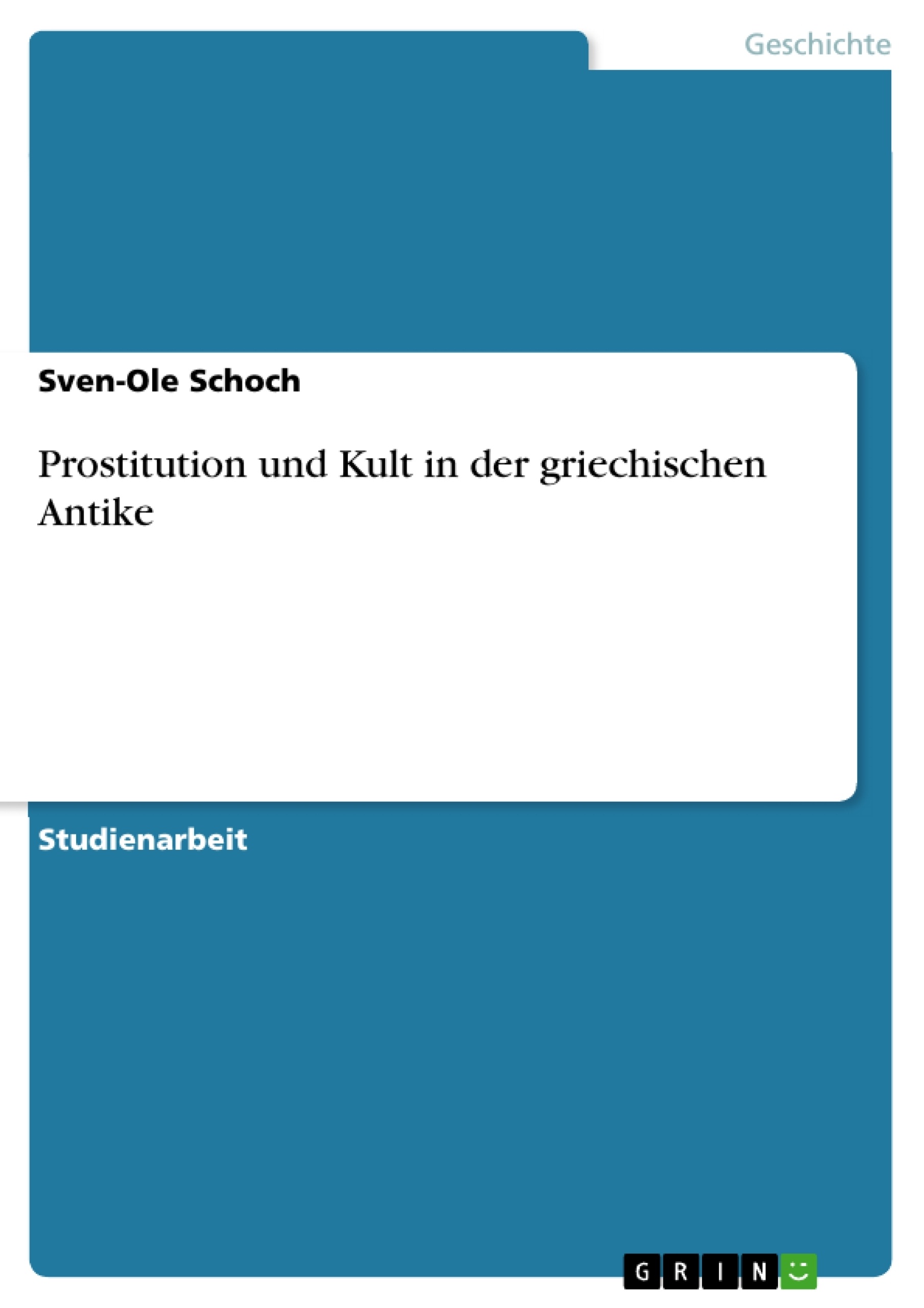Das Ausmaß der Prostitution in der griechischen Antike ist beispiellos in der Geschichte. In nahezu allen Lebensbereichen waren Hetären zu finden, so auch in der Religion. Allerdings gab es für die Hetären gewisse Einschränkungen, so dass sich die Frage stellt, ob die Prostitution vom Kult ausgeschlossen werden sollte.
Die Einschränkungen galten für Prostituierte gerade bei der aktiven Teilnahme an kultischen Handlungen. Sie waren jedoch nicht aufgrund ihres Berufes davon ausgeschlossen, sondern aufgrund ihres Standes in der Gesellschaft der jeweiligen griechischen Polis. Allein die Bürgerin durfte bei fast allen Kulten ihrer Polis aktiv an den Handlungen teilnehmen. Die Prostituierten zählten aber zu den Fremden. Dieser Personengruppe, bei denen es sich um Sklaven und Metöken handelte, war es zwar durchaus erlaubt die Heiligtümer aufzusuchen und an den Feierlichkeiten teilzunehmen, sie durften aber nur einen passiven Part übernehmen. Wie alle Frauen, so mussten sich auch Prostituierte an Reinheitsvorschriften halten, die den Zutritt zu den Heiligtümern regelten. Nur in wenigen Fällen ist überliefert, dass Prostituierte strengere Reinheitsvorschriften einhalten mussten.
Zeugnisse der Teilnahme von Prostituierten am griechischen Kult stellen die Votivgaben dar. Insbesondere die Gottheiten Aphrodite, Athene und Apollon wurden mit Gaben von Prostituierten bedacht. Dass die Prostitution im Kult der griechischen Antike durchaus kein Tabu war, versuchen einige Historiker durch die Tempelprostitution zu begründen. In erster Linie handelt es sich hierbei nicht um Prostitution, die im Tempel selbst stattfand, sondern um Prostitution zu Ehren einer Gottheit außerhalb der Heiligtümer. Allerdings sind hierzu die Quellen spärlich und zeitlich sehr ungenau, so dass viele Historiker bezweifeln, dass es im griechischen Raum zur Tempelprostitution kam.
Die Zeugnisse zeigen dennoch sehr wohl, dass Prostitution mit der Religion vereinbar war. Die schriftlichen Quellen über Hetären im griechischen Kult sind zwar wenig, allerdings kann hieraus geschlossen werden, dass Hetären in den Heiligtümern und bei kultischen Festen kein Aufsehen erregten, sondern als alltägliche Begebenheit angesehen wurden.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Frau im Kult
2.1 Die Fremde
3. Reinigung
3.1 Weitere Reinheitsvorschriften
4. Religiöse Feste
5. Votivgaben der Prostituierten
6. Männliche Prostituierte
7. Aphrodite und Prostituierte
7.1 Tempelprostitution
8. Fazit
9. Literaturangaben
1. Einleitung
Das Hetärenwesen im klassischen Griechenland ist ein Kulturphänomen, welches beispiellos in der Geschichte ist.[1] Während das Prostituiertengewerbe in der heutigen Zeit als anstößig gilt und mit negativen Eigenschaften verbunden wird, erfreuten sich in Griechenland Männer der verschiedensten Schichten an der käuflichen Liebe. So luden sich wohlhabende Bürger der Oberschicht Kurtisanen für das Symposion ein und weniger wohlhabende Männer suchten die Bordelle oder die Straßenstrichs entlang der Festungsmauer auf. Das Ausmaß der Prostitution war folglich weit über den heutigen Verhältnissen. Die Prostituierten waren daher in vielen Lebensbereichen des antiken Griechenlands vorhanden und müssten demnach auch im griechischen Kult teilgenommen haben.
In dieser Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, in wie weit Prostituierte an den verschiedensten Kulten teilnahmen, oder teilnehmen durften. Lässt sich die „Normalität“, die die Prostitution hatte, auch auf den Bereich der Religion übertragen, oder war die Prostitution nicht mit den Kulten vereinbar?
Zu Beginn dieser Arbeit stelle ich zunächst die Statusunterschiede zwischen den Frauen innerhalb einer Polis heraus und gehe dann in einem weiteren Schritt auf die Reinheitsvorschriften ein, die im Kult eingehalten werden mussten. Anschließend untersuche ich ausgewählte religiöse Fest und die Teilnahme der Prostituierten, sowie die Votivgaben der Prostituierten zu Ehren der Götter. Zum Schluss gehe ich noch auf die männliche Prostitution und die Tempelprostitution zu Ehren Aphrodites ein. Anhand der untersuchten Punkte zeige ich dann im Fazit die Freiheiten und Grenzen auf, die für die Prostituierten im Kult galten.
2. Die Frau im Kult
Im klassischen Griechenland wurde von der Frau erwartet, dass sie an den kultischen Handlungen ihrer Polis teilnahm. Sie war dabei dem Mann gleichgestellt und konnte im gleichen Umfang den Göttern Ehre erweisen. Demzufolge dürfte folglich jede Frau die Erlaubnis haben an den verschiedenen Kulten teilzunehmen. Jedoch gab es zwischen den Frauen Unterschiede in ihrem Status. Es wurde in der Polis zwischen der Bürgerin und der Fremden unterschieden.
Der Bürgerin war es gestattet an fast allen Kulten aktiv teilzunehmen. Die Bürgerinnen unterteilten sich dabei noch in zwei Gruppen: 1. der Jungfrau und 2. der Matrone. Während die Matrone als verheiratete Frau umschrieben werden kann, ist die Jungfrau schwerer zu definieren. Die Jungfrau war entgegen unserem heutigen Verständnis lediglich eine unverheiratete Frau. So handelte es sich um junge Frauen, die noch nicht in eine Ehe eingegangen waren, oder auch um ältere Frauen, die bereits eine Ehe hinter sich hatten. Die Pythia beim Orakel von Delphi war keineswegs eine junge Frau, nur weil sie als Jungfrau tituliert wurde, sondern oft eine ältere Frau, die bereits im Eheleben gestanden hat aus der möglicherweise Kinder hervorgingen. Hierzu findet man bei Pausanias eine Anekdote, die beschreibt, dass es auch zu Änderungen im Priesteramt kommen konnte:
“At that time the office of priestess to the goddess was still always held by a girl who was a virgin. The maiden persisted in resisting the advances of Aristocrates, but at last, when she had taken refuge in the sanctuary, she was outraged by him near the image of Artemis. When the crime came to be generally known, the Arcadians stoned the culprit, and also changed the rule for the future; as priestess of Artemis they now appoint, not a virgin, but a woman who has had enough of intercourse with men.”[2]
Zuerst war die Artemispriesterin tatsächlich eine Jungfrau, durch den Gewaltakt im Heiligtum änderten die Arkadier jedoch die Voraussetzungen für das Priesteramt. Die Jungfrau war jetzt eine Frau, die, aufgrund ihres Alters, keinen Geschlechtsverkehr mehr hatte. Den Titel „Jungfrau“ behielt sie aber weiterhin.
2.1 Die Fremde
Neben den Bürgerinnen gab es die Fremden. Diese Gruppe unterteilte sich wiederum in Sklaven und Metöken (Mitbewohner). Während die Sklaven einem Besitzer zugeordnet waren, handelt es sich bei den Metöken um freie Einwohner. Viele Hetären waren zuerst Sklavinnen und erhielten durch ihre Freilassung den Status einer Metökin. Bei diesem Prozess kann man verallgemeinernd sagen, dass je begehrter eine Hetäre war, desto schneller sie vom Sklaven- zum Metökenstatus gelangte.[3] Die Metökinnen mussten sich als Hetären registrieren lassen, sofern sie diesen Beruf ausübten, und bezahlten dadurch Steuern.[4] Die Metökinnen lebten freier als die Bürgerfrauen, da sie nicht den gesellschaftlichen und sittlichen Normen der Polis untergeben waren. Sie konnten Gäste empfangen, Liebhaber besuchen und an Symposien teilnehmen. Oft gingen die freien Hetären ein Konkubinat ein. Die Verbindung zu einem Mann, der dadurch zum Patron wurde, sicherte der Frau ein quasi ehelichen Schutz und garantierte ihr Rechtsverhältnis. Die Metökinnen brauchten den Patron auch für Rechtsgeschäfte. Laut ihrem Status durften sie sonst nur Geld besitzen, aber keine Immobilien, Grundbesitz und Sklaven. Dieses Recht war allein dem Bürger vorenthalten und den Metöken nur durch einen Patron möglich. Daher waren Metöken nie die rechtmäßigen Besitzer von Sklaven, sondern ihr Patron.
Die fremden Frauen, egal ob Sklavinnen oder Metökinnen, durften nur passiv an den Kulten teilnehmen und ihnen war es verwehrt als Ausführende von Riten den Göttern zu dienen. Ebenso durften sie nicht mit Priestern die Ehe eingehen.
Die Prostituierten zählten, da sie entweder Sklaven oder Freigelassene waren, zu den Fremden. Die Griechen machten folglich keinen Unterschied zwischen den Berufen der Frauen, sondern lediglich zwischen ihren Status innerhalb der Polis. Der Zutritt zu den Tempeln war somit jeder Frau erlaubt. Allerdings musste jeder auch besondere Vorschriften beachten, die den Zugang in die Heiligtümer regulierten.
3. Reinigung
Die Reinheitsvorschriften galten in erster Linie für den Tempelzutritt nach dem sexuellen Kontakt. Dies sollte keineswegs bedeuten, dass der sexuelle Kontakt unmoralisch war. Die Vorschriften lassen sich eher auf den Respekt zurückführen. Die Griechen erwiesen durch die Reinigung Respekt vor den Göttern, aber auch vor der Gemeinschaft. Ein guter Beleg hierfür ist die Vorschrift, dass kein Geschlechtsverkehr vor dem Herdfeuer stattfinden durfte. Das Herdfeuer war heilig.
Sex war im klassischen Griechenland eine private Angelegenheit und fand nur hinter verschlossenen Türen statt. Um eine Trennung zwischen Privatem und Öffentlichen herzustellen, war daher die Reinigung nötig. Da auch der Tempelbesuch ein öffentlicher Auftritt war, musste sich auch aus diesem Grund jeder reinigen. Sex galt als Verunreinigung und daher ist es nicht verwunderlich, dass der sexuelle Akt im Tempel verboten war:
„Auch das Verbot, mit Weibern Umgang zu pflegen in den Tempeln, oder ungewaschen nach weiblichem Umgang in den Tempel zu treten, haben die Ägypter zuerst eingeführt. Denn fast alle anderen Menschen, außer den Ägyptern und Hellenen, pflegen Umgang mit Weibern in den Tempeln und erheben sich von den Weibern ungewaschen zum Eintritt in einen Tempel.“[5]
Anhand dieser Quelle ist ersichtlich, dass in Griechenland das Verbot bestand, innerhalb der Tempelanlagen sexuellen Verkehr zu haben. Bei Pausanias werden auch die Konsequenzen aufgezeigt, die Geschlechtsverkehr im Heiligtum hervorrief. In seiner Beschreibung des Artemisheiligtums in Achaea, kommt er auf eine Geschichte zu sprechen, die sich dort einst zugetragen haben soll. Die jungfräuliche Priesterin Komaitho soll sich in einen Mann namens Melanippos verliebt haben. Die beiden Liebenden trafen sich im Heiligtum und kamen sich dort auf sexueller Ebene näher:
“The history of Melanippus, like that of many others, proved that love is apt both to break the laws of men and to desecrate the worship of the gods, seeing that this pair had their fill of the passion of love in the sanctuary of Artemis. And hereafter also were they to use the sanctuary as a bridal-chamber. Forthwith the wrath of Artemis began to destroy the inhabitants; the earth yielded no harvest, and strange diseases occurred of an unusually fatal character.”[6]
Laut dem Mythos soll die Göttin Artemis erbost gewesen sein, so dass sie, wie die Quelle zeigt, Dürre und Krankheiten schickte. Sie ließ sich erst besänftigen, nachdem das Liebespaar ihr zu Ehren geopfert wurde. Wenngleich die Geschichte fragwürdig erscheint, so zeigt sie dennoch, dass die Einhaltung der Tempelordnung im Interesse der Allgemeinheit war.
Als große Ausnahme gilt das Heiligtum des Pans. Nach der Auffassung der Griechen hätte die lüstern den Nymphen nachsteigende Gottheit keine Einwände gegen sexuellen Kontakt in ihrem Heiligtum. In Aristophanes Komödie Lysistrata schlägt Kinesias seiner Frau Myrrhine vor, sich im Heiligtum des Pan zu lieben.
CINESIAS: You love me! Then dear girl, let me also love you.
MYRRHINE: You must be joking. The boy's looking on.
CINESIAS: Here, Manes, take the child home! There, he's gone.
There's nothing in the way now. Come to the point.
MYRRHINE: Here in the open! In plain sight?
CINESIAS: In Pan's cave. A splendid place.
MYRRHINE: Where shall I dress my hair again
Before returning to the citadel?
CINESIAS: You can easily primp yourself in the Clepsydra.[7]
[...]
[1] Reinsberg S.80
[2] Paus. 8.5.11-12
[3] Reinsberg S.151
[4] Aischin. 1,119
[5] Herodt. 2.64
[6] Paus. 7.19.3
[7] Ar. Lys. 910-13
- Quote paper
- Sven-Ole Schoch (Author), 2006, Prostitution und Kult in der griechischen Antike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66927